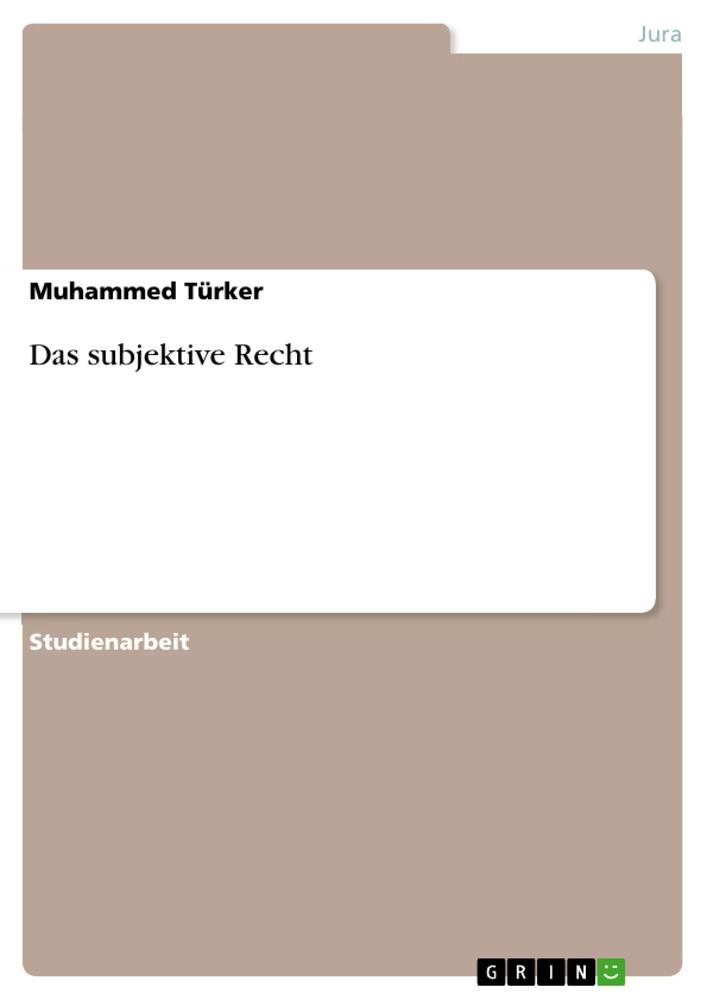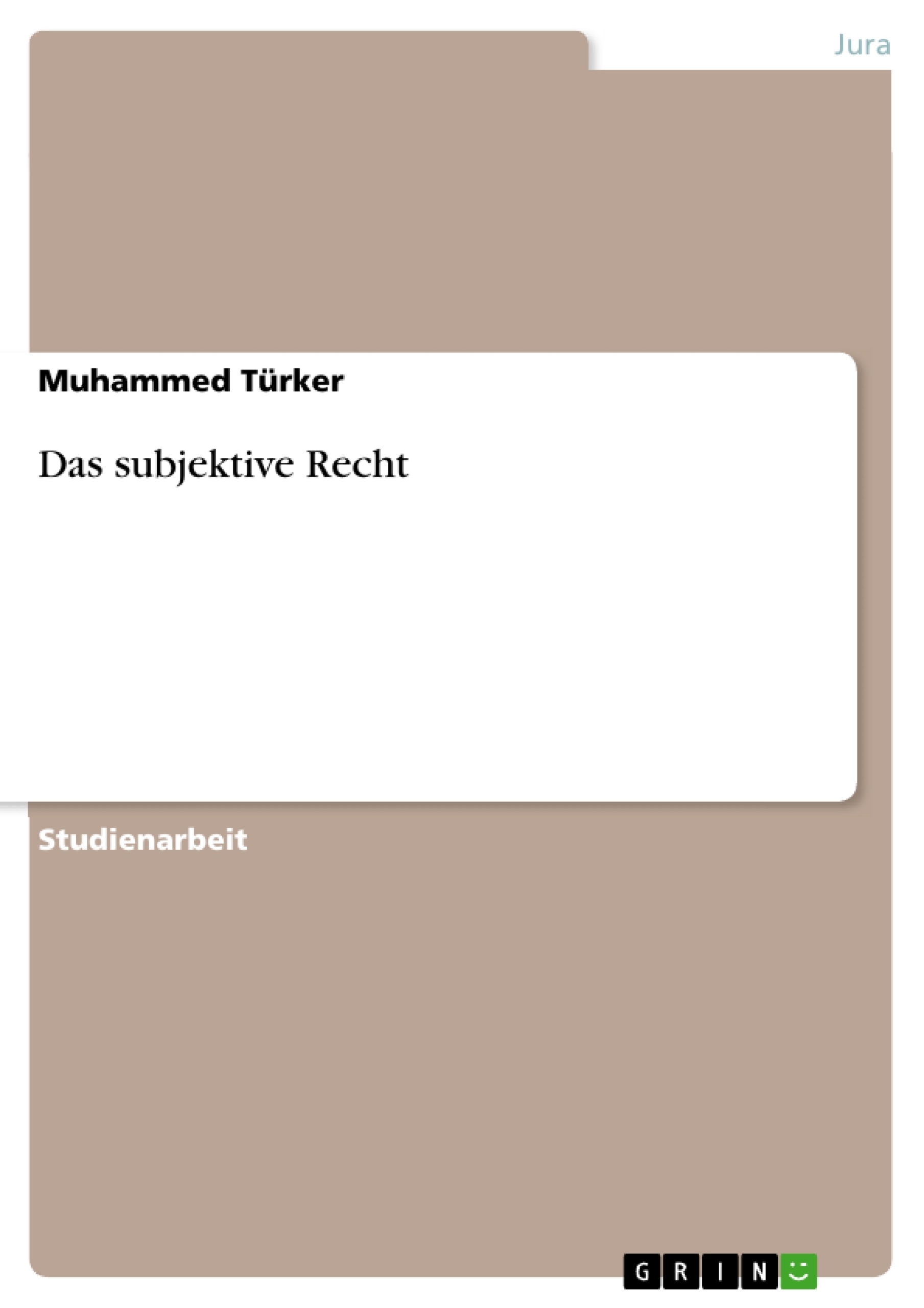Recht und Pflicht sind die maßgeblichen Instrumente, mit deren Hilfe das Zivilrecht die rechtliche Stellung der Privatrechtssubjekte zueinander gestaltet. Dabei existiert eine zwangsläufige Korrelation zwischen dem Recht des Berechtigten und der Pflicht des Adressaten.
Das Wort „Recht“ ist in der deutschen Sprache zweideutig. Es steht einmal für die Summe aller Rechtsnormen, die für jedermann gelten, einmal für das Recht des Subjekts. Mithin verleiht die Betrachtungsweise dem Recht ein anderes Attribut: objektiv oder subjektiv. Letzteres, das subjektive Recht, ist, wie es von Thur einmal formulierte, „der zentrale Begriff des Privatrechts“. Auch im Hinblick auf das Verständnis der Grund- und Menschenrechte nimmt es eine zentrale Rolle ein. Als Gegenbegriff zum objektiven Recht, bezeichnet er die dem einzelnen Individuum gebührende Rechtsposition. Damit lässt sich das subjektive Recht als emanatio des objektiven Rechts deuten. Das Rechtssubjekt als Träger von Rechten und Pflichten bildet mithin die Essenz der Theorie vom subjektiven Recht. Darin ist der ethische Individualismus der kantischen Rechtsphilosophie zu erkennen. Demgegenüber werden in totalitären Regimen, in welchen der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht, subjektive Rechte negiert. Im Vergleich dazu stellen die subjektiven Rechte heute gegebenenfalls im Verwaltungsprozessrecht bei der Bestimmung der Klagebefugnis nach § 42 II VwGO ein Problem dar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Der Begriff des subjektiven Rechts
- I. Das subjektive Recht als Willensmacht
- II. Das subjektive Recht als rechtlich geschütztes Interesse
- III. Die Definition des subjektiven Rechts nach der Kombinationstheorie
- IV. Larenz' Rahmenbegriff des subjektiven Rechts
- C. Die Grenzen der subjektiven Rechte
- I. Relevanz der Unterscheidung
- II. Innentheorie
- III. Außentheorie
- VI. Vergleich der Theorien mit verschiedenen Arten subjektiver Rechte
- 1. Vergleich mit Persönlichkeitsrechte
- 2. Vergleich mit persönliche Familienrechte
- 3. Vergleich mit Herrschaftsrechte
- 4. Vergleich mit Ansprüche
- 5. Vergleich mit Gestaltungsrechte
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff des subjektiven Rechts, seiner Definition und seinen Grenzen. Ziel ist es, verschiedene Theorien und Ansätze zum Verständnis des subjektiven Rechts zu vergleichen und zu analysieren, um ein umfassenderes Bild dieses zentralen Rechtsbegriffs zu vermitteln.
- Definition des subjektiven Rechts
- Das subjektive Recht als Willensmacht und rechtlich geschütztes Interesse
- Grenzen und Abgrenzung zu anderen Rechtsbegriffen
- Vergleichende Analyse verschiedener Theorien
- Relevanz der Unterscheidung zwischen Innen- und Außentheorie
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung dient der Strukturierung der gesamten Arbeit und gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel. Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz, der zur Klärung der komplexen Thematik des subjektiven Rechts verfolgt wird. Die Gliederung des Textes wird prägnant dargestellt, um dem Leser einen klaren Fahrplan für das Verständnis der Argumentationslinie zu bieten. Der einleitende Teil bereitet den Leser somit auf die tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem zentralen Thema vor.
B. Der Begriff des subjektiven Rechts: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen Frage nach der Definition des subjektiven Rechts. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze vorgestellt und kritisch beleuchtet, wie beispielsweise die Betrachtung des subjektiven Rechts als Willensmacht oder als rechtlich geschütztes Interesse. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kombinationstheorie und Larenz' Rahmenbegriff, welche beide unterschiedliche Perspektiven auf das Verständnis des subjektiven Rechts bieten. Der Vergleich dieser Theorien ermöglicht eine differenzierte Darstellung der Problematik und der verschiedenen Facetten des Rechtsbegriffs. Die Kapitelteile führen den Leser durch eine systematische Analyse der zentralen Debatten in der Rechtswissenschaft.
C. Die Grenzen der subjektiven Rechte: Dieses Kapitel erörtert die Grenzen des subjektiven Rechts. Es wird zunächst die Relevanz der Unterscheidung zwischen verschiedenen Theorien, insbesondere der Innentheorie und Außentheorie, herausgearbeitet. Im Anschluss daran erfolgt ein detaillierter Vergleich dieser Theorien anhand verschiedener Arten subjektiver Rechte, wie Persönlichkeitsrechte, Familienrechte, Herrschaftsrechte, Ansprüche und Gestaltungsrechte. Der Vergleich dient dazu, die Reichweite und die Einschränkungen subjektiver Rechte in verschiedenen Rechtsbereichen aufzuzeigen und ein umfassenderes Verständnis für die Anwendung des Begriffs im konkreten Kontext zu schaffen. Die Argumentation ist darauf ausgerichtet, die komplexen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Rechtstheorien verständlich darzustellen.
Schlüsselwörter
Subjektives Recht, Willensmacht, rechtlich geschütztes Interesse, Kombinationstheorie, Larenz' Rahmenbegriff, Grenzen subjektiver Rechte, Innentheorie, Außentheorie, Persönlichkeitsrechte, Familienrechte, Herrschaftsrechte, Ansprüche, Gestaltungsrechte, Rechtsvergleichung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Subjektives Recht
Was ist der Inhalt des Textes "Subjektives Recht"?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Begriff des subjektiven Rechts. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Der Text analysiert verschiedene Theorien zur Definition des subjektiven Rechts (z.B. als Willensmacht oder rechtlich geschütztes Interesse) und untersucht die Grenzen subjektiver Rechte im Vergleich mit verschiedenen Rechtsbegriffen wie Persönlichkeitsrechten, Familienrechten, Herrschaftsrechten, Ansprüchen und Gestaltungsrechten.
Welche Theorien zur Definition des subjektiven Rechts werden im Text behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Theorien, darunter die Betrachtung des subjektiven Rechts als Willensmacht und als rechtlich geschütztes Interesse. Im Mittelpunkt stehen die Kombinationstheorie und Larenz' Rahmenbegriff, die im Detail analysiert und verglichen werden.
Welche Aspekte der Grenzen subjektiver Rechte werden beleuchtet?
Der Text untersucht die Grenzen des subjektiven Rechts anhand eines Vergleichs der Innentheorie und Außentheorie. Dieser Vergleich wird anhand verschiedener Arten subjektiver Rechte (Persönlichkeitsrechte, Familienrechte, Herrschaftsrechte, Ansprüche und Gestaltungsrechte) veranschaulicht, um die Reichweite und Einschränkungen in verschiedenen Rechtsbereichen aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe umfassen: Subjektives Recht, Willensmacht, rechtlich geschütztes Interesse, Kombinationstheorie, Larenz' Rahmenbegriff, Grenzen subjektiver Rechte, Innentheorie, Außentheorie, Persönlichkeitsrechte, Familienrechte, Herrschaftsrechte, Ansprüche, Gestaltungsrechte und Rechtsvergleichung.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in diesen?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: A. Einleitung: Allgemeine Einführung und Überblick. B. Der Begriff des subjektiven Rechts: Definition und Analyse verschiedener Theorien. C. Die Grenzen der subjektiven Rechte: Untersuchung der Grenzen anhand der Innentheorie und Außentheorie sowie verschiedener Rechtsbegriffe. D. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Ziel des Textes ist es, verschiedene Theorien und Ansätze zum Verständnis des subjektiven Rechts zu vergleichen und zu analysieren, um ein umfassenderes Bild dieses zentralen Rechtsbegriffs zu vermitteln.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Begriff des subjektiven Rechts auseinandersetzen möchten. Er eignet sich für Studierende der Rechtswissenschaften und andere Personen, die ein tieferes Verständnis dieses komplexen Rechtsbegriffs erlangen wollen.
- Quote paper
- Muhammed Türker (Author), 2016, Das subjektive Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369552