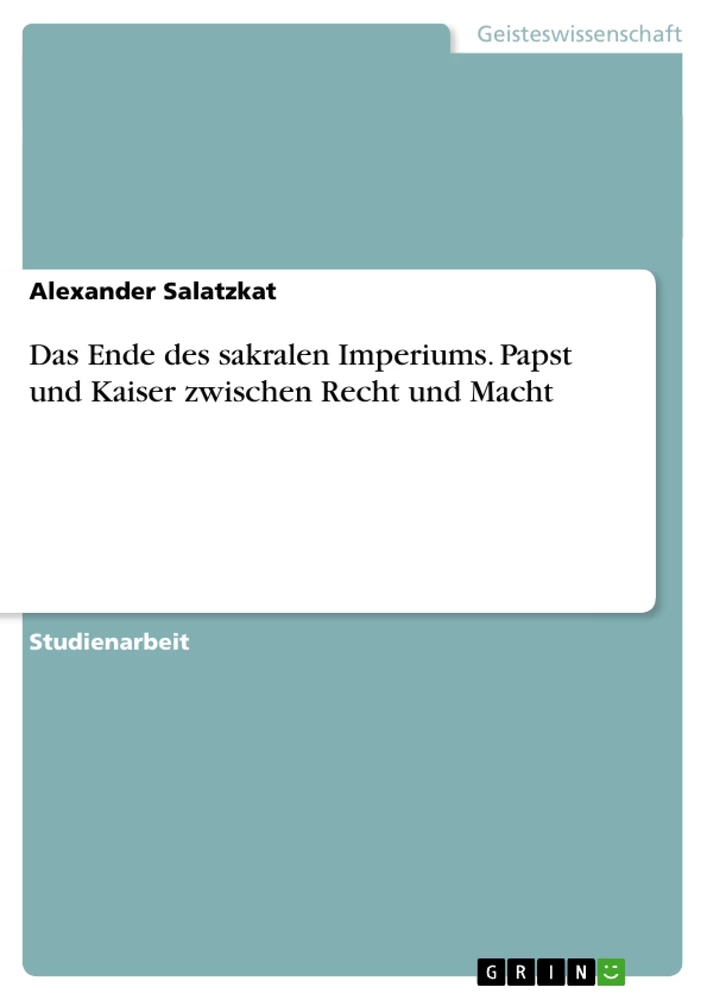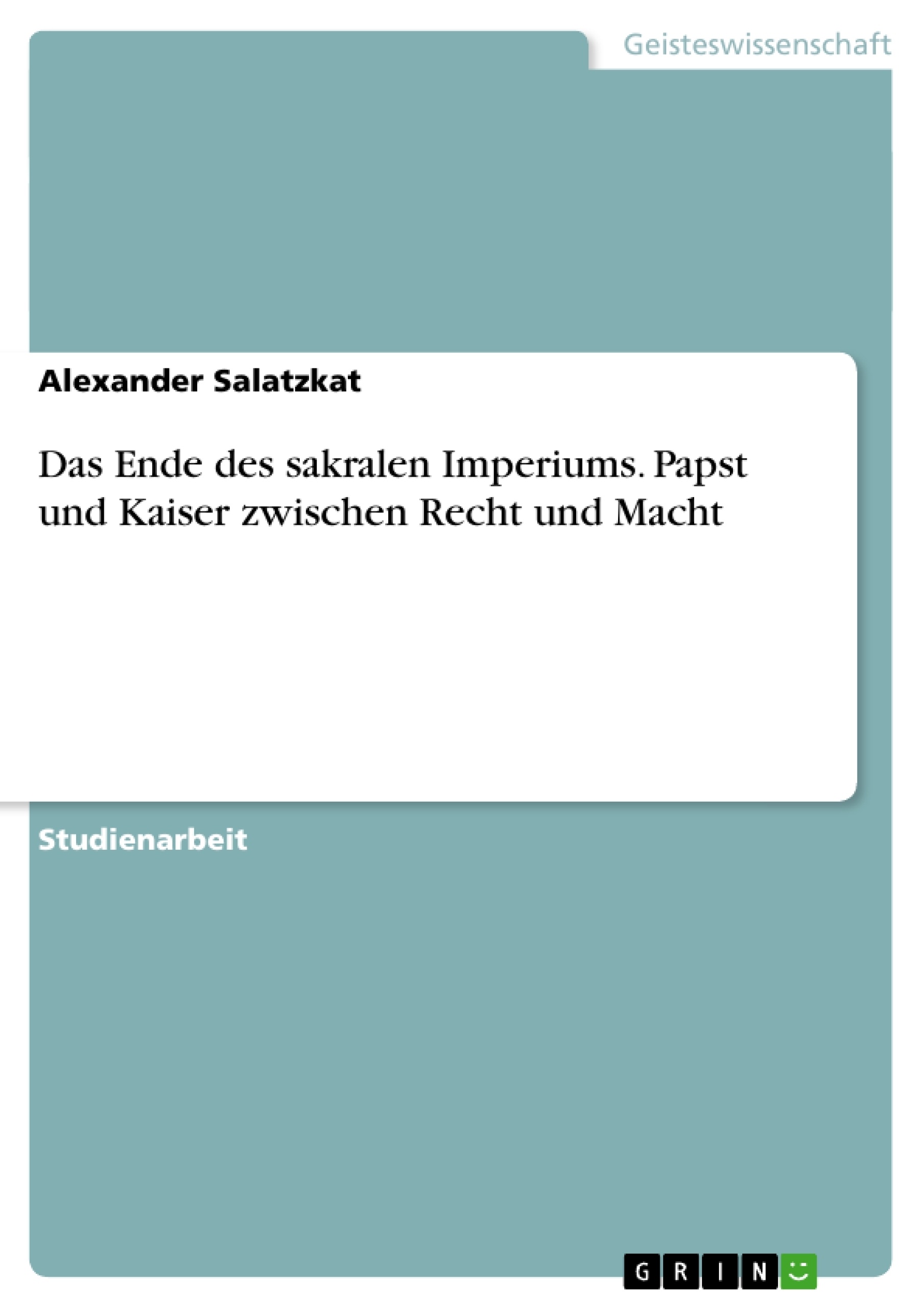[...] Der römische Bischof erhob sich aus der städtischen Bedeutung und von nun an kann „kein Rechtssatz und kein Buch ohne seine Autorität als kirchenrechtlich verbindlich gelten […].“ Die Abspaltung der oströmischen Kirche und die zunehmende Verweltlichung innerhalb der Kirche hatten zu einem Reformbedarf geführt. Die alten Ordnungen schienen nicht mehr zu gelten und die „einzig wahre“ Kirche erhob nun auch ihren Anspruch, in weltlichen Dingen mitzureden. Dies waren aber nur einige der Ursachen für den so genannten Investiturstreit. Von all den Ereignissen ist der sprichwörtliche: „Gang nach Canossa“ am meisten bekannt. Drei Tage soll Heinrich IV. barfüssig und im Büßergewand vor der Burg Canossa gewartet haben, bis Papst Gregor VII. ihn auf Drängen seines Umfeldes wieder in den Kreis der Christen aufgenommen hat.2 Der Vorfall in den Bergen wäre heute wohl kaum von Interesse, wenn nicht die beiden Großen ihrer Zeit daran beteiligt gewesen wären. Der Konflikt war aber „[…] nicht nur ein kirchenpolitischer[…]“ sondern es wurden „[…] gleichgewichtig Fragen des Reichsrechts und der zwischen König und Fürsten politisch spielenden »gewêre« an rechtlich vielschichtigen Zonen und Schichten der Herrschaft“ ausgetragen.3 „Aus dem ‚Ringen’ zwischen Kaiser und Papst über die ‚rechte Ordnung der Welt’ […], gingen neue Formen und Ebenen von Kommunikationen hervor […]“, um sich so Zustimmung und Unterstützung der wankelmütigen Parteigänger zu sichern.4 In der (parteiischen) Berthold-Chronik kann man lesen, dass der (überaus unfehlbar dargestellte) Papst die „Zeichen seiner [des Kaisers] Unreinheit“ („indicium impuriatis“) erkennen und er „in keiner Weise, seinen Worten vollen Glauben schenken“ konnte.5 [...] 2 Man nimmt heute an, dass Heinrich IV nicht wirklich barfüssig und halb nackt vor der Burg gestanden hat, dennoch war sein Verhalten, als auch der seines „kleinen“ Hofstaates demütig. 3 Kämpf, Hellmut: Vorwort, S. IX in: Kämpf, Hellmut (Hrsg.): Canossa als Wende. Ausgewählte Aufsätze zur neueren Forschung, Berlin 1976. 4 Suchan, Monika: Publizistik im Zeitalter Heinrichs VI. S. 29 in: Hruza, Karel: Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert), Wien 2002. 5 Robinson, Ian Stuart: Bertholds und Bernolds Chroniken, Darmstadt 2002, S.132f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Imperium und Sacerdotium
- Von Recht und Unrecht
- Civitas Dei und Civitas Terrena
- Papst zwischen Macht und Lehre
- Beginn eines Wandels der Kirche?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Investiturstreit, ein zentrales Ereignis des 11. Jahrhunderts, das die Machtverhältnisse zwischen Kaiser und Papst sowie die rechte Ordnung der Welt grundlegend veränderte. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die (Un-)Rechtmäßigkeit päpstlichen und kaiserlichen Handelns zu beurteilen ist.
- Die Rolle des Papstes im Investiturstreit
- Der Einfluss des römischen Rechts auf den Streit
- Die Bedeutung des christlichen Weltreiches
- Die Entwicklung des Machtverhältnisses zwischen Kaiser und Papst
- Die Frage der Legitimität und Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das 11. Jahrhundert war geprägt von Veränderungen. Die wachsende Macht des Papstes und die Abspaltung der oströmischen Kirche führten zu einem Reformbedarf in der katholischen Kirche. Der Investiturstreit, mit dem „Gang nach Canossa“ als Höhepunkt, zeigt die Auseinandersetzung um die rechte Ordnung der Welt zwischen Kaiser und Papst.
Imperium und Sacerdotium
Der Streit um die Einsetzung von Bischöfen im Reich hat seinen Ursprung in der Spätantike. Konstantin der Große erhob das Christentum zur offiziellen Religion und übernahm die Leitung der kirchlichen Konzilien. Im 8. Jahrhundert löste sich die römische Kirche von den oströmischen Kaisern und suchte Schutz bei den Frankenkönigen. Die Krönung Karls des Großen zum Kaiser durch den Papst im Jahr 800 legte den Grundstein für ein neues Machtverhältnis zwischen Kaiser und Papst.
Von Recht und Unrecht
Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst war nicht nur kirchlich, sondern auch politisch. Das Reichsgut und das Verhältnis zwischen König und Fürsten waren zentrale Streitpunkte. Die beiden Kontrahenten setzten auf Propaganda und Kommunikation, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Civitas Dei und Civitas Terrena
Der Investiturstreit verdeutlicht die Spannung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Das Ideal eines christlichen Weltreiches mit einem Kaiser und einem Papst als Oberhäupter stand der Realität eines durch die Völkerwanderung zerrissenen Imperiums gegenüber.
Papst zwischen Macht und Lehre
Die Rolle des Papstes im Investiturstreit war geprägt von dem Anspruch auf absolute Macht und dem Recht zur Einsetzung von Bischöfen. Der Streit um die „rechte Ordnung der Welt“ führte zu neuen Formen der Kommunikation und Propaganda.
Schlüsselwörter
Investiturstreit, Kaiser, Papst, Recht, Macht, Kirche, Imperium, Sacerdotium, Civitas Dei, Civitas Terrena, Gregor VII., Heinrich IV., Canossa, Konzilien, Reichsrecht, Rechtmäßigkeit, Legitimität, Kommunikation, Propaganda.
- Quote paper
- Diplom Staatswissenschaftler Alexander Salatzkat (Author), 2004, Das Ende des sakralen Imperiums. Papst und Kaiser zwischen Recht und Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36935