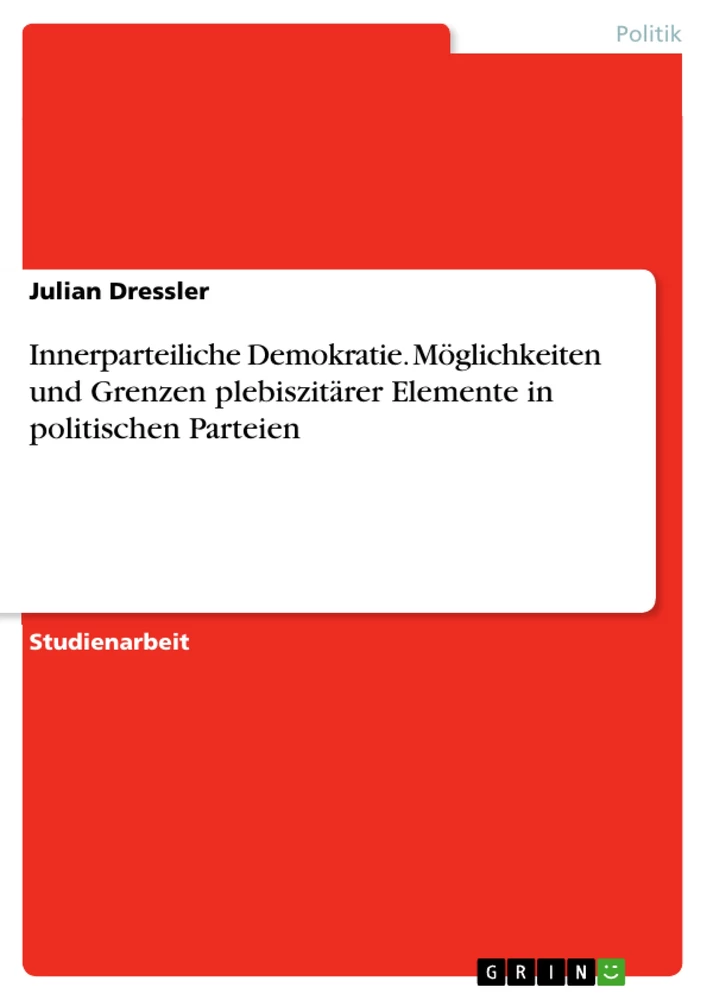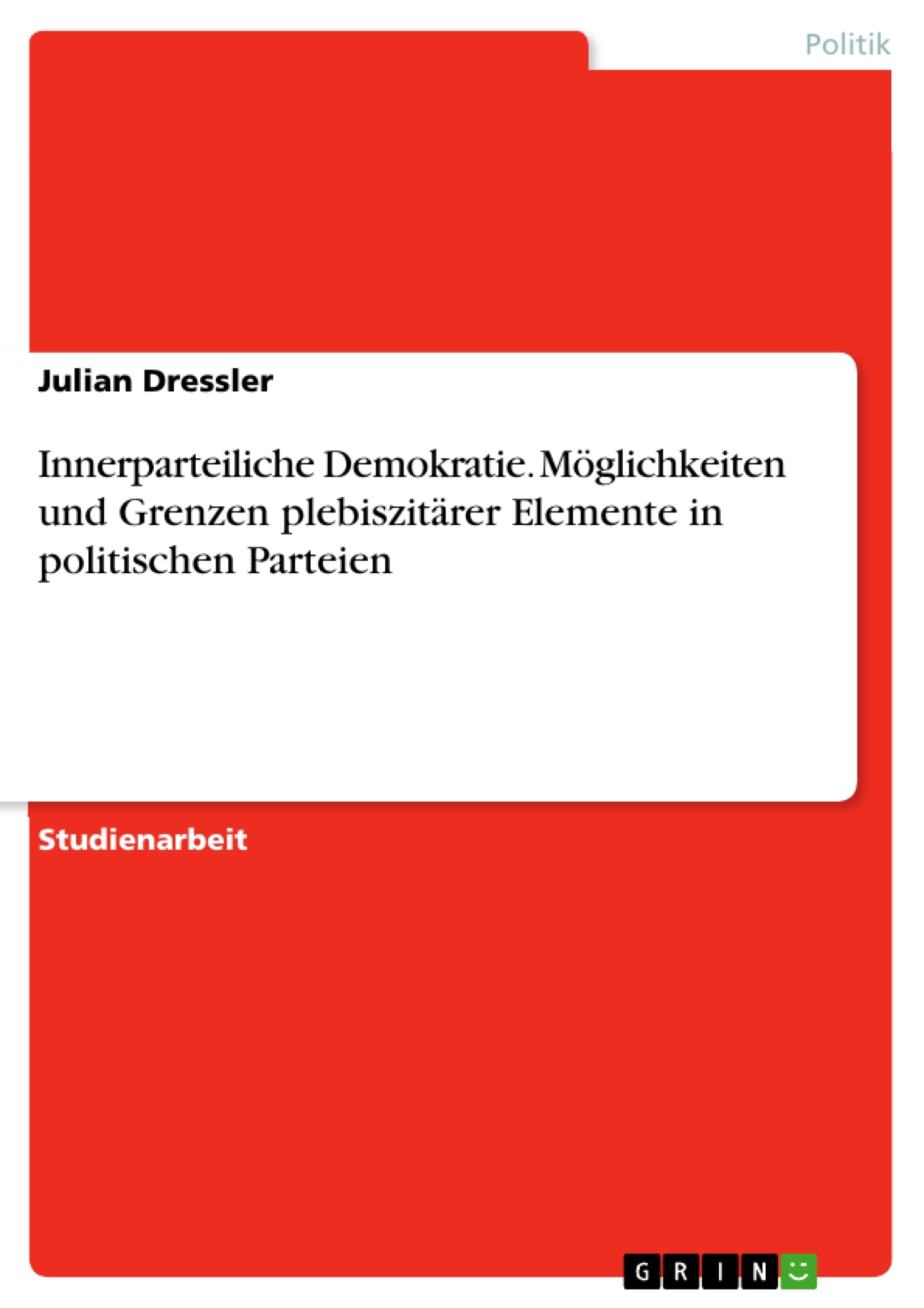In dieser Hausarbeit werden Vorschläge zur Erweiterung plebiszitärer Elemente im Rahmen innerparteilicher Demokratie kritisch untersucht.
Es wird ein Vorschlag zur Umkehr des Trends sinkender Parteimitgliederzahlen behandelt, der vorsieht, das Engagement im Rahmen einer politischen Partei „mittels verbreiterten und wirkungsvolleren Partizipationschancen“, also durch plebiszitäre Elemente berücksichtigende Strukturreformen attraktiver zu machen. Direktdemokratische Strukturen innerhalb der Parteien sollen ein Gegengewicht zur in „Distanzierung von der Weimarer Republik“ eher repräsentativ organisierten Demokratie der Bundesrepublik bilden.
Da die politischen Organe der Bundesrepublik einzelnen Personen nur indirekt über die Parteien zugänglich sind, müssen also die Organisationsformen der Parteien geeignet sein, Kommunikationsströme „von außen in die Partei und von unten, von den Parteimitgliedern zur Parteispitze“ zu leiten, um die partikulären Interessen der Bürger in die rechtlich wirksame Entscheidungsfindung der Staatsorgane einfließen zu lassen.
Habermas zufolge müssen die Strukturen der Parteien vor allem „eine ungehinderte Kommunikation und öffentliches Räsonnement gestatten“, um ihren verfassungsrechtlichen Auftrag, „bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“ zu wirken, erfüllen zu können. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entscheidungen über Sachfragen
- 3. Entscheidungen über Personalfragen
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen plebiszitärer Elemente in politischen Parteien, um dem Trend sinkender Mitgliederzahlen entgegenzuwirken. Ziel ist es, Vorschläge zu entwickeln, wie innerparteiliche Partizipationschancen erweitert und die Attraktivität der Parteimitgliedschaft gesteigert werden können, ohne die Handlungsfähigkeit der Partei zu beeinträchtigen.
- Sinkende Mitgliederzahlen in deutschen Parteien und deren Folgen
- Möglichkeiten der Steigerung innerparteilicher Demokratie durch plebiszitäre Elemente
- Einfluss plebiszitärer Elemente auf Entscheidungen über Sachfragen
- Einfluss plebiszitärer Elemente auf Entscheidungen über Personalfragen
- Abwägung zwischen erhöhter Partizipation und Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Partei
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den anhaltenden Rückgang der Mitgliederzahlen in deutschen Parteien und deren negative Auswirkungen auf die demokratische Legitimation. Sie skizziert den zentralen Forschungsansatz, der darin besteht, die Attraktivität der Parteimitgliedschaft durch verstärkte Partizipationsmöglichkeiten mittels plebiszitärer Elemente zu erhöhen. Der Text argumentiert, dass eine Stärkung direktdemokratischer Strukturen innerhalb der Parteien ein Gegengewicht zur bestehenden repräsentativen Demokratie bilden und die Kommunikation zwischen Parteiführung und Basis verbessern könnte. Eine ökonomische Demokratiekonzeption wird erwähnt, die die Chancengleichheit aller politischen Produkte (inhaltliche Vorschläge und Kandidaturen) betont und somit die Attraktivität der Parteimitgliedschaft steigern soll.
2. Entscheidungen über Sachfragen: Dieses Kapitel untersucht die Einführung plebiszitärer Elemente in Bezug auf politische Sachfragen. Zeschmann's Argument, dass Mitgliederbefragungen und -begehren zu einem breiteren innerparteilichen Diskurs führen und die politische Willensbildung transparenter machen, wird hier diskutiert. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Komplexität politischer Entscheidungen in Ja/Nein-Fragen umgesetzt werden kann, ohne dabei die Entscheidungsfindung zu vereinfachen oder zu verzerren. Der Text untersucht, wie die Vernetzung von innerparteilicher und parteiexterner Öffentlichkeit durch solche Referenden verbessert werden kann, sowie den potenziellen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und die Rückkopplung an die Wählerschaft.
Schlüsselwörter
Innerparteiliche Demokratie, Plebiszitäre Elemente, Mitgliederzahlen, Partizipation, Direktdemokratie, Repräsentative Demokratie, Entscheidungsfindung, Handlungsfähigkeit, politische Parteien, Mitgliederbefragungen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Plebiszitäre Elemente in politischen Parteien
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument untersucht die Möglichkeiten und Grenzen plebiszitärer Elemente (wie Mitgliederbefragungen und -begehren) in politischen Parteien, um dem Rückgang der Mitgliederzahlen entgegenzuwirken und die innerparteiliche Demokratie zu stärken. Es analysiert den Einfluss solcher Elemente auf Entscheidungen über Sachfragen und Personalien und bewertet die Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Partei.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Vorschläge zu entwickeln, wie innerparteiliche Partizipationschancen erweitert und die Attraktivität der Parteimitgliedschaft gesteigert werden können, ohne die Handlungsfähigkeit der Partei zu beeinträchtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen Parteiführung und Basis.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: sinkende Mitgliederzahlen in deutschen Parteien und deren Folgen; Möglichkeiten der Steigerung innerparteilicher Demokratie durch plebiszitäre Elemente; Einfluss plebiszitärer Elemente auf Entscheidungen über Sachfragen und Personalfragen; Abwägung zwischen erhöhter Partizipation und Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Partei; die Vernetzung von innerparteilicher und parteiexterner Öffentlichkeit durch Referenden und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung.
Wie wird der Einfluss plebiszitärer Elemente auf Entscheidungen über Sachfragen untersucht?
Das Dokument diskutiert, wie die Komplexität politischer Entscheidungen in für Mitgliederbefragungen geeignete Formate umgesetzt werden kann, ohne die Entscheidungsfindung zu verzerren. Es wird auch der mögliche Beitrag solcher Elemente zu einem breiteren innerparteilichen Diskurs und transparenterer Willensbildung beleuchtet.
Welche Rolle spielt die ökonomische Demokratiekonzeption?
Das Dokument erwähnt eine ökonomische Demokratiekonzeption, die die Chancengleichheit aller politischen Produkte (inhaltliche Vorschläge und Kandidaturen) betont und somit die Attraktivität der Parteimitgliedschaft steigern soll. Dies unterstreicht den Aspekt der fairen Beteiligung und des transparenten Wettbewerbs innerhalb der Partei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Innerparteiliche Demokratie, Plebiszitäre Elemente, Mitgliederzahlen, Partizipation, Direktdemokratie, Repräsentative Demokratie, Entscheidungsfindung, Handlungsfähigkeit, politische Parteien, Mitgliederbefragungen.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Entscheidungen über Sachfragen und Personalfragen, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Was ist das Fazit der Arbeit (allgemein)?
Das Fazit des Dokuments ist im bereitgestellten Textauszug nicht enthalten. Es würde die Schlussfolgerungen der Untersuchung zu den Möglichkeiten und Grenzen plebiszitärer Elemente in politischen Parteien zusammenfassen und Empfehlungen für die Praxis geben.
- Arbeit zitieren
- Julian Dressler (Autor:in), 2016, Innerparteiliche Demokratie. Möglichkeiten und Grenzen plebiszitärer Elemente in politischen Parteien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369352