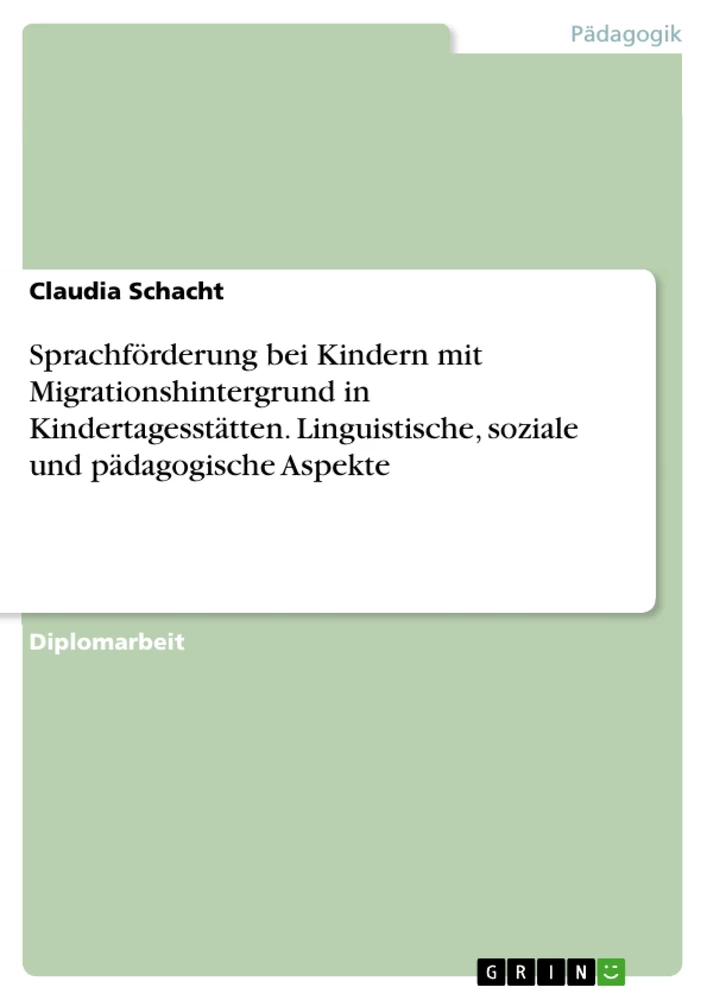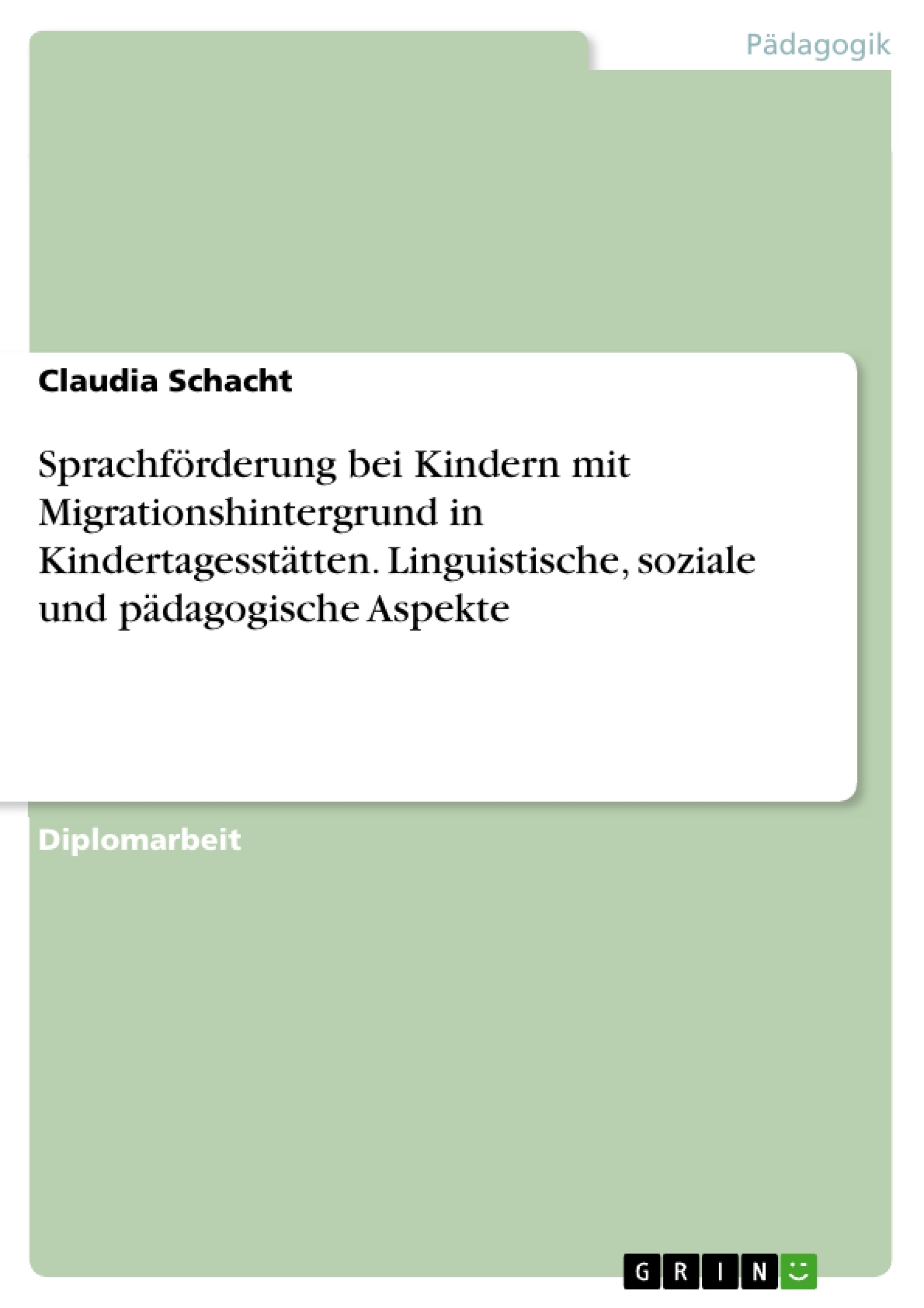Gegenstand dieser Arbeit ist die darstellende Analyse der bestehenden Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten – unter Berücksichtigung linguistischer, sozialer und pädagogischer Aspekte. In dieser Arbeit wird im Wesentlichen der Frage nachgegangen, wie sich die Benachteiligung der Migrantenkinder kompensieren lässt und insbesondere, wie diese Kinder schon frühzeitig in ihrer Sprachkompetenz in der deutschen Sprache gefördert werden können.
So wird nachhaltig auf den Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitspracherwerb und auf die Relevanz der frühen Zweisprachigkeit aufmerksam gemacht, wobei sowohl die Praxis innerhalb der Kindertagestätten als auch die Sprachförderkonzepte in diese Betrachtung miteinbezogen werden. Die Bedeutung der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb wird dargestellt und über diese Darstellung werden in Verbindung mit der Bewertung verschiedener Sprachförderkonzepte die positiven Aspekte der Mehrsprachigkeit hervorgehoben. Um diese Ziele erreichen zu können, ist der interdisziplinäre Ansatz dieser Arbeit unerlässlich; es werden somit Erkenntnisse der Linguistik, der Neurobiologie sowie der Sozialpädagogik und der Interkulturellen Pädagogik herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundlagen zum Spracherwerb
- 1.1 Begriffsdefinitionen: Kinder mit Migrationshintergrund, Mehrsprachigkeit und Spracherwerbstypen
- 1.2 Erkenntnisse der Hirnforschung zum Spracherwerb
- 1.2.1 Sprachentwicklung aus neurobiologischer Perspektive
- 1.2.2 Neurobiologische Unterschiede zwischen simultanem und nachzeitigem Zweitspracherwerb
- 1.3 Spracherwerbstheorien
- 1.4 Phasen des Spracherwerbs
- 1.4.1 Kognitive Entwicklung und Spracherwerb
- 1.4.2 Entwicklung von Wortbedeutungen
- 1.4.3 Sprachentwicklung und soziales Umfeld
- 1.5 Die zweisprachige Entwicklung
- 1.5.1 Lernersprache
- 1.5.2 Strategien zweisprachiger Entwicklung
- 1.5.3 Unterschiede zum monolingualen Spracherwerb
- 1.6 Zusammenfassung Kapitel 1
- 2 Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten – Mehrsprachigkeit, situationsorientierte Sprachförderung & interkulturelle Aspekte
- 2.1 Gesellschaftliche Aspekte von Mehrsprachigkeit
- 2.1.1 Migration und Mehrsprachigkeit in Deutschland seit den 1960er Jahren
- 2.1.2 Gesellschaftliche Einstellungen zur Mehrsprachigkeit
- 2.2 Mehrsprachigkeit in der Kindertagesstätte
- 2.2.1 Die Kindertagesstätte als frühkindliche Bildungsinstitution
- 2.2.2 Bedeutung der Erstsprache in der Kindertagesstätte – emotionale, intellektuelle und kommunikative Aspekte
- 2.2.3 Situationsorientierte Aspekte von Sprachförderung
- 2.2.4 Vom Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Kindertagesstätte
- 2.3 Interkulturelle Erziehung und Bildung – Umgang mit kultureller Vielfalt
- 2.3.1 Begriffsdefinition „Kultur“
- 2.3.2 Interkulturelle Aspekte in der Kindertagesstätte
- 2.3.3 Interkulturelle Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte
- 2.4 Zusammenfassung Kapitel 2
- 3 Sprachstandsverfahren und Sprachförderprogramme
- 3.1 Sprachstandsverfahren
- 3.1.1 Anforderungen an Sprachstandsverfahren
- 3.1.2 Verfahren zum Sprachstand – „Fit in Deutsch“ & „SISMIK“
- 3.1.3 Bewertung der Verfahren – testen vs. beobachten
- 3.2 Sprachförderprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund
- 3.2.1 Anforderungen an Sprachförderprogramme
- 3.2.2 „Rucksack“
- 3.2.3 „KIKUS“ – Sprachförderung Deutsch & Erstsprachen im Vor- und Grundschulalter
- 3.2.4 „kon-lab“ — Neue Wege der sprachlichen Frühförderung von Migrantenkindern
- 3.2.5 Vergleich der Sprachförderprogramme – linguistischer vs. sozial-kommunikativer Schwerpunkt
- 3.2.6 Bedingungen und Empfehlungen für eine wirksame Sprachförderung
- 3.3 Zusammenfassung Kapitel 3
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Claudia Schacht befasst sich mit der Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten. Sie untersucht die linguistischen, sozialen und pädagogischen Aspekte dieser Thematik und betrachtet die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit in diesem Kontext. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Spracherwerbstheorien, die Bedeutung der Erstsprache und die Entwicklung von Sprachförderprogrammen. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen Einstellungen zur Mehrsprachigkeit, die Rolle der Kindertagesstätte als Bildungsinstitution und die Bedeutung interkultureller Kompetenz für pädagogische Fachkräfte.
- Spracherwerb bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Mehrsprachigkeit und Spracherwerbstypen
- Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Interkulturelle Erziehung und Bildung
- Sprachstandsverfahren und Sprachförderprogramme
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Spracherwerbs, definiert wichtige Begriffe wie „Migrationshintergrund“, „Mehrsprachigkeit“ und „Spracherwerbstypen“ und beleuchtet Erkenntnisse der Hirnforschung zum Spracherwerb. Außerdem werden verschiedene Spracherwerbstheorien vorgestellt und die Phasen des Spracherwerbs bei Kindern mit Migrationshintergrund beschrieben.
Kapitel zwei analysiert die gesellschaftlichen Aspekte von Mehrsprachigkeit, insbesondere in Deutschland, und beleuchtet die Rolle der Kindertagesstätte als frühkindliche Bildungsinstitution. Es werden die Bedeutung der Erstsprache in der Kindertagesstätte sowie situationsorientierte Aspekte der Sprachförderung betrachtet. Darüber hinaus wird die interkulturelle Erziehung und Bildung im Kontext der Kindertagesstätte untersucht, und die Bedeutung interkultureller Kompetenz für pädagogische Fachkräfte hervorgehoben.
Kapitel drei behandelt verschiedene Sprachstandsverfahren und Sprachförderprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund. Es werden Anforderungen an diese Verfahren und Programme erläutert, und ausgewählte Verfahren und Programme wie „Fit in Deutsch“ und „KIKUS“ werden detailliert vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit behandelt zentrale Themen wie Sprachförderung, Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund, Kindertagesstätten, interkulturelle Erziehung und Bildung, Sprachstandsverfahren, Sprachförderprogramme, Erstsprache, Zweitsprache und interkulturelle Kompetenz. Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Forschungsfelder und Konzepte, die mit der Sprachentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund zusammenhängen.
- Quote paper
- Claudia Schacht (Author), 2009, Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten. Linguistische, soziale und pädagogische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369298