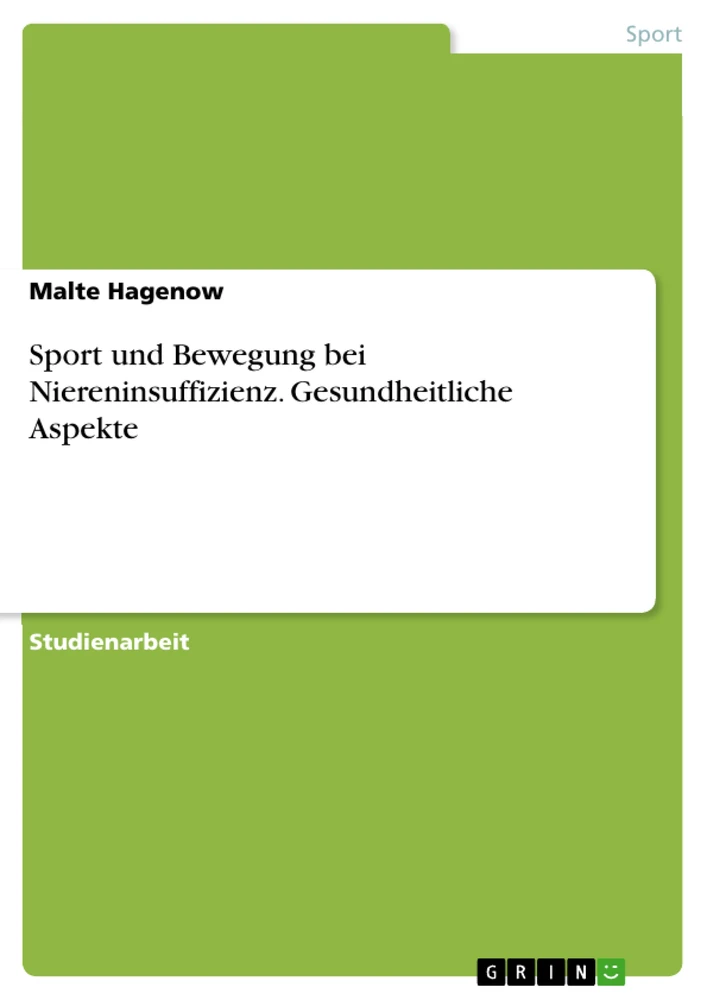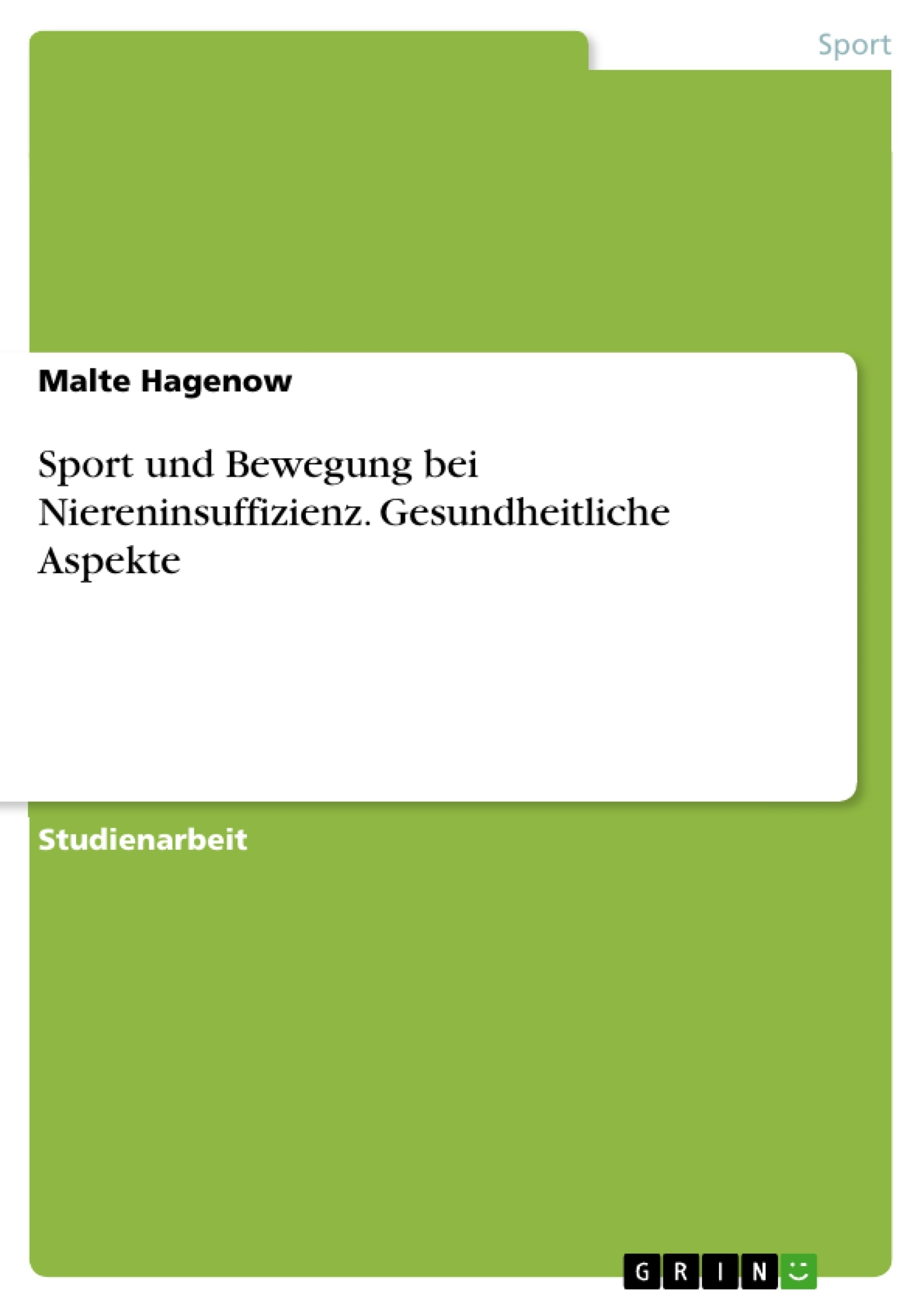Im Rahmen dieser Seminararbeit sollen Sport und Bewegung bei Vorliegen einer Niereninsuffizienz dargestellt werden. Leitfrage dieser Arbeit ist, ob und in welchem Umfang Sport und Bewegung für Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz von Bedeutung sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Ziele respektive Konsequenzen sich daraus ergeben.
Die Seminararbeit wird in zwei wesentliche Teile untergliedert. Im ersten Abschnitt wird eine Abgrenzung des Begriffs der Niereninsuffizienz vorgenommen, um im Folgenden näher auf die chronische Niereninsuffizienz einzugehen. Anschließend werden die verschiedenen Stadien einer chronischen Niereninsuffizienz dargestellt. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine vertiefende Betrachtung, welche Relevanz Sport und Bewegung im Krankheitsbild einer chronischen Niereninsuffizienz zuzuordnen sind. In Ergänzung dazu werden die medizinischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Sport und Bewegung dargestellt sowie erläutert, mit und in welcher Intensität sich die Patienten körperlich betätigen können. Abschließend erfolgt eine kurze Darstellung sportpraktischer Konsequenzen, aufgezeigt am Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Niereninsuffizienz
- 2.1 Begriffliche Abgrenzung - Niereninsuffizienz
- 2.2 Chronische Niereninsuffizienz
- 2.3 Stadien der chronischen Niereninsuffizienz
- 2.3.1 Stadium der vollen Kompensation (Nierenfunktionseinschränkung)
- 2.3.2 Stadium der kompensierten Retention (Azotämie)
- 2.3.3 Stadium der dekompensierten Retention (Präurämie)
- 2.3.4 Terminalstadium (Urämie)
- 3 Sport und Bewegung im Krankheitsbild der Niereninsuffizienz
- 3.1 Relevanz körperlicher Leistungsfähigkeit bei chronischer Niereninsuffizienz
- 3.2 Medizinische Voraussetzungen für die Teilnahme an Sport und Bewegung
- 3.3 Anzustrebende Belastungsintensität
- 3.4 Zielsetzung der Sport- und Bewegungstherapie
- 3.4 Konsequenzen für die Sportpraxis am Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Sport und Bewegung auf Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz. Die zentrale Frage ist, inwieweit Sport und Bewegung bei dieser Erkrankung förderlich sind, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und welche Ziele und Konsequenzen sich daraus ergeben.
- Definition und Abgrenzung der Niereninsuffizienz, insbesondere der chronischen Form.
- Die Stadien der chronischen Niereninsuffizienz und deren charakteristische Merkmale.
- Die Bedeutung körperlicher Leistungsfähigkeit bei chronischer Niereninsuffizienz.
- Medizinische Voraussetzungen und optimale Belastungsintensität für Sport und Bewegung bei Niereninsuffizienz.
- Konsequenzen für die sportpraktische Umsetzung, am Beispiel kardiovaskulärer Erkrankungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sport und Bewegung bei Niereninsuffizienz ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Inwieweit ist Sport und Bewegung bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz von Bedeutung, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Ziele und Konsequenzen ergeben sich daraus? Die Einleitung betont den multifaktoriellen Charakter der Niereninsuffizienz und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der körperlichen Leistungsfähigkeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der in zwei Hauptabschnitte gegliedert ist: die Abgrenzung des Begriffs Niereninsuffizienz und die detaillierte Betrachtung der Relevanz von Sport und Bewegung im Krankheitsbild.
2 Niereninsuffizienz: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Abgrenzung des Begriffs Niereninsuffizienz und konzentriert sich auf die chronische Niereninsuffizienz (CKD). Es differenziert zwischen akuter und chronischer Niereninsuffizienz, wobei der Fokus auf der CKD liegt, da diese den Hauptteil der Arbeit ausmacht. Die Definition und die verschiedenen Stadien der CKD werden detailliert erläutert, von der vollen Kompensation bis zum terminalen Stadium (Urämie). Der irreversible Verlust der Nierenfunktion und der langsame Fortschreiten der Zerstörung des Nierengewebes werden als zentrale Merkmale hervorgehoben. Jedes Stadium wird im Kontext der Nierenfunktion und der Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Blut beschrieben.
3 Sport und Bewegung im Krankheitsbild der Niereninsuffizienz: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Fragestellung der Arbeit, der Relevanz von Sport und Bewegung bei CKD. Es beleuchtet die Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei CKD und die medizinischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Sport und Bewegung. Die Bestimmung der anzustrebenden Belastungsintensität wird diskutiert, und die Zielsetzung der Sport- und Bewegungstherapie wird definiert. Abschließend werden die Konsequenzen für die Sportpraxis anhand des Beispiels einer kardiovaskulären Erkrankung dargestellt, um die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung des Trainingsplans hervorzuheben. Der Zusammenhang zwischen Präventionsmaßnahmen, wie einer verbesserten Blutdruckeinstellung und Sport, wird ebenfalls erläutert.
Schlüsselwörter
Chronische Niereninsuffizienz, Sport, Bewegung, körperliche Leistungsfähigkeit, medizinische Voraussetzungen, Belastungsintensität, Sporttherapie, Prävention, kardiovaskuläre Erkrankungen, Nierenfunktion, Stadien der CKD, Azotämie, Urämie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit: Sport und Bewegung bei chronischer Niereninsuffizienz
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss von Sport und Bewegung auf Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CKD). Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Sport und Bewegung bei dieser Erkrankung förderlich sind, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und welche Ziele und Konsequenzen sich daraus ergeben.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung der Niereninsuffizienz, insbesondere der chronischen Form. Sie beschreibt die Stadien der chronischen Niereninsuffizienz und deren charakteristische Merkmale. Weiterhin wird die Bedeutung körperlicher Leistungsfähigkeit bei CKD, die medizinischen Voraussetzungen und die optimale Belastungsintensität für Sport und Bewegung bei Niereninsuffizienz beleuchtet. Schließlich werden Konsequenzen für die sportpraktische Umsetzung, am Beispiel kardiovaskulärer Erkrankungen, dargestellt.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Niereninsuffizienz, ein Kapitel zu Sport und Bewegung bei Niereninsuffizienz und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage. Das Kapitel zur Niereninsuffizienz beschreibt die verschiedenen Stadien der CKD detailliert. Das Kapitel zu Sport und Bewegung behandelt die Relevanz körperlicher Aktivität, medizinische Voraussetzungen, Belastungsintensität und Konsequenzen für die Sportpraxis, insbesondere bei kardiovaskulären Erkrankungen.
Welche Stadien der chronischen Niereninsuffizienz werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Stadien der chronischen Niereninsuffizienz von der vollen Kompensation (Nierenfunktionseinschränkung) über die kompensierte Retention (Azotämie) und die dekompensierte Retention (Präurämie) bis zum terminalen Stadium (Urämie).
Welche Bedeutung hat die körperliche Leistungsfähigkeit bei chronischer Niereninsuffizienz?
Die Arbeit betont die Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei CKD und untersucht die medizinischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Sport und Bewegung. Sie diskutiert die Bestimmung der anzustrebenden Belastungsintensität und definiert die Zielsetzung der Sport- und Bewegungstherapie.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Erkenntnissen der Seminararbeit für die Sportpraxis?
Die Arbeit zeigt die Konsequenzen für die Sportpraxis am Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung auf und hebt die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung des Trainingsplans hervor. Der Zusammenhang zwischen Präventionsmaßnahmen, wie einer verbesserten Blutdruckeinstellung und Sport, wird ebenfalls erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Chronische Niereninsuffizienz, Sport, Bewegung, körperliche Leistungsfähigkeit, medizinische Voraussetzungen, Belastungsintensität, Sporttherapie, Prävention, kardiovaskuläre Erkrankungen, Nierenfunktion, Stadien der CKD, Azotämie, Urämie.
- Quote paper
- Malte Hagenow (Author), 2017, Sport und Bewegung bei Niereninsuffizienz. Gesundheitliche Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369245