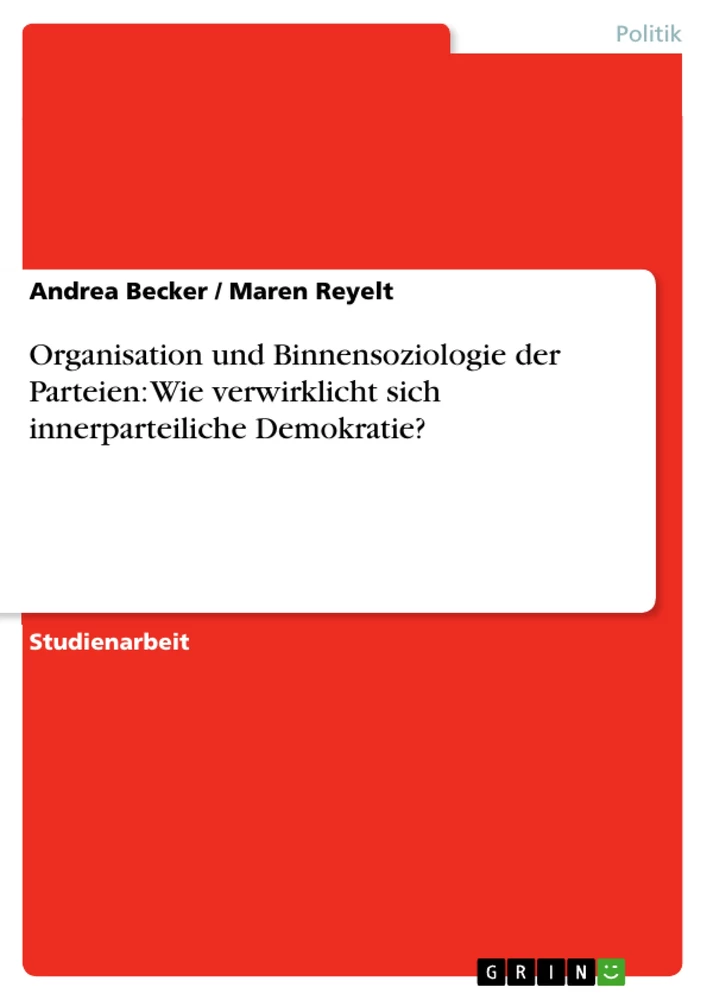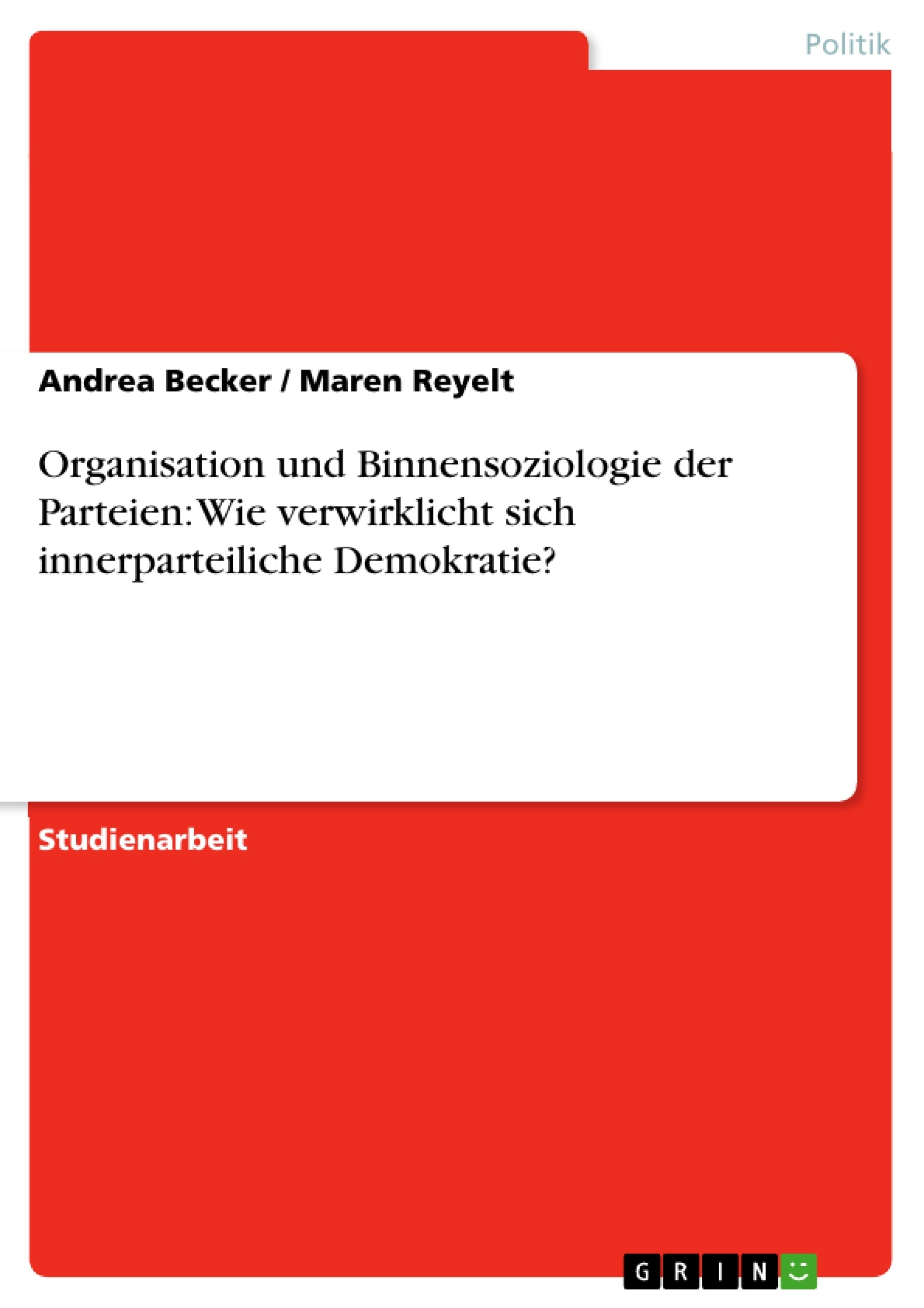Der verfassungsrechtliche Rahmen
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den wenigen Demokratien, in denen die Stellung der Parteien per Gesetz in der Verfassung verankert sind. Durch den Artikel 21 des Grundgesetzes und durch das Parteiengesetz werden Organisation und Funktion der Parteien verfassungsrechtlich abgesteckt. Sie stellen das wichtigste Bindeglied zwischen der Bevölkerung und den Organen staatlicher Willensbildung dar. Sie haben u.a. die Funktion der Interessenvertretung, denn sie erarbeiten zu den verschiedenen Interessen und Meinungen der Bevölkerung alternative Wahlprogramme, sie müssen regierungsfähige Mehrheiten bilden und politisches Personal zur Wahl stellen. Im Parteiengesetz wird weiterhin der hierarchische Aufbau der Parteien (die Gliederungen und Organe ) festgelegt. Außerdem muß die innere Ordnung der Parteien "demokratischen Grundsätzen" entsprechen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Organisation von Parteien
- 1. Der formale Aufbau
- 1.1 Der verfassungsrechtliche Rahmen
- 1.2 Die Organisationsebenen
- 1.3 Die Organe der einzelnen Parteigliederungen
- 1.3.1 Die Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung
- 1.3.2 Der Vorstand
- 1.3.3 Allgemeine Parteiausschüsse
- 1.3.4 Das Parteischiedsgericht
- 1.4 Die Wahlverfahren der Parteiorgane
- 1.5 Die Neben- oder Sonderorganisationen
- 1.6 Fazit
- 2. Die Parteiorganisationen und die deutsche Einigung
- II. Innerparteiliche Demokratie
- 3. Der Begriff innerparteiliche Demokratie - die Mitwirkung der Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes
- 4. Innerparteiliche Demokratie in der Praxis
- 4.1 Innerparteiliche Beteiligungsstruktur
- 4.2 Innerparteiliche Entscheidungsprozesse-Oligarchietendenz oder antizipierte Reaktion
- 4.3 Innerparteiliche Demokratie am Beispiel der SPD als „lose verkoppelte Anarchie
- 5. Repräsentation des Volkswillens - Kritik an der Parteiendemokratie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die innerparteiliche Demokratie in deutschen Parteien. Sie beleuchtet den formalen Aufbau von Parteien, ihre Organisationsebenen und Organe, und analysiert, wie sich innerparteiliche Demokratie in der Praxis verwirklicht. Die Arbeit befasst sich kritisch mit dem Spannungsfeld zwischen den formalen Strukturen und der tatsächlichen Machtverteilung innerhalb der Parteien.
- Der formale Aufbau deutscher Parteien
- Die verschiedenen Organisationsebenen und ihre Interaktion
- Die Rolle der Parteiorgane in Entscheidungsprozessen
- Der Begriff und die Praxis innerparteilicher Demokratie
- Kritik an der Parteiendemokratie und die Repräsentation des Volkswillens
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Organisation von Parteien: Dieses Kapitel beschreibt den formalen Aufbau deutscher Parteien, beginnend mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen, der die Stellung der Parteien im Grundgesetz und im Parteiengesetz verankert. Es erläutert die verschiedenen Organisationsebenen (Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverbände, Bundesverband) und ihre jeweiligen Organe (Mitgliederversammlungen, Vorstand, Parteiausschüsse, Parteischiedsgericht). Der Fokus liegt auf der hierarchischen Struktur, der (relativen) Unabhängigkeit der einzelnen Gliederungen und den formalen Regeln der Entscheidungsfindung. Die Unterschiede im Aufbau zwischen den verschiedenen Parteien (SPD, CDU, PDS) werden ebenfalls hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Parteiorganisationen für die Vermittlung zwischen Bevölkerung und Staat und die Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit der Regierungsbildung und der Interessenvertretung ergeben.
II. Innerparteiliche Demokratie: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der innerparteilichen Demokratie und ihre praktische Umsetzung. Es analysiert die Beteiligungsstrukturen innerhalb der Parteien, die Entscheidungsprozesse und mögliche Tendenzen zur Oligarchie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der SPD als Beispiel für eine "lose gekoppelte Anarchie", um die Herausforderungen und Widersprüche der innerparteilichen Demokratie aufzuzeigen. Kritische Auseinandersetzung mit der Frage der Repräsentation des Volkswillens und der Legitimität der Parteiendemokratie im Kontext der erörterten Aspekte runden das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Innerparteiliche Demokratie, Parteiorganisation, Parteiengesetz, Grundgesetz, Parteistruktur, Entscheidungsprozesse, Repräsentation, Oligarchie, SPD, CDU, PDS, deutsche Einigung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit "Innerparteiliche Demokratie in deutschen Parteien"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die innerparteiliche Demokratie in deutschen Parteien. Sie analysiert den formalen Aufbau von Parteien, ihre Organisationsebenen und Organe und beleuchtet, wie sich innerparteiliche Demokratie in der Praxis verwirklicht. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Spannungsfeld zwischen formalen Strukturen und tatsächlicher Machtverteilung.
Welche Aspekte der Parteiorganisation werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den formalen Aufbau deutscher Parteien, beginnend mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen (Grundgesetz, Parteiengesetz). Sie beschreibt die verschiedenen Organisationsebenen (Ortsverbände bis Bundesverband) und deren Organe (Mitgliederversammlungen, Vorstand, Parteiausschüsse, Parteischiedsgericht). Die hierarchische Struktur, die (relative) Unabhängigkeit der Gliederungen und die formalen Entscheidungsregeln werden erläutert. Auch Unterschiede im Aufbau verschiedener Parteien (SPD, CDU, PDS) werden betrachtet.
Wie wird innerparteiliche Demokratie definiert und untersucht?
Die Arbeit analysiert den Begriff der innerparteilichen Demokratie und ihre praktische Umsetzung. Sie untersucht Beteiligungsstrukturen, Entscheidungsprozesse und mögliche Oligarchietendenzen. Die SPD dient als Beispiel für eine "lose gekoppelte Anarchie", um die Herausforderungen und Widersprüche der innerparteilichen Demokratie zu veranschaulichen. Die Repräsentation des Volkswillens und die Legitimität der Parteiendemokratie werden kritisch diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus zwei Hauptkapiteln: Kapitel I "Die Organisation von Parteien" beschreibt den formalen Aufbau, die Organisationsebenen und Organe deutscher Parteien. Kapitel II "Innerparteiliche Demokratie" untersucht den Begriff und die Praxis innerparteilicher Demokratie, analysiert Beteiligungsstrukturen und Entscheidungsprozesse und diskutiert kritisch die Repräsentation des Volkswillens.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Innerparteiliche Demokratie, Parteiorganisation, Parteiengesetz, Grundgesetz, Parteistruktur, Entscheidungsprozesse, Repräsentation, Oligarchie, SPD, CDU, PDS, deutsche Einigung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die innerparteiliche Demokratie in deutschen Parteien, beleuchtet deren formalen Aufbau und analysiert die praktische Umsetzung innerparteilicher Demokratie. Sie befasst sich kritisch mit dem Spannungsfeld zwischen formalen Strukturen und tatsächlicher Machtverteilung.
- Arbeit zitieren
- Andrea Becker (Autor:in), Maren Reyelt (Autor:in), 1998, Organisation und Binnensoziologie der Parteien: Wie verwirklicht sich innerparteiliche Demokratie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3692