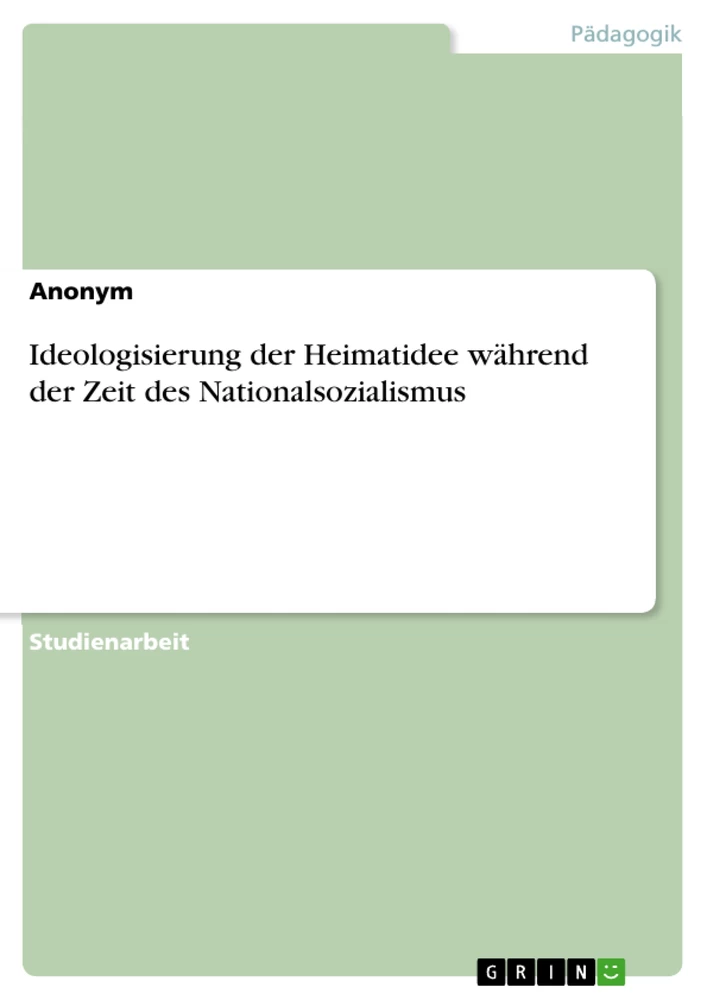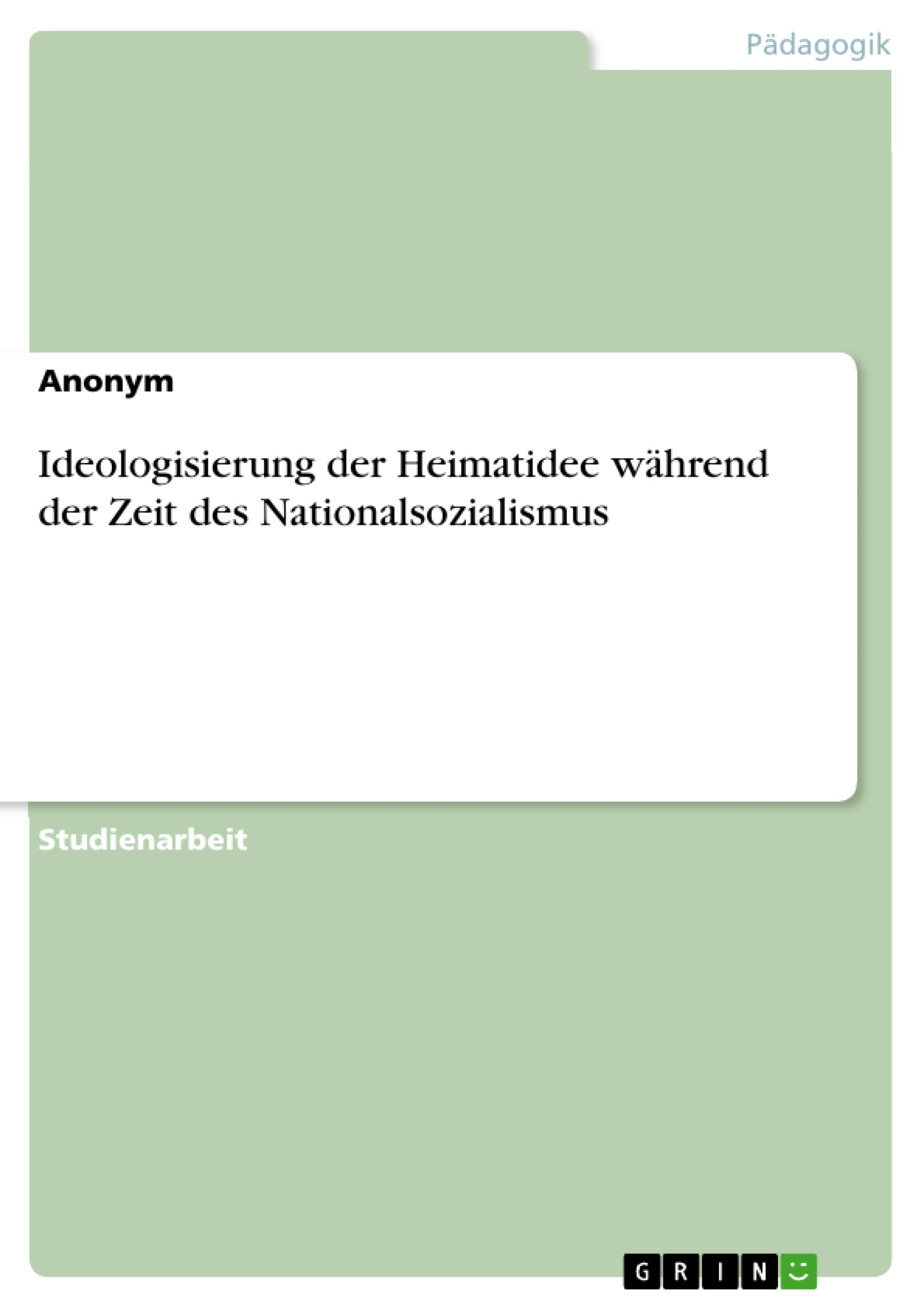Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Ideologisierung der Heimatidee während der Zeit des Nationalsozialismus. Es wird zu Anfang auf den heimatkundlichen Unterricht der Weimarer Republik eingegangen, der die Grundlage für die Entwicklungen im Dritten Reich bildet. Daran schließt die nationalistische Heimatkunde an, welche zuerst in curricularen Einzelmaßnahmen, später in den Reichsrichtlinien der Volksschulunterstufe ideologisieret wird. Außerdem wird auf die Kontinuitäten und Diskontinuitäten des heimatlichen Unterrichts zwischen den 1920er Jahren und der Zeit des Nationalsozialismus eingegangen und Kritik an der Ideologieanfälligkeit des Faches geübt.
Heimatkunde wörtlich meint zuerst einmal die reflektierte Kenntnis über den kindlichen Nahraum. Grundsätzlich ist dieser Begriff wertneutral gehalten. Betrachtet man die Historie der Heimat- und Sachkunde, ist bemerkenswert, welch unterschiedliche Strömungen dieses Unterrichtsfach bereits durchlief. Zwischen Kindorientiertheit und Wissenschaftlichkeit fällt außerdem die Ideologieanfälligkeit des Sachfachs auf, besonders während der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch in der Weimarer Republik. Nicht immer stand lediglich die Sache im Mittelpunkt, sondern im Dritten Reich vielmehr der Transport nationalistischer Werte und Weltanschauungen an die Jüngsten unserer Gesellschaft, zusammengefasst unter dem Begriff „pervertierte Heimatkunde“ (Feige 2007).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Ideologisierung in der Weimarer Republik
- Die nationalistische Ideologie nach 1933
- Ideologisierung der Heimatkunde in curricularen Einzelmaßnahmen
- Ideologisierung der Heimatkunde in den Richtlinien der Volksschulunterstufe
- Kennzeichen der Heimatkunde vor dem Hintergrund der ideologischen Anfälligkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ideologisierung der Heimatkunde während des Nationalsozialismus. Sie analysiert die Entwicklungen in der Weimarer Republik als Grundlage für die späteren nationalistischen Tendenzen im Unterricht. Die Arbeit beleuchtet die Umsetzung der Ideologie in curricularen Maßnahmen und Richtlinien, sowie Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen den 1920er Jahren und der NS-Zeit. Kritisch wird die Anfälligkeit des Faches Heimatkunde für ideologische Instrumentalisierung betrachtet.
- Heimatkunde in der Weimarer Republik und ihre Vorläufer
- Einfluss des Nationalsozialismus auf den Heimatkunde-Unterricht
- Curriculare Veränderungen und ihre ideologischen Implikationen
- Vermittlung nationalistischer Werte und Weltanschauungen im Heimatkunde-Unterricht
- Kritik an der Ideologieanfälligkeit des Faches Heimatkunde
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff Heimatkunde als wertneutrale Reflexion des kindlichen Nahraums und hebt die ideologische Anfälligkeit des Faches, besonders während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Ideologisierung der Heimatidee im Nationalsozialismus, beginnend mit der Weimarer Republik als Grundlage, und analysiert die Umsetzung der Ideologie in curricularen Maßnahmen und Richtlinien. Kritisiert wird die instrumentalisierte Verwendung des Faches zur Vermittlung nationalistischer Werte.
Grundlagen der Ideologisierung in der Weimarer Republik: Dieses Kapitel beschreibt den Heimatkunde-Unterricht in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Es wird die Einführung der vierjährigen Grundschule 1920 und die Bedeutung der Heimat im Gesamtunterricht der Anfangsstufe hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Unterrichtsmethodik, welche kindliche Selbsttätigkeit und eigenaktiven Wissenserwerb betont. Trotz des pädagogischen Ansatzes werden bereits gefühlsbetonte und national gefärbte Tendenzen, insbesondere in den Formulierungen Eduard Sprangers zur emotionalen Verbundenheit mit der Heimat, analysiert und als Grundlage für die spätere nationalsozialistische Instrumentalisierung des Faches herausgestellt.
Die nationalistische Ideologie nach 1933: Nach der Machtübernahme 1933 durch die Nationalsozialisten unterordnete sich der Heimatkunde-Unterricht zunehmend den nationalsozialistischen Idealen. Die Heimat wird als bedeutender Lebensraum für Kinder dargestellt, wobei das Symbol der Wurzel die Heimatverbundenheit verdeutlicht. Der Bildungsauftrag wurde missbraucht, um nationalistische Ideale und Wertvorstellungen zu vermitteln, was als "Pervertierung der Heimatkunde" bezeichnet wird. Der geplante radikale Umbau fand in den Anfangsjahren nicht statt, stattdessen wurden curriculare Einzelmaßnahmen in speziellen Schulfächern eingeleitet.
Schlüsselwörter
Heimatkunde, Ideologisierung, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Nationalismus, Curricula, Richtlinien, Volksschulunterstufe, Rassenkunde, Personenkult, Pädagogik, Erziehung, Volksgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ideologisierung der Heimatkunde im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ideologisierung des Schulfaches Heimatkunde während des Nationalsozialismus. Sie analysiert die Entwicklungen in der Weimarer Republik als Grundlage für die späteren nationalistischen Tendenzen im Unterricht und beleuchtet die Umsetzung der Ideologie in curricularen Maßnahmen und Richtlinien. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anfälligkeit des Faches Heimatkunde für ideologische Instrumentalisierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Heimatkunde in der Weimarer Republik und ihre Vorläufer, den Einfluss des Nationalsozialismus auf den Heimatkunde-Unterricht, curriculare Veränderungen und deren ideologischen Implikationen, die Vermittlung nationalistischer Werte und Weltanschauungen im Heimatkunde-Unterricht sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Ideologieanfälligkeit des Faches.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den Begriff Heimatkunde definiert und die ideologische Anfälligkeit des Faches hervorhebt. Es folgt ein Kapitel zu den Grundlagen der Ideologisierung in der Weimarer Republik, ein Kapitel zur nationalistischen Ideologie nach 1933 mit Unterkapiteln zu curricularen Einzelmaßnahmen und Richtlinien der Volksschulunterstufe, ein Kapitel zu den Kennzeichen der Heimatkunde vor dem Hintergrund der ideologischen Anfälligkeit und schließlich ein Fazit. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der Weimarer Republik?
Das Kapitel zur Weimarer Republik beschreibt den Heimatkunde-Unterricht nach dem Ersten Weltkrieg, die Einführung der vierjährigen Grundschule 1920 und die Bedeutung der Heimat im Gesamtunterricht. Es analysiert bereits in der Weimarer Republik vorhandene gefühlsbetonte und national gefärbte Tendenzen, insbesondere in den Formulierungen Eduard Sprangers, als Grundlage für die spätere nationalsozialistische Instrumentalisierung des Faches.
Wie wurde die Heimatkunde nach 1933 ideologisiert?
Nach 1933 unterordnete sich der Heimatkunde-Unterricht den nationalsozialistischen Idealen. Die Heimat wurde als bedeutender Lebensraum dargestellt, und der Bildungsauftrag wurde missbraucht, um nationalistische Ideale und Wertvorstellungen zu vermitteln. Die Arbeit beschreibt dies als "Pervertierung der Heimatkunde". Anstatt eines radikalen Umbaus wurden zunächst curriculare Einzelmaßnahmen in speziellen Schulfächern eingeleitet.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Heimatkunde, Ideologisierung, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Nationalismus, Curricula, Richtlinien, Volksschulunterstufe, Rassenkunde, Personenkult, Pädagogik, Erziehung und Volksgemeinschaft.
Welche Kritikpunkte werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit kritisiert die instrumentalisierte Verwendung des Faches Heimatkunde zur Vermittlung nationalistischer Werte und die Anfälligkeit des Faches für ideologische Manipulation, sowohl in der Weimarer Republik als auch im Nationalsozialismus.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Ideologisierung der Heimatidee während der Zeit des Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369048