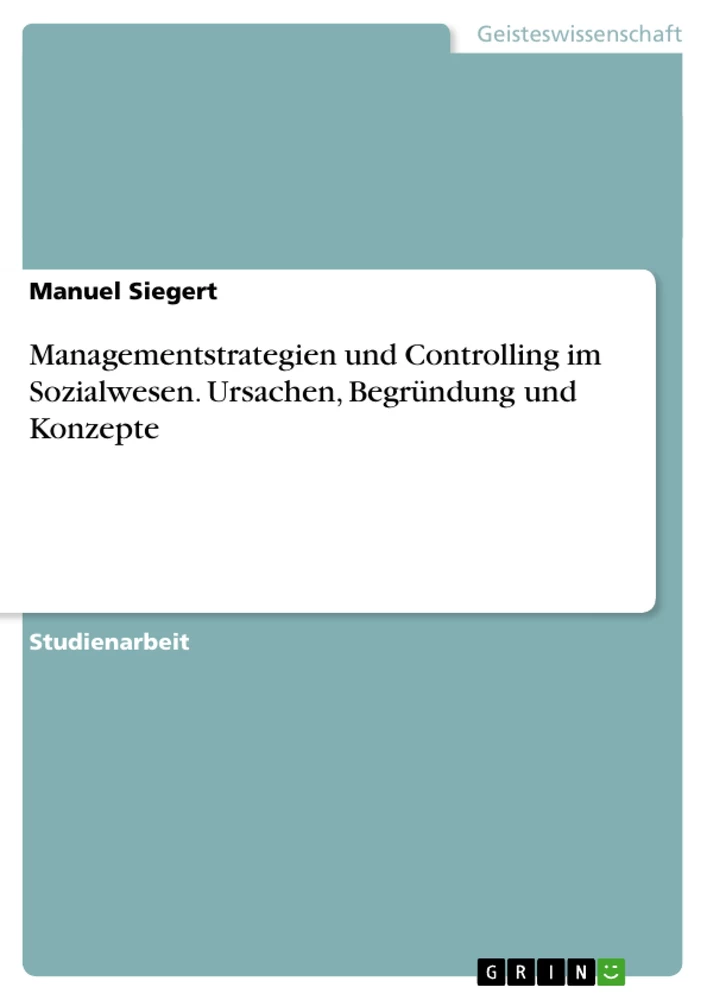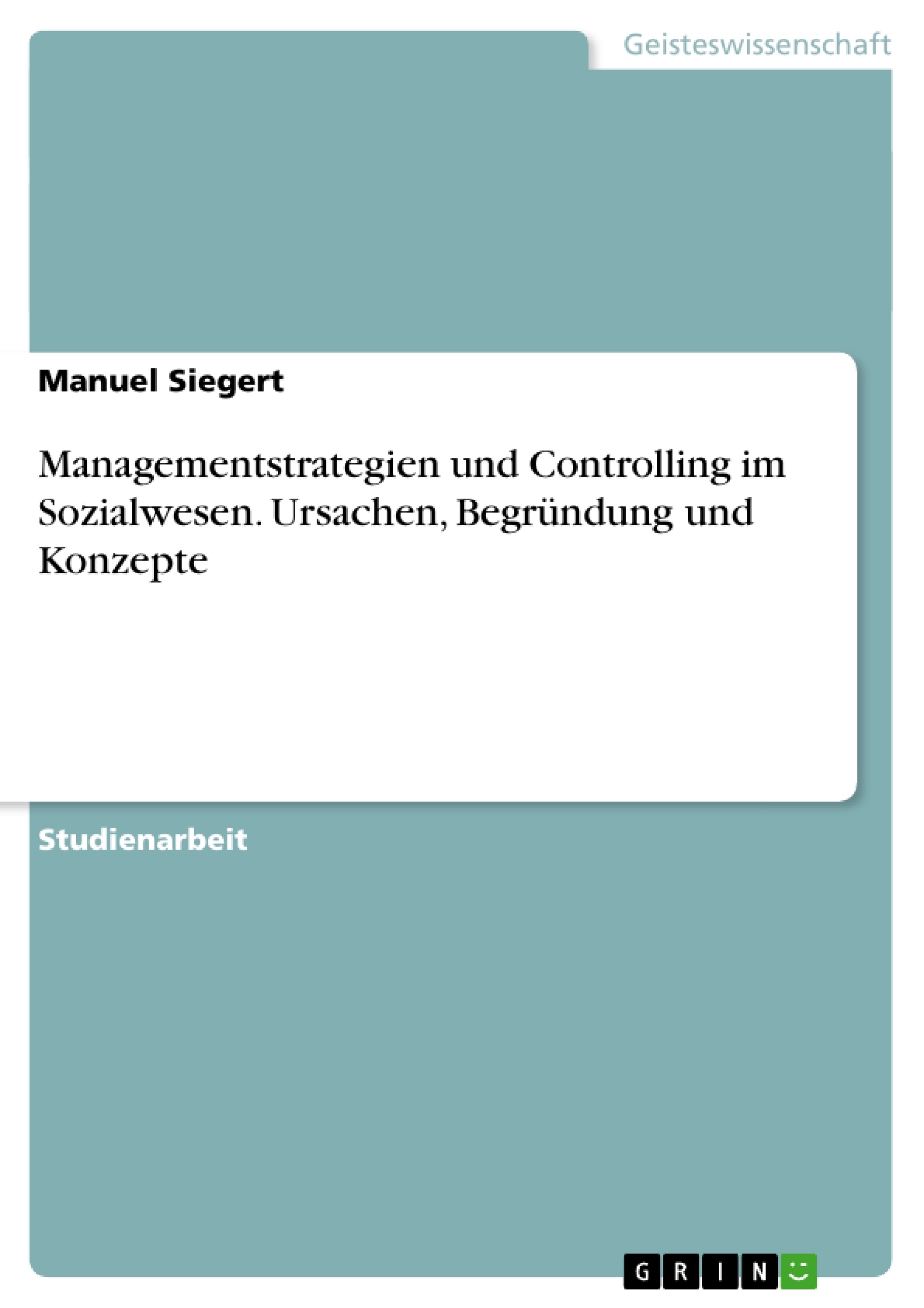Management und Controlling auf der einen Seite, Sozialwesen auf der anderen. Da scheint sich ein grundlegender Widerspruch aufzutun, der kaum lösbar scheint. Mit den ersten beiden Begriffen verbindet man ehe r Schlagworte wie Wirtschaftlichkeit, Profit und Effizienz. Also klar wirtschaftsbezogene Assoziationen. Den letzteren Begriff setzt man eher in eine Reihe mit z.B. Solidarität, Hilfe für Arme und Schwache, Selbstlosigkeit. Im alltäglichen Verständnis passen diese Begriffe nicht zusammen. Ja, sie bilden sogar zwei entgegengesetzte Pole. Deutlich wird diese Einschätzung in einem Zitat von Effinger: “Der kühle Manager, als die idealtypische Figur eines von ihm manipulierten Marktes, galt und gilt quasi als das personifizierte Gegenbild zum warm- und barmherzigen Sozialarbeiter. Unterschiedliche Sprache und Kleidung sowie die Schaffung und die Pflege von sich gegenseitig abwertenden Mythen signalisieren und symbolisieren bis heute die weite Kluft zwischen diesen gegensätzlichen Kulturen” (Effinger 1996, S.39). Es scheint also, als ob Sozialwesen und Wirtschaft nicht zusammenpassen würden und dass ein Lernen des einen vom anderen absolut ausgeschlossen wäre. Doch das Sozialwesen steht unter Druck. Auf der einen Seite werden die finanziellen Mittel immer weniger und auf der anderen bleibt aber die Zahl jener die Hilfe und Unterstützung benötigen gleich bzw. steigt. Dabei stellt sich die Frage, wie dieser Spagat gemeistert werden kann, ohne dass die Qualität der Leistungen abnimmt. Da auch in der Zukunft nicht mit wieder steigenden finanziellen Zuwendungen zu rechnen ist, muss das Sozialwesen die Lösung in den eigenen Reihen finden. Es gilt, die zur Verfügung stehenden Mittel effizienter einzusetzen. Effizienterer Einsatz der verfügbaren Mittel ist damit der Anknüpfungspunkt zur Wirtschaft, zu den Managementstrategien und dem Controlling. Denn in der Wirtschaft sah man sich von Anfang an vor die Herausforderung gestellt, aus einem gegebenen Input ein größtmöglichen Output zu schaffen. Was liegt da näher, als sich erfolgreiche Konzepte und Strategien anzueignen und auch im Sozialbereich anzuwenden. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich kurz die Ursachen die zur Einführung von Managementstrategien und Controlling führten und führen darlegen, diskutieren, ob eine Übernahme der Konzepte und Strategien überhaupt möglich und sinnvoll ist und natürlich die Begriffe erläutern sowie bereits bestehende Ansätze vorstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie kam es zu Managementstrategien im Sozialwesen?
- Argumente gegen eine Ökonomisierung der Sozialarbeit
- Argumente für die Einführung von Managementdenken in den Bereichen der Sozialen Arbeit
- Was heißt eigentlich Management?
- Die Besonderheiten des Sozialmanagement
- Was ist eigentlich Controlling?
- Controlling im Sozialwesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung von Managementstrategien und Controlling im Sozialwesen. Sie analysiert die Gründe für die Einführung dieser Konzepte, diskutiert die Vor- und Nachteile einer Ökonomisierung der Sozialarbeit und beleuchtet die Besonderheiten des Sozialmanagements und -controllings. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, ob und inwiefern die Übernahme von Managementkonzepten aus der Wirtschaft für den Sozialbereich sinnvoll und möglich ist.
- Ursachen für die Einführung von Managementstrategien im Sozialwesen
- Argumente für und gegen die Ökonomisierung der Sozialarbeit
- Bedeutung und Besonderheiten des Sozialmanagements und -controllings
- Mögliche Ansätze für die Implementierung von Managementkonzepten im Sozialwesen
- Bewertung der Auswirkungen von Managementstrategien auf die Qualität sozialer Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den grundlegenden Widerspruch zwischen Management und Sozialwesen heraus und skizziert die Notwendigkeit, angesichts knapper finanzieller Ressourcen, effizientere Methoden im Sozialbereich zu finden.
- Wie kam es zu Managementstrategien im Sozialwesen?: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen der 1970er Jahre, die zur Einführung von Managementstrategien führten, darunter steigende Sozialleistungsquoten, die Ölkrise und die zunehmende wirtschaftliche Krise. Es wird die Notwendigkeit von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen im Sozialbereich hervorgehoben.
- Argumente gegen eine Ökonomisierung der Sozialarbeit: In diesem Kapitel werden die kritischen Argumente gegen die Einführung von Managementdenken im Sozialwesen diskutiert. Es wird die Gefahr einer Kommerzialisierung und Instrumentalisierung der Sozialarbeit sowie die potenziellen Auswirkungen auf die Qualität der sozialen Leistungen beleuchtet.
- Argumente für die Einführung von Managementdenken in den Bereichen der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Argumenten, die für die Anwendung von Managementkonzepten im Sozialbereich sprechen. Es wird die Notwendigkeit einer effizienten Ressourcenallokation und einer Steigerung der Effektivität sozialer Arbeit betont.
- Was heißt eigentlich Management?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Management" und erläutert die Besonderheiten des Sozialmanagements. Es geht um die Anwendung von Managementprinzipien im Kontext der Sozialarbeit.
- Was ist eigentlich Controlling?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Controlling" und betrachtet dessen Einsatz im Sozialwesen. Es wird die Bedeutung von Controlling für die Steuerung und Kontrolle sozialer Prozesse und Leistungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Managementstrategien, Controlling, Sozialwesen, Ökonomisierung, Sozialarbeit, Effizienz, Privatisierung, Deregulierung, Kostensenkung, Leistungssteigerung, Sozialmanagement, Sozialcontrolling.
- Quote paper
- Manuel Siegert (Author), 2004, Managementstrategien und Controlling im Sozialwesen. Ursachen, Begründung und Konzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36895