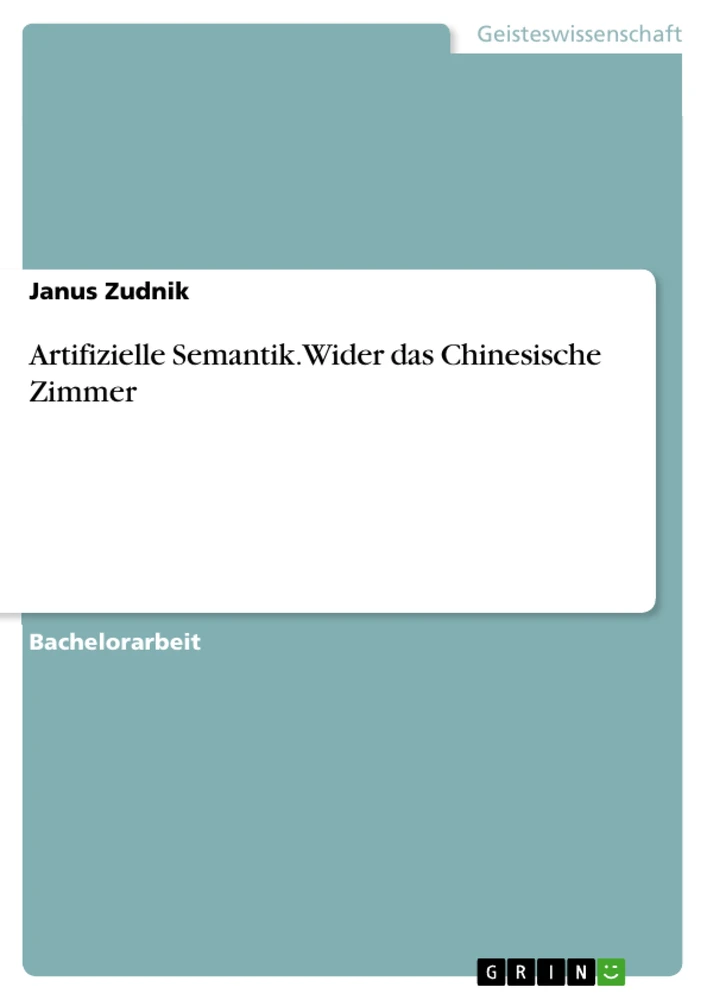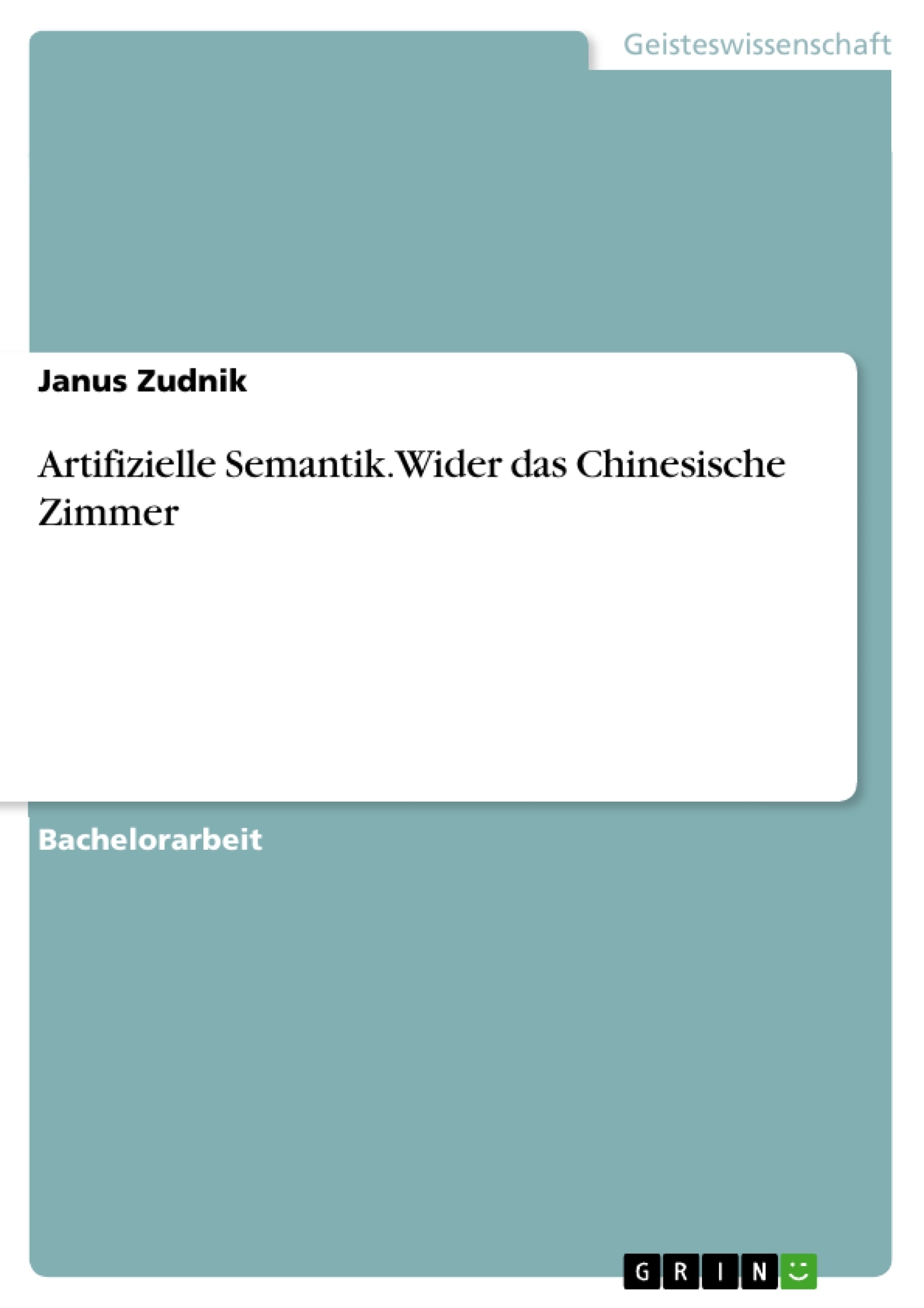"Talks at Google" hatte kürzlich einen Star zu Gast (Google 2016). Der gefeierte Philosoph referierte in gewohnt charmanter Art sein berühmtes Gedankenexperiment, welches er vor 35 Jahren ersonnen hatte. Aber es war keine reine Geschichtslektion, sondern er bestand darauf, daß die Implikationen nach wie vor Gültigkeit besaßen. Die Rede ist natürlich von John Searle und dem “Chinesischen Zimmer”. Searle eroberte damit ab 1980 die Welt der Philosophie des Geistes, indem er bewies, daß man Computer besprechen kann, ohne etwas von ihnen zu verstehen. In seinen Worten, man könne ohnehin die zugrunde liegenden Konzepte dieser “damned things” in “5 Minuten” erfassen. Dagegen verblassten die scheuen Einwände des AI-Starapologeten Ray Kurzweil der im Publikum saß, die jüngste Akquisition in Googles Talentpool. Searle wirkte wie die reine Verkörperung seiner Thesen, daß Berechnung, Logik und harte Fakten angesichts der vollen Entfaltung polyvalenter Sprachspiele eines menschlichen Bewußtseins im sozialen Raum der Kultur keine Macht über uns besitzen.
Doch obwohl große Uneinigkeit bezüglich der Gültigkeit des chinesischen Zimmers besteht, und die logische Struktur des Arguments schon vor Jahrzehnten widerlegt worden ist, u. a. von Copeland (1993), wird erstaunlicherweise noch immer damit gehandelt. Es hat sich von einem speziellen Werkzeug zur Widerlegung der “Starken AI These”, wonach künstliche Intelligenz mit einer symbolverarbeitenden Rechenmaschine geschaffen werden kann, zu einem Argument für all die Fälle entwickelt, in welchen sich Philosophen des Geistes mit unbequemen Fragen bezüglich der Berechenbarkeit des menschlichen Geistes auseinandersetzen hätten können. Es ist also mit den Jahrzehnten zu einer Immunisierungs- und Konservierungsstrategie für all jene geworden, die sich Zeit erkaufen wollten, sich mit der wirklichen Komplexität auseinander zu setzen. Denn die Definition von Sinn ist eben plastisch, vor allem wenn die Pointe der Searlschen Geschichte noch immer eine hohe Suggestionskraft besitzt, da ihre Konklusion, man könne nicht von einer computationalen Syntax zu einer Semantik kommen, noch immer unzureichend widerlegt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Teil I: Das Chinesisches Zimmer
- 2.1. Vorgeschichte
- 2.1.1. Welche Voraussetzungen führten dazu?
- 2.1.2. Searles Intuition
- 2.2. Searles Argumente
- 2.2.1. Syntax genügt nicht für Semantik
- 2.2.1.1. Linguistik
- 2.2.1.2. Wahrheitswerte Formaler Logik
- 2.2.2. Geist hat Inhalt
- 2.2.2.1. Die Rolle des Bewusstseins
- 2.2.2.2. Semantik muß intern sein
- 2.2.3. Programme sind rein syntaktisch
- 2.2.3.1. Symbolisch vs Subsymbolisch
- 2.2.3.2. Symbolic fallacy
- 2.2.4. Simulation und Virtuelle Maschinen
- 3. Teil II: Möglichkeiten artifizieller Semantik
- 3.1. Ceci n'est pas une Intelligence Artificielle
- 3.2. Symbolischer Ansatz
- 3.2.1. "Strong AI" und Kausalität
- 3.2.2. Fodor vs Konnektivismus
- 3.2.3. Kritik
- 3.3. Konnektivismus
- 3.3.1. Künstliche Neuronale Netzwerke
- 3.3.1.1. Aufbau
- 3.3.1.2. Arbeitsweise
- 3.3.1.3. Vom Thermostat zum Watt-Governor
- 3.3.1.4. Der Newton'sche Apfel
- 3.3.1.5. Interne Struktur
- 3.3.1.6. Generalisierung
- 3.3.1.7. Gegen das Implementationsargument
- 3.3.2. Repräsentation ohne Repräsentation
- 3.3.2.1. Mustererkennung
- 3.3.2.2. Modell für Gehirn
- 3.4. Semantik jetzt!
- 4. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeit künstlicher Semantik, insbesondere im Kontext von John Searles "Chinesischem Zimmer"-Gedankenexperiment. Ziel ist es, die Argumente Searles zu analysieren und alternative Ansätze, wie den Konnektivismus, zu bewerten. Die Arbeit hinterfragt die Gültigkeit des Arguments, dass computationale Syntax nicht zu Semantik führt.
- Analyse des "Chinesischen Zimmers" und seiner Implikationen für die KI-Forschung
- Bewertung symbolischer vs. subsymbolischer Ansätze zur Erzeugung von Semantik
- Untersuchung der Rolle des Bewusstseins und der Intentionalität bei der Bedeutungserzeugung
- Diskussion konnektivistischer Modelle und künstlicher neuronaler Netzwerke
- Exploration der Frage, ob Semantik künstlich hergestellt werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und präsentiert John Searles "Chinesisches Zimmer"-Gedankenexperiment als Ausgangspunkt der Diskussion. Sie beschreibt die anhaltende Relevanz des Experiments trotz bestehender Kritik und hebt die zentrale Frage nach der Möglichkeit künstlicher Semantik hervor. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Zielsetzung, die sich auf die Analyse der Argumente Searles und die Untersuchung alternativer Ansätze konzentriert. Die Einleitung betont die Bedeutung der Debatte zwischen symbolischen und konnektivistischen Ansätzen in der KI-Forschung.
2. Teil I: Das Chinesisches Zimmer: Dieser Teil analysiert detailliert Searles "Chinesisches Zimmer"-Argument. Er untersucht die Vorgeschichte des Experiments, Searles Intuition und seine zentralen Argumente gegen die "starke KI"-These. Die Analyse umfasst die Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik, die Rolle des Bewusstseins und die Kritik an rein symbolischen Ansätzen. Es werden verschiedene Aspekte wie die "Symbolic Fallacy" und die Grenzen von Simulationen beleuchtet. Der Abschnitt dient als fundierte Grundlage für die spätere Diskussion alternativer Ansätze zur Erzeugung künstlicher Semantik.
3. Teil II: Möglichkeiten artifizieller Semantik: Dieser Teil erörtert alternative Ansätze zur Erzeugung künstlicher Semantik, insbesondere den Konnektivismus und künstliche neuronale Netzwerke. Es wird ein kritischer Vergleich mit den symbolischen Ansätzen durchgeführt, wobei die Stärken und Schwächen beider Ansätze gegeneinander abgewogen werden. Die Arbeit beleuchtet die Funktionsweise neuronaler Netzwerke, ihre Fähigkeit zur Mustererkennung und Generalisierung und diskutiert, inwiefern diese Ansätze die Probleme des "Chinesischen Zimmers" umgehen können. Die Diskussion beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Implementationsargument und dem Konzept der Repräsentation ohne explizite symbolische Repräsentation.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, Chinesisches Zimmer, John Searle, Semantik, Syntax, Symbolischer Ansatz, Konnektivismus, Künstliche Neuronale Netzwerke, Bewusstsein, Intentionalität, Simulation, Starke KI-These, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Das Chinesische Zimmer und die Möglichkeit künstlicher Semantik
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeit künstlicher Semantik, insbesondere im Kontext von John Searles "Chinesischem Zimmer"-Gedankenexperiment. Sie analysiert Searles Argumente und bewertet alternative Ansätze wie den Konnektivismus.
Was ist das "Chinesische Zimmer"-Gedankenexperiment und welche Rolle spielt es in der Arbeit?
Das "Chinesische Zimmer" ist ein Gedankenexperiment von John Searle, das die Frage aufwirft, ob ein System, das syntaktische Regeln befolgt, auch Semantik (Bedeutung) verstehen kann. Die Arbeit analysiert detailliert Searles Argumente gegen die "starke KI"-These, die besagt, dass ein Computer mit dem richtigen Programm ein denkendes Wesen sein kann. Das Experiment dient als Ausgangspunkt der Diskussion über künstliche Semantik.
Welche zentralen Argumente von Searle werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht Searles Argumentation, dass Syntax allein nicht für Semantik ausreicht. Sie beleuchtet die Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik, die Rolle des Bewusstseins und der Intentionalität sowie die Kritik an rein symbolischen Ansätzen in der KI.
Welche alternativen Ansätze zur Erzeugung künstlicher Semantik werden diskutiert?
Die Arbeit erörtert den Konnektivismus und künstliche neuronale Netzwerke als alternative Ansätze zur symbolischen KI. Es wird ein Vergleich zwischen symbolischen und subsymbolischen Ansätzen durchgeführt, wobei die Stärken und Schwächen beider Ansätze bewertet werden.
Wie werden künstliche neuronale Netzwerke in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise künstlicher neuronaler Netzwerke, ihre Fähigkeit zur Mustererkennung und Generalisierung. Sie diskutiert, inwieweit diese Ansätze die Probleme des "Chinesischen Zimmers" umgehen können und setzt sich kritisch mit dem Implementationsargument auseinander.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Möglichkeit künstlicher Semantik und die Gültigkeit des Arguments, dass computationale Syntax nicht zu Semantik führt. Sie bewertet die unterschiedlichen Ansätze und diskutiert offene Fragen im Feld der KI-Forschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Künstliche Intelligenz, Chinesisches Zimmer, John Searle, Semantik, Syntax, Symbolischer Ansatz, Konnektivismus, Künstliche Neuronale Netzwerke, Bewusstsein, Intentionalität, Simulation, Starke KI-These, Repräsentation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Teil über das Chinesische Zimmer, einen Teil über alternative Ansätze zur künstlichen Semantik (insbesondere Konnektivismus) und eine Schlussfolgerung. Sie enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Künstliche Intelligenz, Philosophie des Geistes und die Debatte um die Möglichkeit künstlicher Semantik interessieren. Sie ist auf akademischem Niveau verfasst.
- Quote paper
- Janus Zudnik (Author), 2016, Artifizielle Semantik. Wider das Chinesische Zimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368389