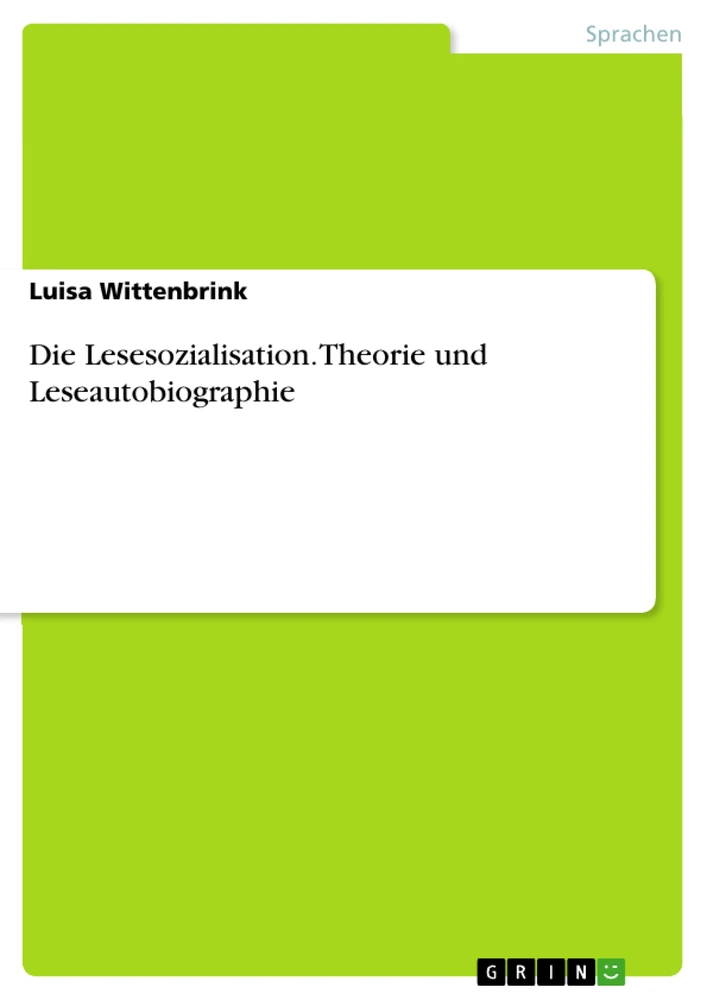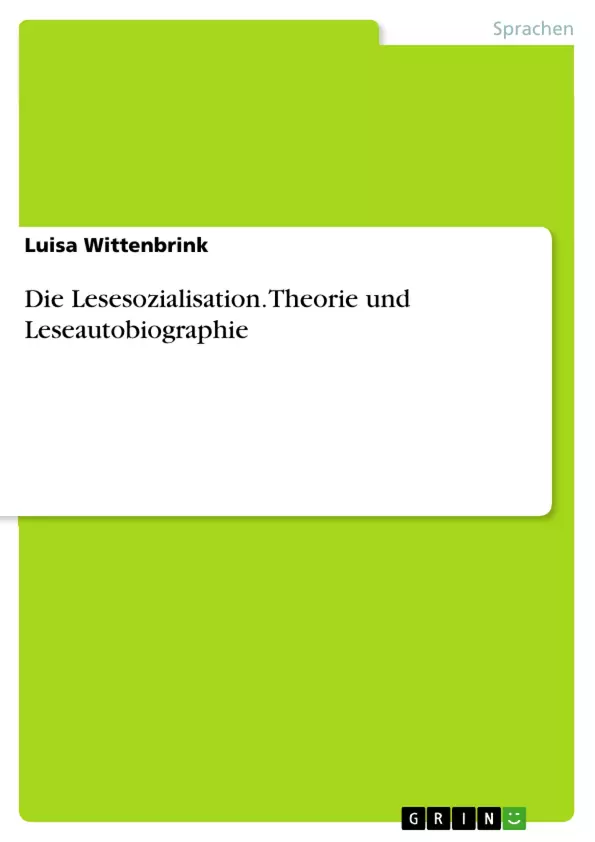In folgender Hausarbeit wird den Befunden der wissenschaftlichen Sozialisationsforschung der Individualfall einer Lesesozialisation gegenübergestellt. Der Individualfall bezieht sich dabei auf die Zeitspanne vom ersten bis zum 21. Lebensjahr der Autorin.
Lesesozialisation zeigt die Prozesse auf, die den Erwerb und die Praxis des Lesens bestimmen, sowie die möglichen Einflüsse auf die individuelle Motivation, Literatur zu rezipieren. Instanzen der Lesesozialisation stellen dabei Familie, Schule und der Freundeskreis einer Person dar, welche in den unterschiedlichen Lebensabschnitten unterschiedlich gewichtet auf die Praxis und Motivation des Lesens einwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die primäre literarische Initiation
- Die Alphabetisierung
- Die Phase lustvoller Kinderlektüre
- Die ,,Lesekrise“
- Die sekundäre literarische Initiation
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Lesesozialisation und der Bedeutung von literarischen Erfahrungen im Leben eines Individuums. Dabei wird die eigene Leseautobiografie analysiert und mit Befunden der wissenschaftlichen Sozialisationsforschung abgeglichen.
- Einfluss der Familie auf die Lesesozialisation
- Entwicklung der Lesekompetenz in verschiedenen Lebensphasen
- Die Rolle von Schule und Freundeskreis in der Lesesozialisation
- Die Bedeutung der Lesemotivation und deren Förderung
- Die Auswirkungen von außerschulischen und schulischen Einflüssen auf das Leseverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Lesesozialisationsforschung für angehende Lehrkräfte, insbesondere im Fach Deutsch. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die eigene Leseautobiografie zu reflektieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Lesesozialisation zu vergleichen.
Hauptteil: Die primäre literarische Initiation
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Familie als erste Instanz der Lesesozialisation. Es wird dargelegt, wie der Umgang mit Literatur von Eltern und Geschwistern auf das Kind übertragen wird und wie ein leseanregendes Umfeld die Entwicklung der Lesemotivation und -kompetenz unterstützt.
Hauptteil: Die Alphabetisierung
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Alphabetisierung in der Grundschule für die Lesesozialisation hervorgehoben. Es wird beleuchtet, wie das Erlernen von Buchstaben und Wörtern die Basis für die weitere Entwicklung der Lesekompetenz bildet. Der Einfluss von Lehrkräften und peers auf das Leseverhalten wird ebenfalls betrachtet.
Hauptteil: Die Phase lustvoller Kinderlektüre
Dieser Abschnitt analysiert die Phase der lustvollen Kinderlektüre und deren Einfluss auf die Lesesozialisation. Es wird gezeigt, wie das Kind in dieser Phase seine Lesemotivation weiterentwickelt und seinen eigenen Lesegeschmack entdeckt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lesesozialisation, Lesemotivation, literarische Initiation, Familie, Schule, Freundeskreis, Alphabetisierung, Kinderlektüre, Lesekrise, Sekundäre literarische Initiation.
- Quote paper
- Luisa Wittenbrink (Author), 2016, Die Lesesozialisation. Theorie und Leseautobiographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368339