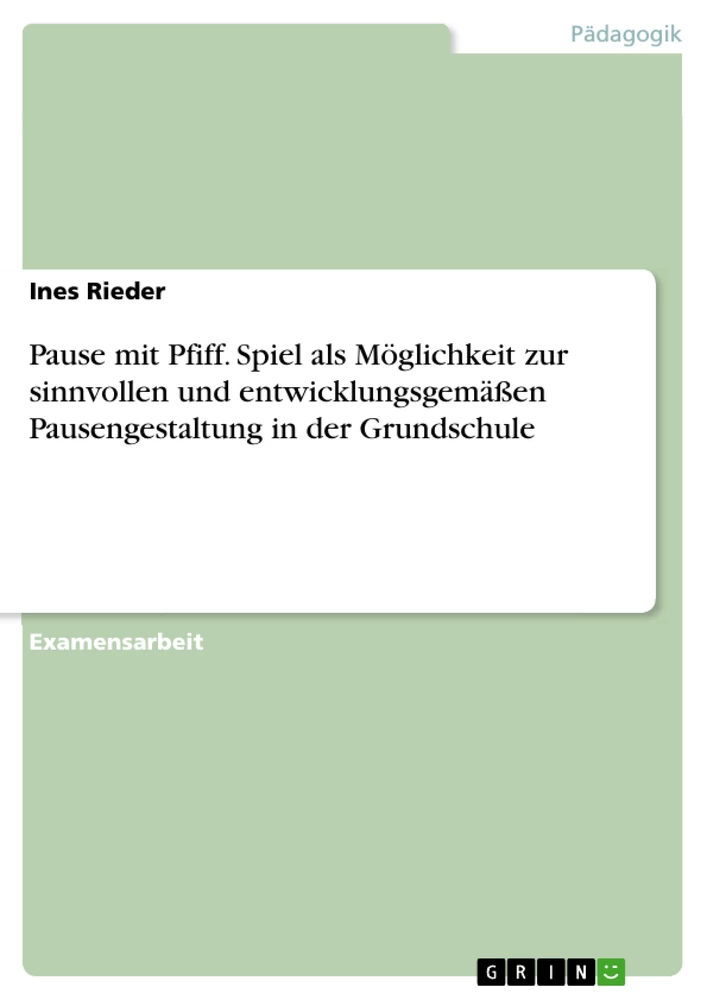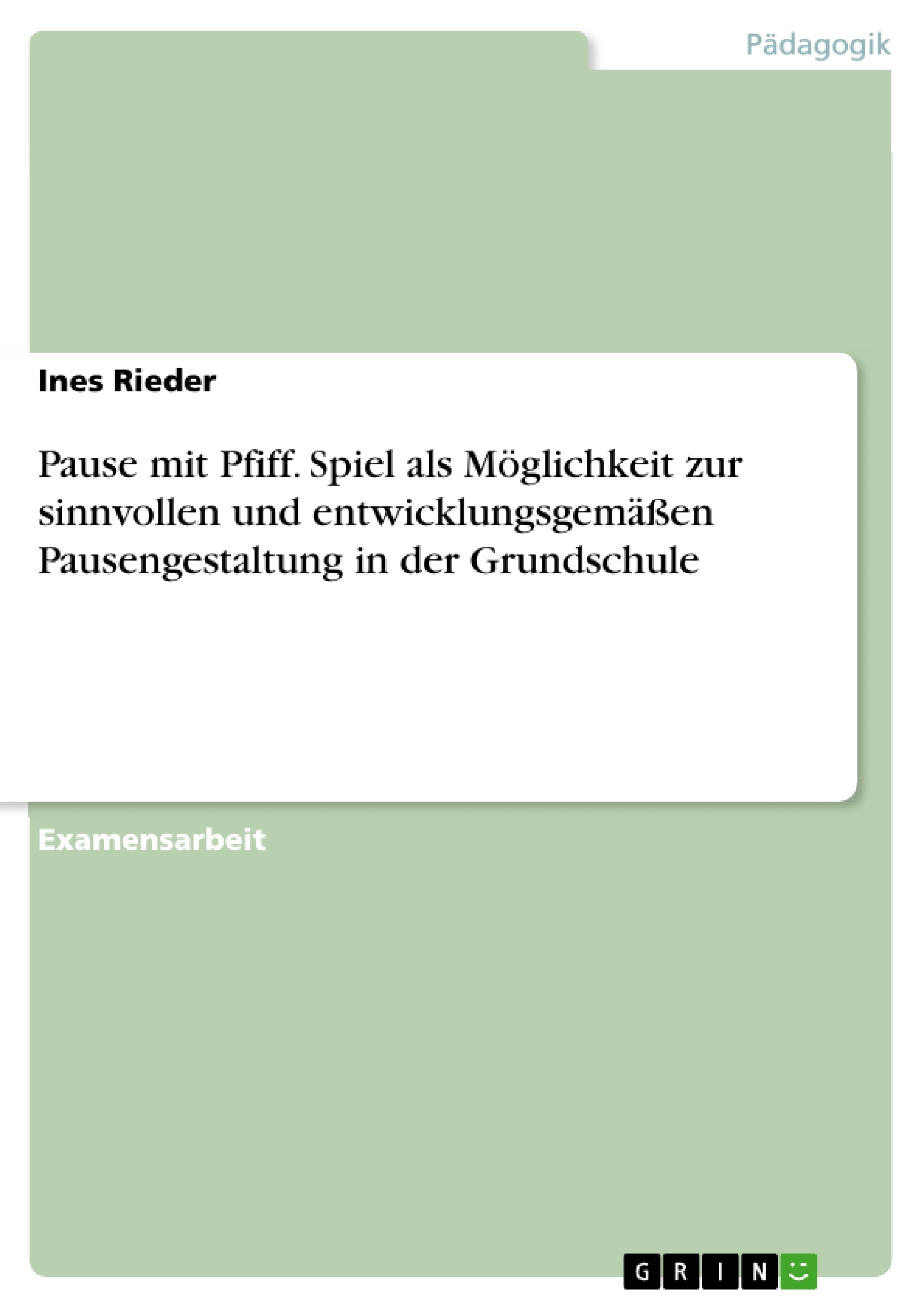Eine alltägliche Situation!? – Kinder kommen schreiend, unruhig, teilweise wütend und aufgebracht aus der Pause, rasen lautstark auf ihre Plätze, alles „niedermähend“, was sich ihnen in den Weg stellt und werden erst nach mehrmaligem Ermahnen des Lehrers einigermaßen ruhig, sodass der Unterricht wieder beginnen kann. Viele Lehrer und meine bisherigen Beobachtungen bestätigen mir das Geschilderte als durchaus „normal“, bzw. alltäglich. Aber liegt das Verhalten der Schüler tatsächlich an der Pause an sich, also an 20 bis 30 Minuten unterrichtsfreier Zeit? Dieser Frage will ich im Folgenden nachgehen und auch versuchen zu ergründen, ob es Möglichkeiten der Pausengestaltung gibt, die die oben beschriebene Situation der Vergangenheit angehören lassen bzw. wie solche Pausen aussehen könnten.
Von einigen Pausendefinitionen, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, scheint mir die Ferdinand Kopps eine sehr passende und umfassende zu sein; er definiert Pause wie folgt: „Die Pause soll in einem gesitteten Schulleben mehr sein als eine unvermeidliche Unterbrechung des Unterrichts. Oft wird übersehen, dass die Pausenzeit nach der reinen Unterrichtszeit den größten Zeitraum beansprucht, in dem die Kinder in den Schulen festgehalten werden, dass sie also viele Möglichkeiten zu erzieherischem Einfluss bietet. Denn nichts, was in der Schule geschieht, kann aus der Erziehung ausgeklammert werden. Die Schulpause ist zunächst vom Standpunkt der Schulorganisation aus zu beurteilen; die Pausenordnung kann nicht in das Belieben des einzelnen Lehrers gestellt werden. Zum andern ist die Schulpause im Blick auf Länge und Einordnung schulhygienisch richtig zu setzen. Während hier über Zeitdauer keine Einigkeit besteht schwanken die Angaben zwischen 25 und 75 Minuten), bleiben die allgemeinen Forderungen selbstverständlich: ungekürzte Gewährung einer Pause, vor allem keine Kürzung zur Strafe, Pause möglichst in frischer Luft, ruhiger Verzehr des Pausebrotes, kein unbeherrschtes Herumtollen."
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Pause
- Einleitung
- Definition
- Anforderungen an die Pause
- Zeitlicher Rahmen
- Organisation
- Pausenhofgestaltung
- Unfälle
- Das Spiel
- Definitionen
- Voraussetzungen und Bedingungen
- Interne Grundlagen
- Externe Bedingungen
- Spieltheorien
- Klassische Ansätze
- Modernere Theorien
- Psychologische Ansätze
- Phänomenologischer Ansatz
- Sozialisationstheoretischer Ansatz
- Materialistischer Ansatz
- Jean Piagets Spieltheorie
- Das Spiel in der Reformpädagogik
- Maria Montessori
- Rudolf Steiner
- Peter Petersen
- Grundschule und Spiel
- Entwicklungsphase Schulalter und Spiel
- Veränderte Kindheit
- Bewegung
- Pausenspiel
- Die Grundschule an der Bergmannstraße
- Daten
- Pause an der Bergmannschule
- Das Projekt „Pause mit Pfiff“
- Evaluation
- Schülerfragebögen
- Lehrerfragebögen
- Weitere Möglichkeiten und Ausblick
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Pause mit Pfiff - Spiel als Möglichkeit zur sinnvollen und entwicklungsgemäßen Pausengestaltung an der Grundschule“ analysiert die Bedeutung des Spiels für die Gestaltung der Pausen in der Grundschule. Die Autorin untersucht den Zusammenhang zwischen Spiel und kindlicher Entwicklung und setzt sich mit den Anforderungen und Herausforderungen einer kindgerechten Pausengestaltung auseinander.
- Die Rolle des Spiels im Lebensalltag von Grundschulkindern
- Die Bedeutung von Bewegung und Spiel für die kindliche Entwicklung
- Die Bedeutung der Pause als Lern- und Erfahrungsraum
- Die Gestaltung des Pausenhofs und die Organisation der Pause
- Die Förderung des Spiels und die Entwicklung von Spielmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Pause
- Kapitel 2: Das Spiel
- Kapitel 3: Die Grundschule an der Bergmannstraße
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Pause und erläutert die Anforderungen an die Gestaltung von Pausen in der Grundschule. Es werden insbesondere die Aspekte Zeitlicher Rahmen, Organisation und Pausenhofgestaltung beleuchtet. Des Weiteren wird die Problematik von Unfällen während der Pausen untersucht.
Kapitel 2 behandelt die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung. Es werden verschiedene Spieltheorien vorgestellt und die Rolle des Spiels in der Reformpädagogik betrachtet. Die Autorin beleuchtet die Entwicklungsphase des Schulalters und die veränderte Kindheit im Kontext der Spielkultur.
Das letzte Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Evaluation des Projekts "Pause mit Pfiff", welches an der Bergmann-Grundschule in München durchgeführt wurde. Es werden Daten, Erkenntnisse und Erfahrungen zur Gestaltung der Pausen und zur Bedeutung des Spiels in der Grundschule zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themenschwerpunkten Spiel, Pause, Grundschule, kindliche Entwicklung, Pausengestaltung, Pausenhofgestaltung, Bewegung und Spieltheorien. Die Autorin bezieht sich in ihrer Analyse auf die Bedeutung des Spiels für eine sinnvolle und entwicklungsgemäße Pausengestaltung und untersucht, wie das Spiel als Lern- und Erfahrungsraum in den Schulalltag integriert werden kann.
- Quote paper
- Ines Rieder (Author), 2005, Pause mit Pfiff. Spiel als Möglichkeit zur sinnvollen und entwicklungsgemäßen Pausengestaltung in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36796