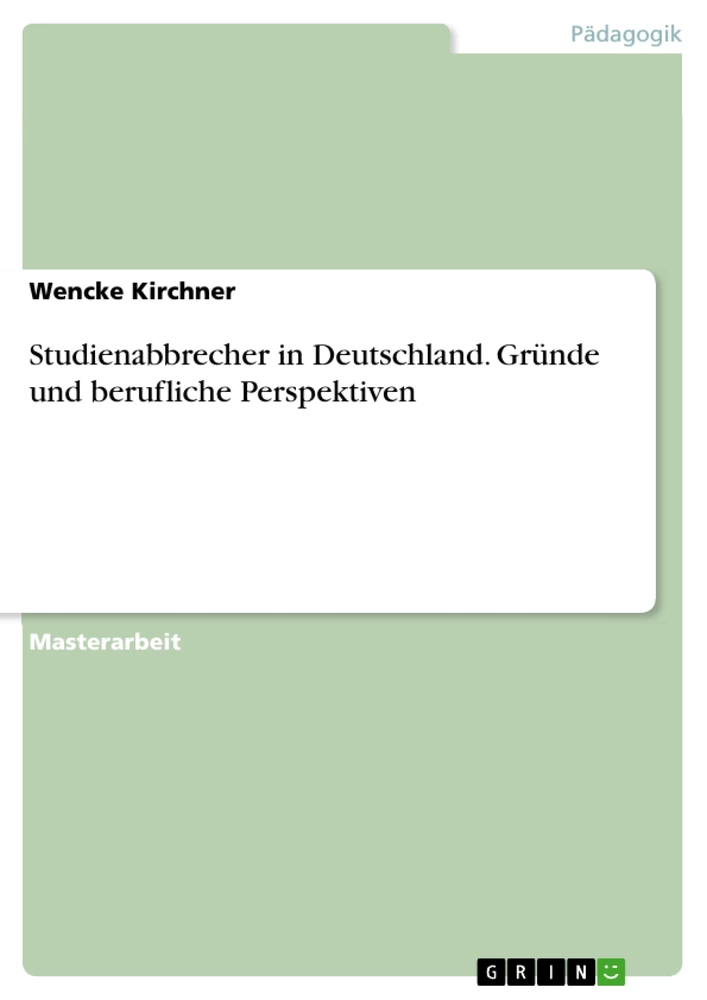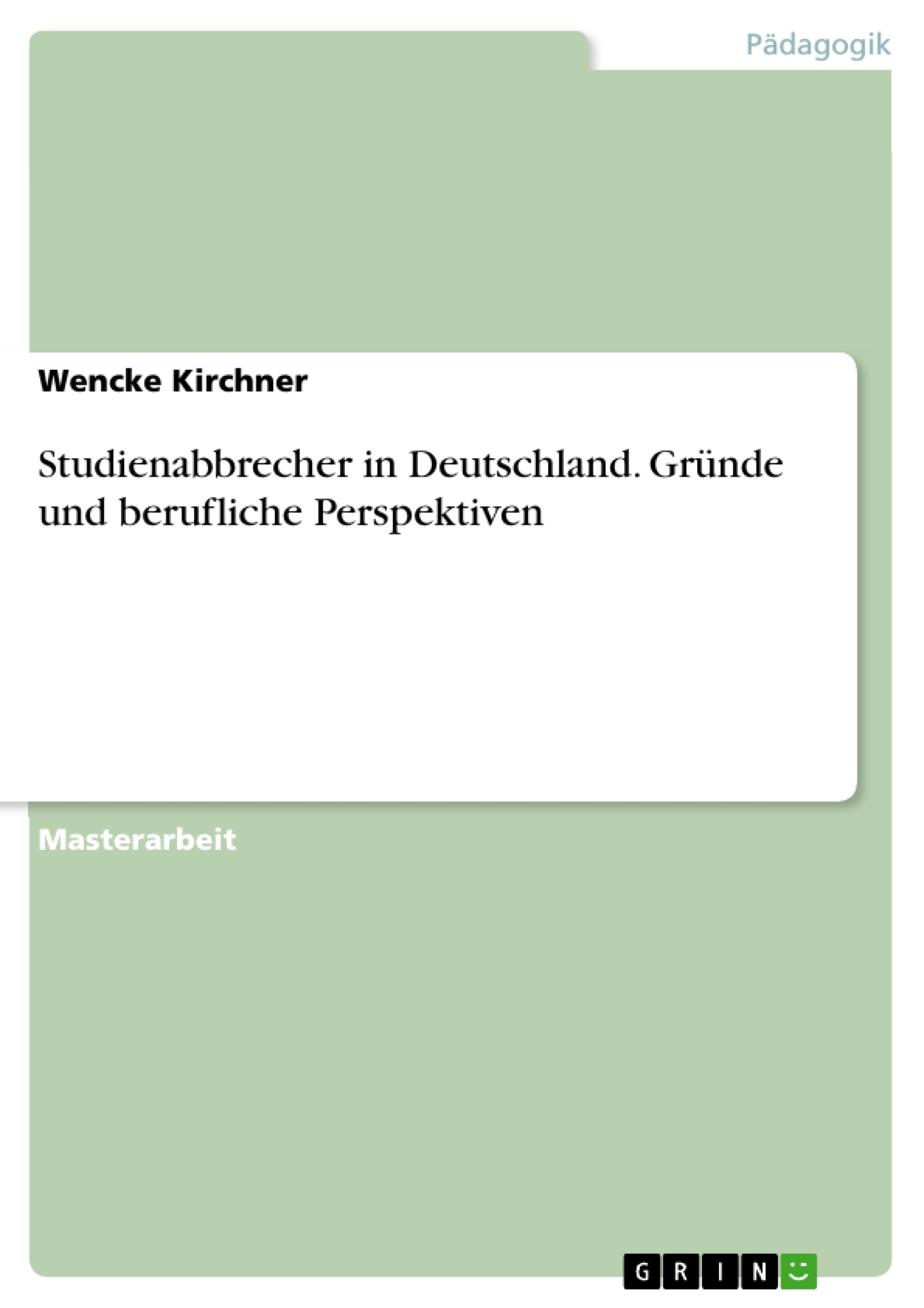Noch nie war die Übergangsquote von Jugendlichen nach der Schule an eine Hochschule oder Universität in Deutschland so hoch wie derzeit. Das ehemals stabile System zwischen dualer Berufsausbildung und akademischer Bildung kommt ins wanken - mit nicht unerheblichen Folgen für die deutsche Wirtschaft. Allerdings bleibt auch die Quote der Studienabbrecher in den letzten Jahren weiterhin konstant und vor allem in den technischen Studienfächern nach wie vor sehr hoch. In manchen Studiengängen liegt die Abbrecherquote bei an oder sogar über 50%. Auf der anderen Seite werden in der dualen Berufsausbildung händeringend junge Menschen mit guten Qualifikationen gesucht und benötigt.
Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die aktuellen Daten- und Faktenlage, beleuchtet die Möglichkeiten der Durchlässigkeit beider Systeme aus Sicht eines Studienabbrechers, stellt verschiedene Konzepte in Deutschland vor und gibt einen Einblick in die Einstiegsmöglichkeiten in das duale Aus- und Weiterbildungssystem. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anrechenbarkeit von im Studium erworbenen Kompetenzen auf eine duale Berufsausbildung sowie mögliche zukünftige Methoden und Modelle.
Der rasante Wandel der deutschen Gesellschaft bedingt durch die Industrialisierung und den technologischen Fortschritt sowie dem damit verbundenen Wandel der Wirtschaftsstruktur von der Industrie hin zur Dienstleistungsgesellschaft sind Bausteine für den bereits begonnenen Wandel im Beschäftigungssystem Deutschlands. Damit einhergehend verändern sich auch die notwendigen Tätigkeitsprofile am Arbeitsmarkt sowie die Anforderungen an Kompetenzen und Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen. Das Bildungssystem in Deutschland, das bis dato nach der allgemeinbildenden Schule auf den beiden Säulen der dualen Berufsausbildung und der akademisch, wissenschaftlichen Bildung beruht und sich bewährt hat, steht vor größeren strukturellen Umbrüche. Liefen beide Systeme jahrzehntelang weitgehend parallel und unverändert nebeneinander, so müssen sie sich zunehmend auf sich schneller veränderte Rahmenbedingungen und ganz neue äußere Anforderungen einstellen. Ein stärkeres aufeinander Zugehen und die Abstimmung bis hin zur Integration der beruflichen Ausbildung in der Hochschulbildung in sogenannten hybriden Ausbildungs und Studienmodellen wird prognostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Einführung und Themenvorstellung
- Ziel der Arbeit, Eingrenzung des Themengebietes und Erläuterung der Kernfrage
- Berufliche und akademische Bildung in Deutschland
- Begriffsbestimmungen und -definitionen
- Berufliche Bildung und duale Ausbildung
- Akademischer Bildungsbereich
- Zugänge und Übergänge im Berufsbildungssystem
- Statistische Daten zur beruflichen und akademischen Bildung
- Statistische Daten der Berufsbildung
- Statistische Daten der akademischen Bildung
- Statistische Prognosen zu Schulabsolventen und Studienanfängern
- Prognosen zum Übergang der Schulabsolventen in den beruflichen und akademischen Bildungsbereich
- Definition, Häufigkeit und Ursachen für Studienabbrüche
- Definition und statistische Daten zu Studienabbrüchen
- Ursachen, Motive und Zeitpunkt von Studienabbrüchen
- Beruflicher Verbleib von Studienabbrechern
- Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung
- Das Deutsche „Bildungs-Schisma“
- Durchlässigkeit zwischen den Systemen im Kontext des Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmens
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Anrechnungsverfahren
- Vergleich verschiedener Modelle des Übergangs von der akademischen in die berufliche Bildung
- Modell „Switch“ - IHK Aachen
- Modell „Finish-IT“ – Cyberforum / IHK Karlsruhe
- Modellregion „Bildungsweichen“ – Karlsruhe
- Zwischenfazit der dargestellten Modellen
- Anrechnung von im Studium erworbenen Kompetenzen
- Annäherung an den Kompetenzbegriff
- Kompetenzbegriff in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft
- Verwendung des Kompetenzbegriffs in der beruflichen und akademischen Bildung
- Berufliche und akademische Kompetenzen – Übereinstimmungen und Unterschiede
- Methoden und Modelle zur Anrechnung erworbener Kompetenzen für die berufliche Bildung am Beispiel von ANKOM
- Grundlagen zum Äquivalenzbeurteilungs- und Anrechnungsverfahren
- Äquivalenzbeurteilung für pauschale Anrechnungsverfahren
- Äquivalenzbeurteilung für individuelle Anrechnungsverfahren
- Annäherung an den Kompetenzbegriff
- Zusammenfassung und Ausblick
- Fazit und Kritik der Ergebnisse
- Zukünftige und neue Herausforderungen für das Themengebiet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema der Durchlässigkeit zwischen der akademischen und der beruflichen Bildung in Deutschland. Ziel ist es, Modelle des Übergangs zwischen den beiden Bildungssystemen zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf Methoden, Möglichkeiten und Grenzen der Anrechnung erworbener Kompetenzen am Beispiel der Industrie- und Handelskammern Deutschlands.
- Analyse der aktuellen Situation der Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung in Deutschland
- Untersuchung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Anrechnungsverfahren
- Bewertung verschiedener Modelle des Übergangs von der akademischen in die berufliche Bildung
- Analyse von Methoden und Modellen zur Anrechnung erworbener Kompetenzen
- Diskussion der Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für die Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet das Deutsche „Bildungs-Schisma“ und die Herausforderungen, die sich aus der Trennung der beiden Bildungssysteme ergeben.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Begriffsbestimmungen und -definitionen. Es werden die unterschiedlichen Ansätze der beruflichen und akademischen Bildung sowie die Zugänge und Übergänge im Berufsbildungssystem vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden statistische Daten zur beruflichen und akademischen Bildung in Deutschland präsentiert. Dazu gehören Daten zur Anzahl neuer Auszubildender, Studienanfänger und Studienabbrecher sowie Prognosen zum Übergang der Schulabsolventen in den beruflichen und akademischen Bildungsbereich.
Kapitel vier befasst sich mit der Definition, Häufigkeit und Ursachen für Studienabbrüche. Es werden statistische Daten zu Studienabbruchquoten sowie die wichtigsten Motive und Ursachen für den Abbruch eines Studiums untersucht.
Kapitel fünf widmet sich dem Thema der Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Es wird der aktuelle Stand der Durchlässigkeit im Kontext des Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmens analysiert, und verschiedene Modelle des Übergangs von der akademischen in die berufliche Bildung werden vorgestellt und miteinander verglichen.
Das sechste Kapitel behandelt die Anrechnung von im Studium erworbenen Kompetenzen. Es werden verschiedene Methoden und Modelle zur Anrechnung von Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Bildung präsentiert, und das Äquivalenzbeurteilungs- und Anrechnungsverfahren wird im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Durchlässigkeit, akademische Bildung, berufliche Bildung, Kompetenzanrechnung, Übergangsmodelle, Qualifikationsrahmen, Studienabbrüche, Industrie- und Handelskammern, Äquivalenzbeurteilung, ANKOM-Projekt, Bildungsschisma.
- Quote paper
- Wencke Kirchner (Author), 2015, Studienabbrecher in Deutschland. Gründe und berufliche Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367650