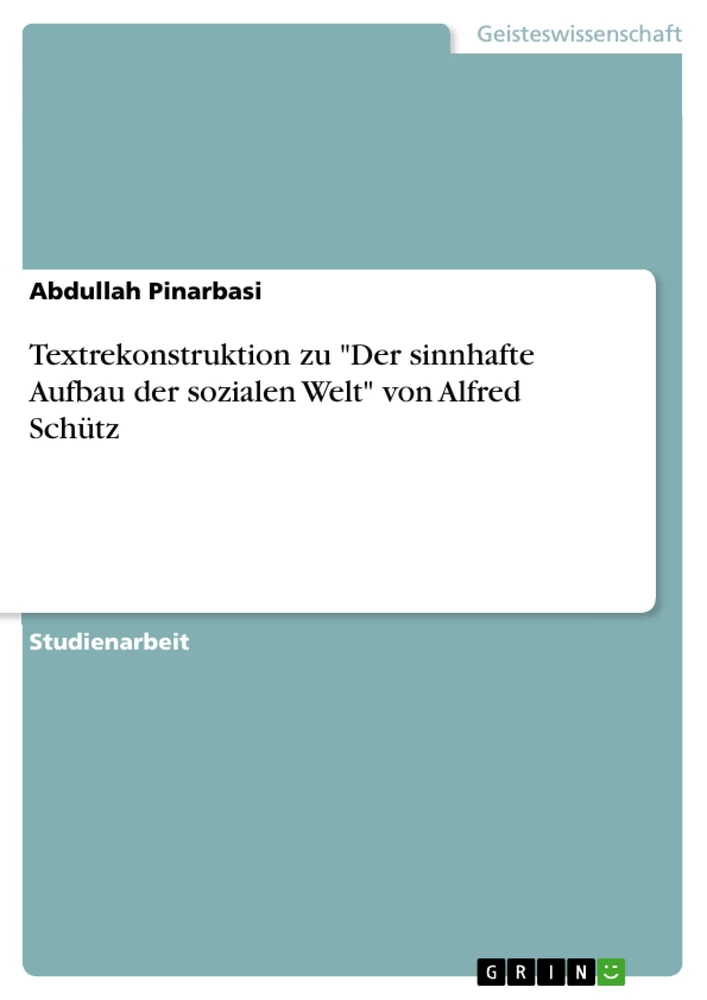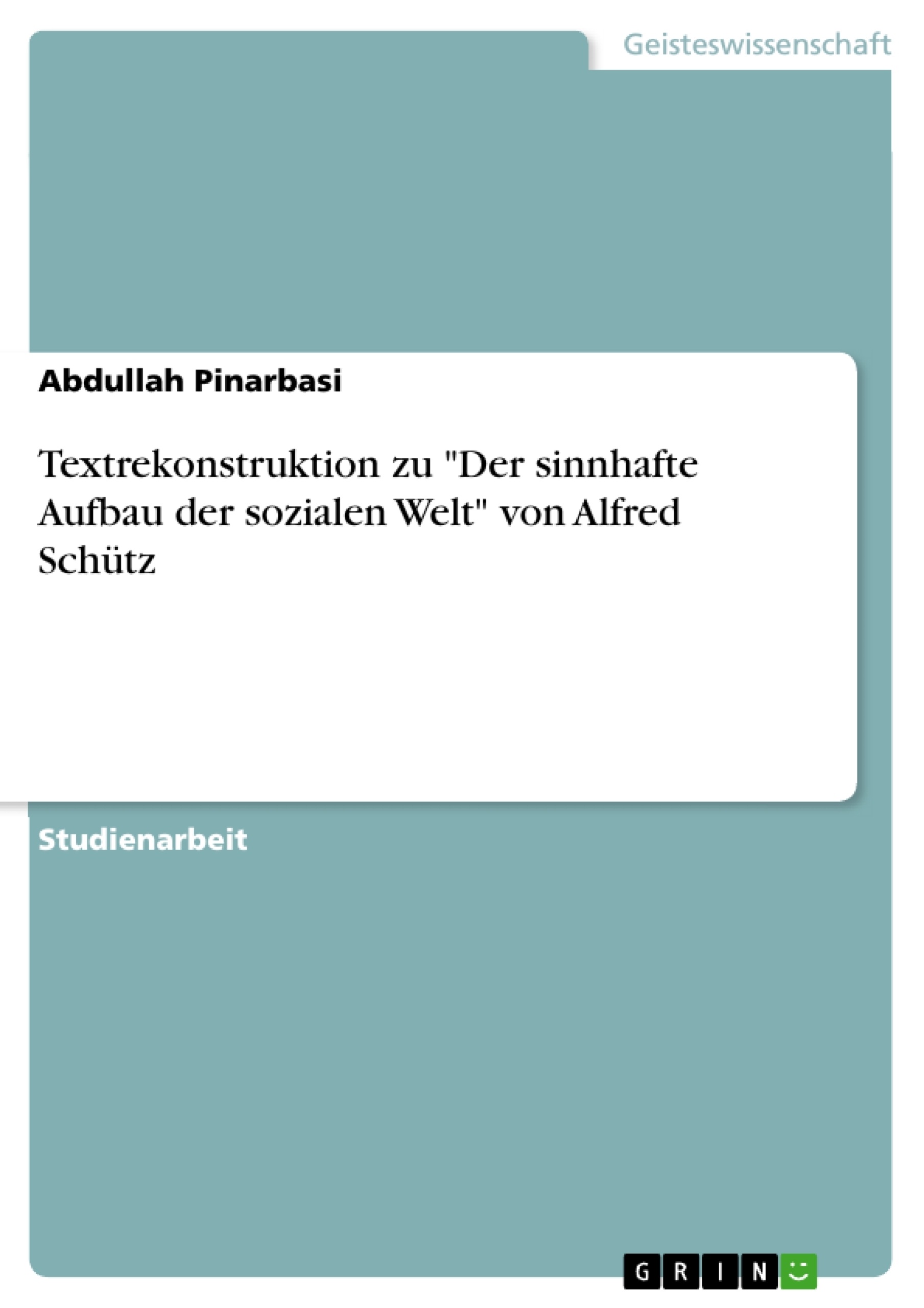In der vorliegenden Arbeit, versucht Alfred Schütz die Handlungstheorie von Max Weber phänomenologisch zu begründen. Das entsprechende methodologische Konzept findet er in Edmund Husserls phänomenologischer Konstitutionsanalyse. Der zentrale Begriff des Handlungssinns wird von Schütz weiter ausgearbeitet. Schütz setzt beim Handelnden an und fragt nach der Konstitution des subjektiven Sinns. Dem Wissenschaftler ist der vom Akteur erzeugte Sinn nicht zugänglich und kann nicht identisch mit dem vom Beobachter selbst sein. Dabei beschreibt er die Problematik des Fremdverstehens und stellt sich die Frage wie unsere alltägliche Kommunikation in der Gesellschaft funktionieren kann. Schütz zufolge greifen Akteure im Alltag auf bestimmte Methoden zurück, die es ihnen ermöglichen, von einem intersubjektiv geteilten Sinn auszugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Schlüsselwörter
- Soziale Mitwelt und Idealtypus
- Übergang zum Problem der sozialen Mitwelt. Kontinuierliche Sozialbeziehungen.
- Das Alter ego in der Mitwelt als Idealtypus. Die Ihr-Beziehung.
- Die Konstitution des idealtypischen Deutungsschemas
- Die Anonymität der Mitwelt und die Inhaltserfülltheit des Idealtypus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In dieser Arbeit versucht Alfred Schütz, die Handlungstheorie von Max Weber phänomenologisch zu begründen. Er greift dabei auf das methodologische Konzept der phänomenologischen Konstitutionsanalyse von Edmund Husserl zurück. Der Fokus liegt auf der Ausarbeitung des Handlungssinns und der Konstitution des subjektiven Sinns. Schütz beleuchtet die Problematik des Fremdverstehens und untersucht, wie alltägliche Kommunikation in der Gesellschaft funktioniert.
- Die Unterscheidung zwischen Umwelt und Mitwelt
- Die Konstitutionsweisen der Mitwelt und verschiedene Beziehungen zwischen Individuen
- Die Rolle des Idealtypus im Verständnis der Mitwelt
- Die Bedeutung von Erfahrungen und Übertragungen im sozialen Kontext
- Die Anonymität der Mitwelt und die Inhaltserfülltheit des Idealtypus
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Abschnitt definiert Alfred Schütz die Begriffe „Mitwelt“ und „Umwelt“ und erläutert den Übergang von der Umwelt in die Mitwelt anhand von Alltagsbeispielen. Er stellt fest, dass die Mitwelt parallel zur Umwelt existiert, aber nicht immer wahrgenommen wird.
Im zweiten Abschnitt untersucht Schütz die Konstitutionsweisen der Mitwelt und unterscheidet zwischen „Wir-Beziehung“ und „Ihr-Beziehung“. Die „Wir-Beziehung“ ist durch eine gemeinsame raum-zeitliche Anwesenheit gekennzeichnet, während die „Ihr-Beziehung“ auf die Mitwelt bezogen ist und auf Typisierungen basiert.
Im dritten Abschnitt geht Schütz auf die Konstitution des idealtypischen Deutungsschemas ein. Er unterscheidet zwischen „Ablauftypus“ und „personalem Idealtypus“ und analysiert die „um-zu Motive“ und „weil-Motive“ als Grundlage für das gegenseitige Verstehen von Individuen im Alltag.
Im vierten Abschnitt untersucht Schütz die Anonymität der Mitwelt und die Inhaltserfülltheit des Idealtypus. Er stellt fest, dass die Inhaltserfülltheit des Idealtypus von der Übertragbarkeit der „Ihr-Beziehung“ in eine „Wir-Beziehung“ und von der Zugehörigkeit der typisch erfassten fremden Bewusstseinsinhalte zu realen Dauerabläufen abhängt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Mitwelt, Umwelt, Alter ego, Idealtypus, Handlungssinn, Fremdverstehen, Konstitutionsanalyse, Typisierung, „Wir-Beziehung“, „Ihr-Beziehung“, „um-zu Motive“, „weil-Motive“ und die Problematik der Anonymität in der sozialen Beziehung.
- Quote paper
- Abdullah Pinarbasi (Author), 2016, Textrekonstruktion zu "Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" von Alfred Schütz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367549