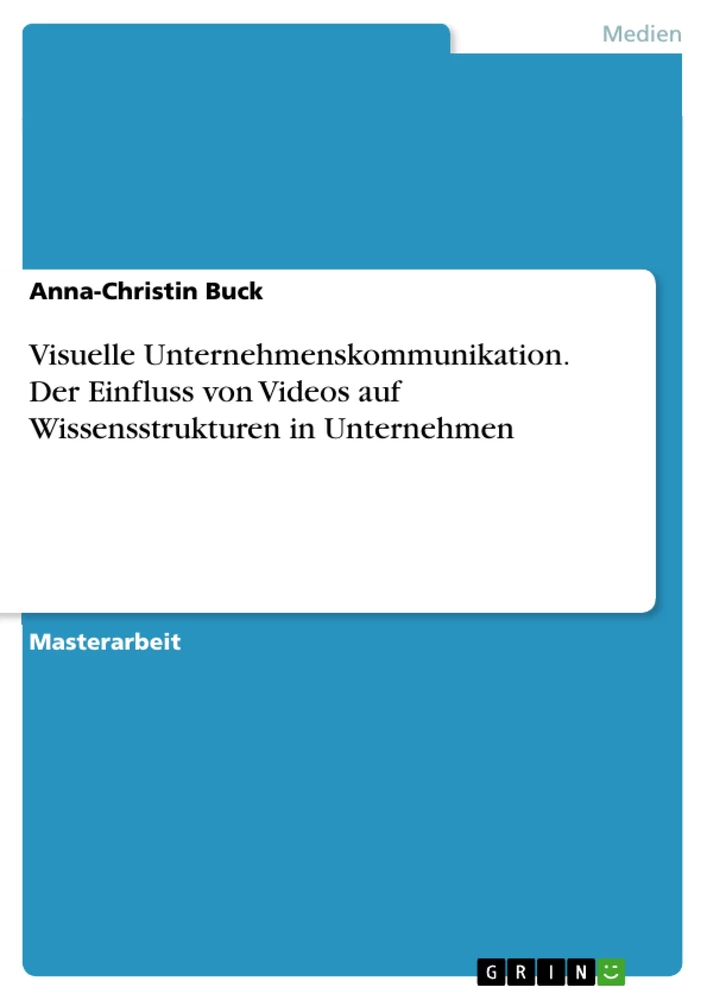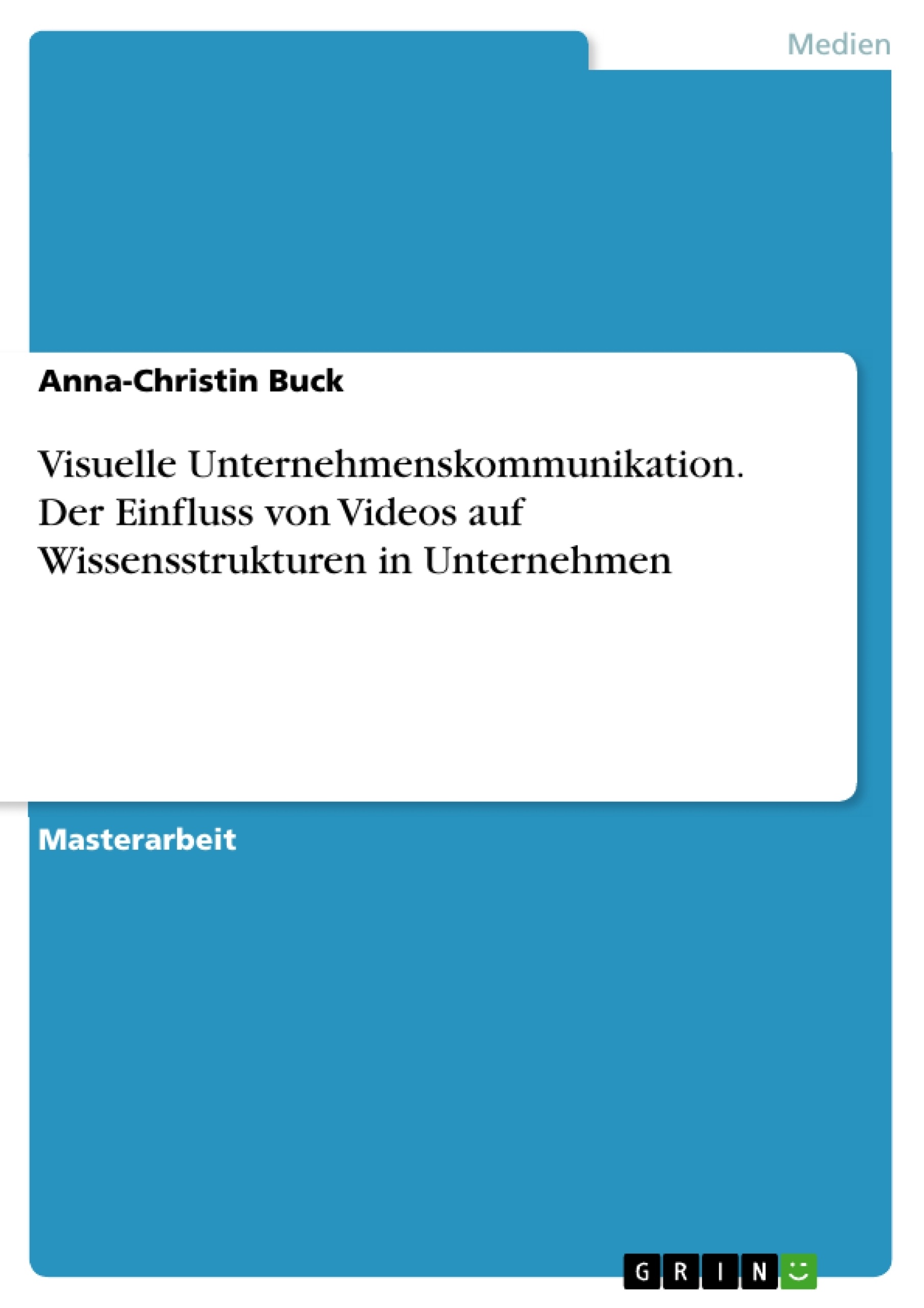Die hier vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen Video und versucht zu klären, inwiefern es Unternehmen möglich ist, unter Rückgriff auf Visualisierungen auf die Wissensstrukturen des Rezipienten Einfluss zu nehmen.
Hierzu wird zunächst die derzeitige mediale Welt vorgestellt, um dann mögliche Interdependenzen zwischen Mensch und Medien zu untersuchen. Nach der Erläuterung der aktuellen Theatralitätstheorie wird die Annahme getroffen, dass Medien in unbestimmter Form Einfluss auf die Rezipienten nehmen können. Daher erfolgt im Anschluss ein Einblick in die klassischen Wirkungsmodelle. Es kann aufgezeigt werden, dass diese in unserer heutigen Zeit kaum ihre Gültigkeit behalten können und Modelle benötigt werden, die von einem aktiven Rezipienten ausgehen.
Daher widmet sich das darauffolgende Kapitel den Bildwissenschaften. Hier zeichnen sich erste Hinweise auf die (Rahmen-)Bedingungen eines Rezeptionsprozesses ab. Die Vermutung, dass bspw. Sinnstrukturen beim Rezipienten eine entscheidende Rolle bei der Interpretation des Bildes spielen, wird auch ihm Rahmen des Bewegtbildes analysiert. Ähnliche Eigenschaften zwischen Film und Video werden deutlich, da beide einer Syntax folgen können. Es kann nun die Annahme getroffen werden, dass Rezipienten über unbestimmte Wissensstrukturen verfügen, die den Interpretationsprozess des Videos maßgeblich beeinflussen. Daher werden im anschließenden Kapitel zunächst die Wissensformen implizit und explizit und die speziellen Formen visuell und visualisiert vorgestellt. Dies führt zu den Ansätzen der visuellen Wissenssoziologie. Auch hier zeigt sich, dass das Wissen des Rezipienten bspw. in Form von Erfahrungen eine essenzielle Rolle bei der Bedeutungsgenerierung spielt. Innerhalb der empirischen Untersuchung wird deutlich, dass bei der Rezeption eines Videos, der Thematik große Relevanz beigemessen wird. Das visualisierte Wissen wird zwar verstanden und auch im Sinne des Unternehmens interpretiert, dennoch fällt die Kritik am Video negativ aus. Dies kann bspw. schlechten Erfahrungen mit der Thematik und anderen Rezeptionsgewohnheiten zugesprochen werden.
Letztendlich kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Rezipienten sowohl auf visuelles Wissen als auch auf Alltagswissen zurückgreifen, um das Video zu deuten. Das Video spielt in dem vorliegenden Fall eine untergeordnete Rolle sodass die Wissensstrukturen des Rezipienten bei der Analyse von visuellen Wirkungsmechanismen in den Vordergrund treten
Inhaltsverzeichnis
- Was ist hier eigentlich los und was ist die Frage?
- Konzeptioneller Rahmen der empirischen Erhebung.
- Die neue Moderne
- Visuelle Medienkultur.
- Theatralität in den Medien
- Einordnung.
- Klassische Wirkungsmodelle.
- Elaboration Likelihood Modell nach Petty/Cacioppo.
- Konsumentenverhalten nach Trommsdorff.
- Kritische Betrachtung.
- Die Bedeutung und Relevanz der Visualität im Rahmen der Unternehmenskommunikation.
- Was ist ein Bild?
- Bedeutungsgenerierung in der visuellen Kommunikation.
- Besonderheiten des Bewegtbildes.
- Geschichtliche Einordnung des Werbefilm.
- Anforderungen an die visuelle Zielgruppe und an Konstrukteure von visuellen Inhalten.
- Visuelle Wissenssoziologie.
- Wissensformen.
- Relevanz und geschichtliche Einordnung der Wissenssoziologie.
- Relevanz und Besonderheiten der visuellen Wissenssoziologie.
- Körperlichkeit als Ausdruck des Habitus
- Ansätze und Problematik der visuellen Wissenssoziologie.
- Bedeutung für die nachfolgende Forschung.
- Empirische Erhebung
- Das Forschungsobjekt.
- Relevanz und Eignung
- Inhaltsanalyse des Videos.
- Forschungsmethodik.
- Datenerhebung.
- Sampling.
- Gruppendiskussion.
- Transkription.
- Auswertungsmethode.
- Ergebnisse der empirischen Analyse.
- Warum Videos bevormunden können
- Warum Videos kränken können.
- Warum Versicherungen verunsichern können.
- Zusammenfassung - Wissen als Grundlage für die Bedeutungsgenerierung.
- Konklusion aus Theorie und Empirie: Die überschätzte Macht des Visuellen
- Der perzeptorische Umgang mit Videos
- Bedeutung für die visuelle Unternehmenskommunikation.
- Fazit und Ausblick
- Kritische Würdigung.
- Implikation für die Forschung.
- Die Rolle von Visualisierungen in der Medienlandschaft
- Der Einfluss von Medien auf die Wissensstrukturen von Rezipienten
- Die Bedeutung von bildwissenschaftlichen Ansätzen für die Analyse von Videos
- Die Relevanz der Wissenssoziologie im Kontext der visuellen Kommunikation
- Empirische Untersuchungen zur Rezeption von Videos und die Interpretation von visualisiertem Wissen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht das Phänomen Video und analysiert, wie Unternehmen durch Visualisierungen die Wissensstrukturen von Rezipienten beeinflussen können. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle mediale Welt, erforscht die Interdependenz zwischen Mensch und Medien und hinterfragt klassische Wirkungsmodelle im Kontext der heutigen Medienlandschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Masterarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie Unternehmen mit Hilfe von Videos auf die Wissensstrukturen von Rezipienten Einfluss nehmen können. Dabei wird zunächst die aktuelle mediale Welt vorgestellt und die Interdependenz zwischen Mensch und Medien beleuchtet. Die Theatralitätstheorie wird herangezogen, um zu zeigen, dass Medien in unbestimmter Form Einfluss auf Rezipienten nehmen können. Anschließend werden klassische Wirkungsmodelle kritisch betrachtet und ihre Gültigkeit in der heutigen Zeit hinterfragt.
Das zweite Kapitel widmet sich der Bedeutung der Visualität im Rahmen der Unternehmenskommunikation. Es werden bildwissenschaftliche Ansätze vorgestellt und die Bedeutung von Bedeutungsgenerierung in der visuellen Kommunikation untersucht. Die Besonderheiten des Bewegtbildes werden beleuchtet und die geschichtliche Entwicklung des Werbefilms betrachtet. Darüber hinaus werden die Anforderungen an die visuelle Zielgruppe und an die Konstrukteure von visuellen Inhalten dargestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der visuellen Wissenssoziologie. Es werden verschiedene Wissensformen vorgestellt und die Relevanz und die geschichtliche Entwicklung der Wissenssoziologie beleuchtet. Die Besonderheiten der visuellen Wissenssoziologie werden betrachtet und die Rolle der Körperlichkeit als Ausdruck des Habitus untersucht. Schließlich werden Ansätze und Problematiken der visuellen Wissenssoziologie diskutiert.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die sich mit der Rezeption von Videos befasst. Es werden Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Rezipienten Videos interpretieren und welche Rolle Wissen bei der Bedeutungsgenerierung spielt. Die Ergebnisse zeigen, dass Rezipienten sowohl auf visuelles Wissen als auch auf Alltagswissen zurückgreifen, um Videos zu deuten.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den Themen Visualisierung, Wissenssoziologie, Rezeption, Video, Unternehmenskommunikation, Medien, Visualität, Bewegtbild, Theatralität, Wirkungsmodelle, Bildwissenschaft, Interpretation und Bedeutungsgenerierung.
- Quote paper
- Anna-Christin Buck (Author), 2017, Visuelle Unternehmenskommunikation. Der Einfluss von Videos auf Wissensstrukturen in Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367340