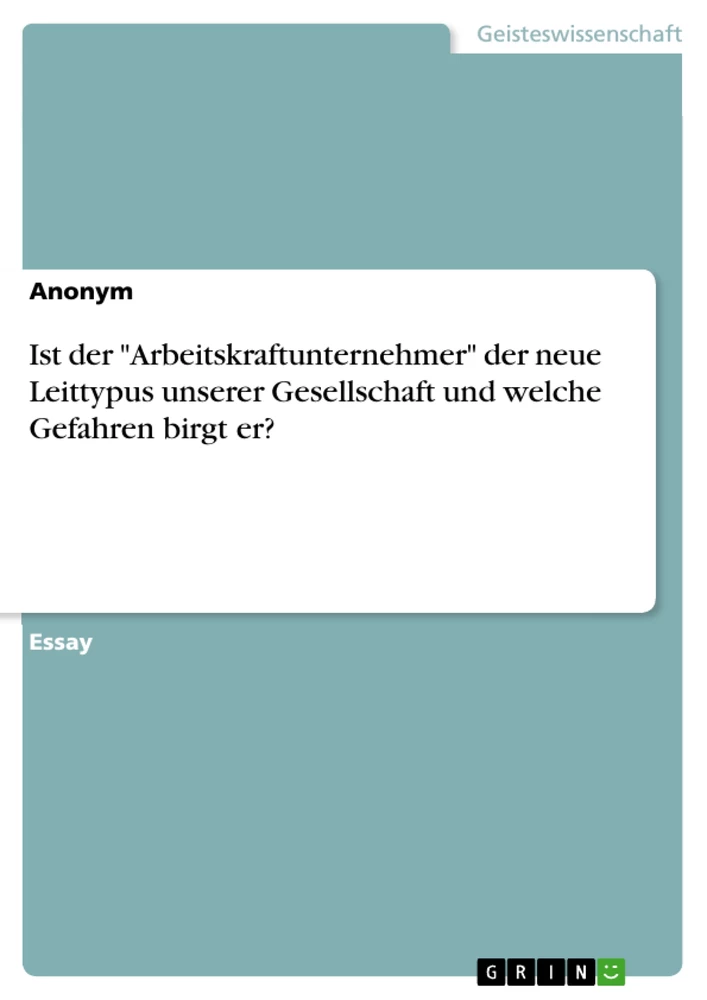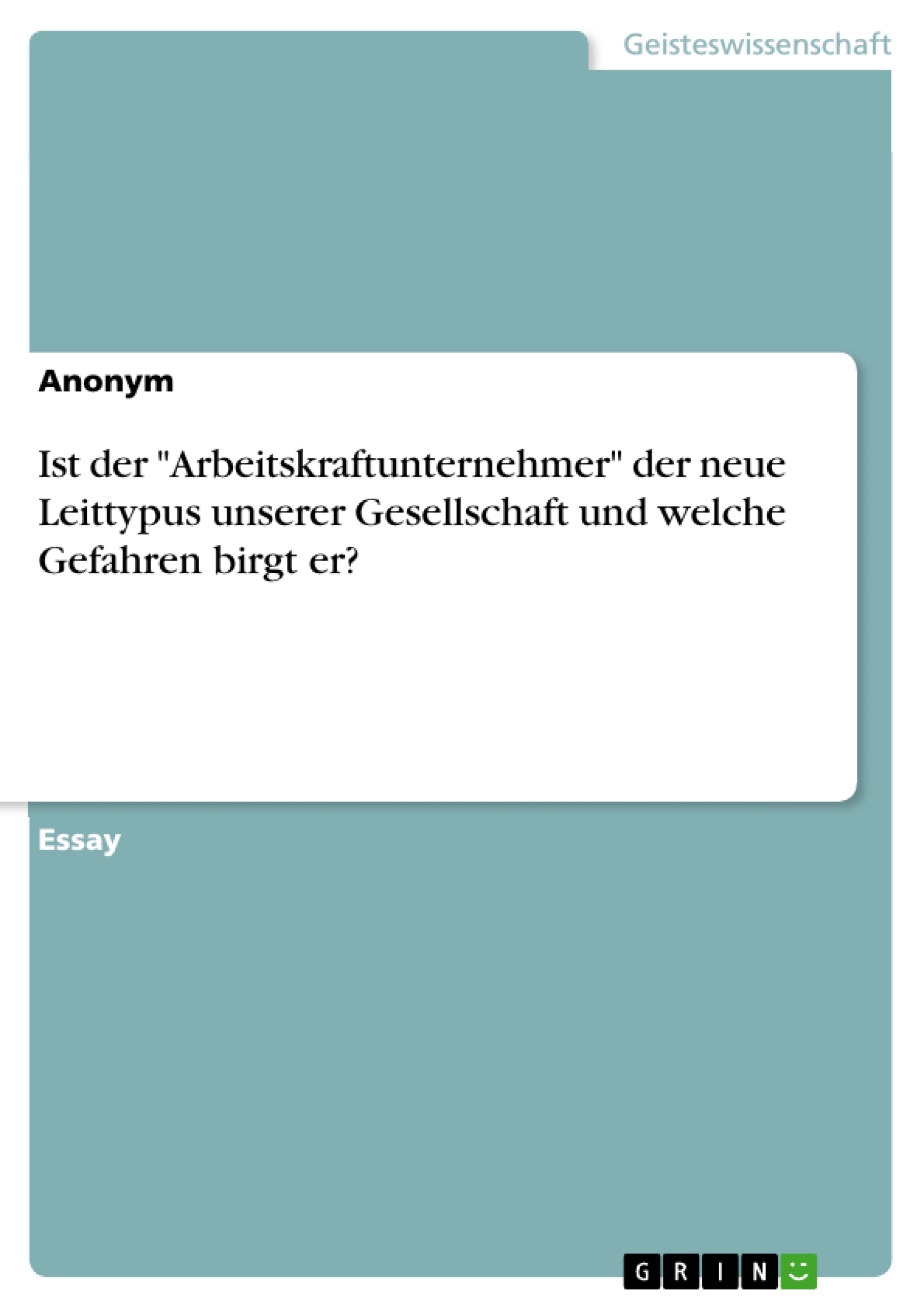In dieser Arbeit soll sich kritisch mit dem Typus des Arbeitskraftunternehmers auseinandergesetzt und hierbei die Leitfrage beantwortet werden: „Ist der Arbeitskraftunternehmer der neue Leittypus in unserer Gesellschaft und welche Gefahren birgt er?“
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Gesamtgefüge der Erwerbsformen auf dem deutschen Arbeitsmarkt stark gewandelt. Das Normalarbeitsverhältnis, als zentrale Erwerbskategorie und definiert als abhängige, unbefristete Lohnarbeit, die in Vollzeit erbracht wird und die volle Integration in die sozialen Sicherungssysteme umfasst, hat in absoluten Zahlen stark abgenommen. Hingegen gibt es eine starke Zunahme an atypischer Beschäftigungsverhältnisse wie Teil-zeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Soloselbstständige, Leiharbeit und befristete Beschäftigungen. Mückenberger spricht bereits im Jahre 1985 von der „Erosion der Normalarbeit“. Es lassen sich aber auch weitere Veränderung feststellen, wie die Zunahme von projektförmiger Arbeit und Netzwerkstrukturen, wie auch die verkürzte Dauer von Arbeitsbeziehungen und Flexibilisierung von Arbeitsinhalten. Die Entgrenzung von Freizeit und Arbeit, als auch die Qualifikation und persönlichen Eigenschaften stehen im Vordergrund. Auch das Transformationstheorem von Baverman , welche besagt, dass das Ziel jedes Unternehmens sei, die Transformation von Arbeitsvermögen in die effektivste Arbeitsleistung sicherzustellen und vollständig auszuschöpfen wird erklärt, dies und die o.g. Faktoren waren Grundlage einen neuen „Typus von Arbeitskraft“ zu definieren, der als Arbeitskraftunternehmer bezeichnet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung der „Typen“ von Arbeitskraft und „Arbeitskraft als Ware“
- Der proletarisierte Lohnarbeiter
- Der verberuflichte Arbeitnehmer
- Der verbetrieblichte Arbeitskraftunternehmer
- Selbst-vermarktung und Rationalisierung
- Selbst-Kontrolle
- weitere Anzeichen des Arbeitskraftunternehmeransatzes
- Folgen des Arbeitskraftunternehmers als neuen Leittypus und Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der „Arbeitskraftunternehmer“ den neuen Leittypus unserer Gesellschaft darstellt und welche Gefahren mit diesem Konzept verbunden sind. Dabei werden die historischen Entwicklungen der „Typen“ von Arbeitskraft beleuchtet, um die charakteristischen Merkmale des Arbeitskraftunternehmers herauszuarbeiten und seine Folgen zu diskutieren.
- Entwicklung des „Typus“ von Arbeitskraft
- Charakteristische Merkmale des Arbeitskraftunternehmers
- Folgen des Arbeitskraftunternehmers
- Kritik am Arbeitskraftunternehmerkonzept
- Gefahren des Arbeitskraftunternehmertypus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Arbeit dar und führt den Begriff des „Arbeitskraftunternehmers“ ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der „Typen“ von Arbeitskraft, beginnend mit dem proletarisierten Lohnarbeiter im Frühkapitalismus und dem verberuflichten Arbeitnehmer im Fordismus. Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Analyse des verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmers, der im dritten Kapitel detailliert betrachtet wird. Dabei werden die Merkmale des Arbeitskraftunternehmers, wie Selbst-vermarktung und Rationalisierung sowie Selbst-Kontrolle, hervorgehoben. Das vierte Kapitel diskutiert die Folgen und Kritik am Arbeitskraftunternehmer als neuem Leittypus unserer Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf den Gefahren, die mit diesem Konzept verbunden sein können.
Schlüsselwörter
Arbeitskraftunternehmer, Arbeitskraft als Ware, proletarisierter Lohnarbeiter, verberuflichter Arbeitnehmer, Fordismus, Postfordismus, Selbst-vermarktung, Rationalisierung, Selbst-Kontrolle, Folgen, Kritik, Gefahren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Ist der "Arbeitskraftunternehmer" der neue Leittypus unserer Gesellschaft und welche Gefahren birgt er?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367335