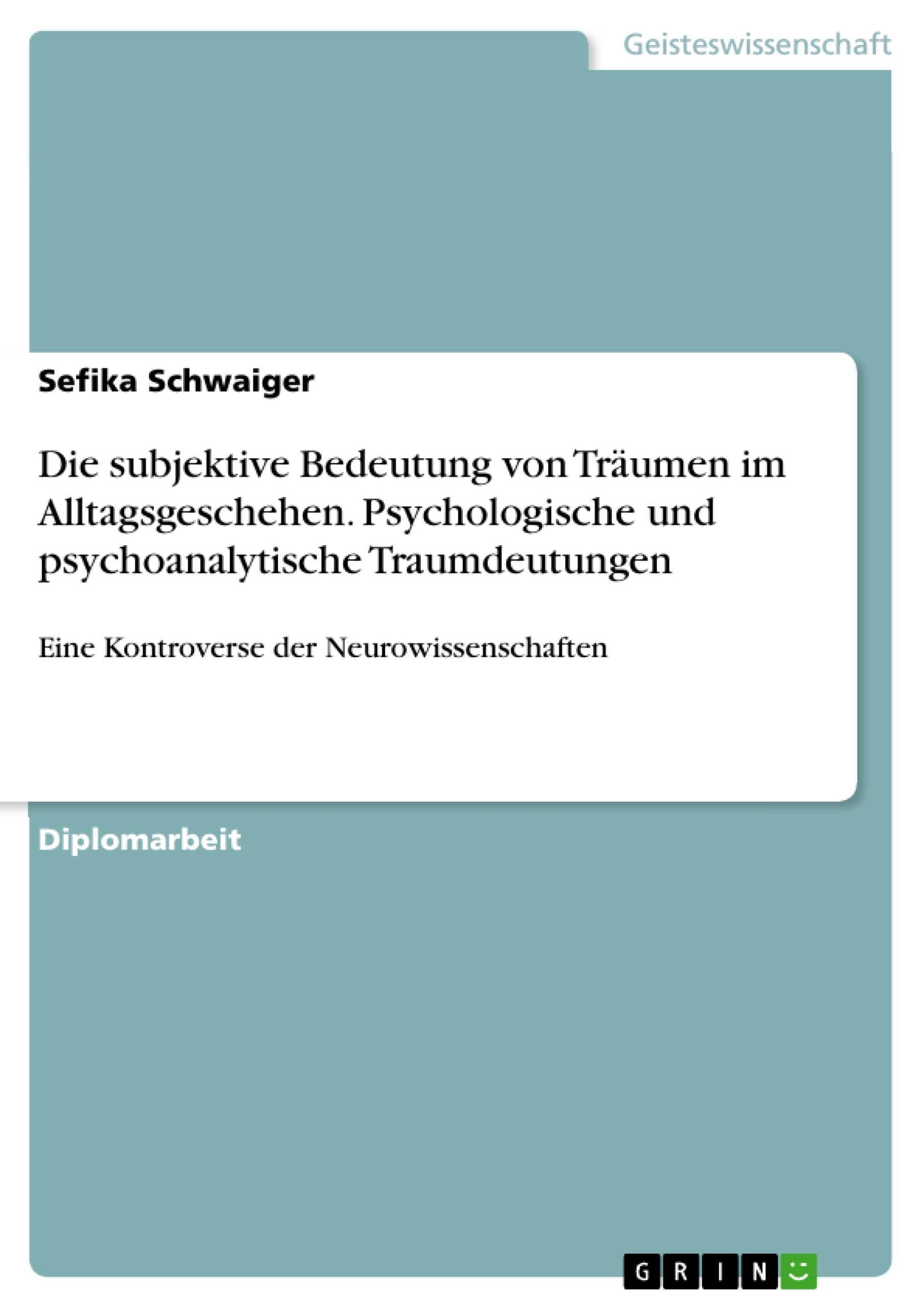Träume haben die Menschen seit jeher fasziniert, weil sie uns Nacht für Nacht in eine Welt versetzen, die wir als wirklich erleben und die wir erst nach dem Aufwachen als Phantasie erkennen, wenn wir uns denn überhaupt an sie erinnern. Jeder träumt, und zwar mehrfach pro Nacht. Auch diejenigen, die behaupten, selten oder gar nie zu träumen, träumen! Träume sind überaus facettenreich, sie können vertraut oder fremdartig, emotional oder neutral, bunt oder grau, undeutlich oder klar, bruchstückhaft oder kohärent, bizarr oder alltäglich sein.
Was ist das Ziel dieser Forschungsarbeit, wozu dient sie? Die Ergebnisse können als Beitrag zur psychologischen Beratung angesehen werden, eventuell auch nützlich für Traumdeutung im psychotherapeutischen Kontext.
Träumen, dieses erstaunliche Phänomen eines scheinbaren (oder doch irgendwie realen?) Erlebens im Schlaf führen zu grundsätzlichen Fragen, die die Menschen schon immer bewegten: Warum träumen Menschen - welche Funktionen haben Träume? Was sagen Träume ganz konkret über einen Menschen und seine jeweilige Situation aus? Sind Träume hilfreich zur Bewältigung des Lebens generell oder des Alltagslebens?
Mein Ziel ist es, durch diese Diplomarbeit: im theoretischen Teil aktuelle Interpretationsmodelle darzustellen und Kontroversen, die sie verursachen, aufzuzeigen; sowie im empirischen Teil durch Befragung und Analyse der Antworten einen Einblick zu geben, wie Auskunftspersonen im Alltag Träume erleben, was sie mit ihnen assoziieren und ob sie - direkt oder indirekt – davon Auswirkungen auf ihr Alltagserleben spüren.
Folgende leitende Forschungsfrage, detaillierte Unterfragen wurden formuliert: „Welche subjektive Bedeutung haben Träume im Alltag?“
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde – nach einer Phase von Recherchen in der Fachliteratur über Theorien und Studienergebnisse zu Träumen – eine empirische Untersuchung durchgeführt. Diese Untersuchung war grundsätzlich quantitativ angelegt, hatte aber auch qualitative Elemente enthalten. Befragt wurden Psychologie-Studierende an der Alpen- Adria Universität Klagenfurt zu Einstellungen und Verhalten hinsichtlich ihrer Träume. Entsprechend diesem Ansatz erfolgte die Datenauswertung sowohl quantitativ (statistisch) als qualitativ (themen- und inhaltsanalytisch). Die Ergebnisse wurden – als Antworten auf die Forschungsfragen – unter dem Aspekt der drei vorgestellten theoretischen Ansätze dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- 2 Verwendete Begriffe und theoretische Zugänge
- 2.1 Der Traum
- 2.2 Einige historische Auffassungen zum Traum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
- 2.2.1 Mesopotamien: Astrologie und der Traum
- 2.2.2 Das Klassifizieren des Traumes in der römischen Antike
- 2.2.3 Göttlich inspirierte Traumvisionen im christlichen Mittelalter
- 2.2.4 Die Rezeption rationaler aristotelischer Auffassungen in Europa
- 2.2.5 Anthropologische Konzepte von der Antike bis zur Neuzeit
- 2.2.6 Zwischenfazit
- 2.3 Theoretische Ansätze und Traumforschung seit 1900
- 2.3.1 Psychoanalytische Ansätze
- 2.3.2 Neurophysiologische Ansätze
- 2.3.3 Psychologische Ansätze
- 3 Design und Methodik der empirischen Studie
- 3.1 Datenerhebung
- 3.2 Datenauswertung
- 3.3 Beschreibung der Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskription und bivariate Inferenzstatistik zu den geschlossenen Fragen
- 4.1.1 Erinnerung an Träume
- 4.1.2 Häufig vorkommende Träume und Traumsymbolik
- 4.1.3 Persönliche Interpretation
- 4.1.4 Kommunikation
- 4.1.5 Beeinflussung durch Träume
- 4.1.6 Individuelles Achten auf Träume und deren Nützlichkeit
- 4.2 Multivariate Clusteranalyse: Drei Gruppen von Traumdeutern
- 4.2.1 Berechnungen
- 4.2.2 Ergebnis
- 4.2.3 Überprüfung
- 4.3 Multivariate Faktoranalyse: Vier wesentliche Einflüsse
- 4.3.1 Berechnungen
- 4.3.2 Ergebnis
- 4.3.3 Überprüfung
- 4.4 Qualitative Inhaltsanalyse zur allgemeinen Bedeutung von Träumen im Alltag
- 4.4.1 Vorgehensweise und Gruppensichten
- 4.4.2 Kategorien K1 + K2: Ambivalente Bedeutungen und Gewichtungen
- 4.4.3 Kategorien K3 + K4: Kurzfristige emotionale und kognitive Ergebnisse von Traumprozessen
- 4.4.4 Kategorie K5: Aktivierende kurzfristige Wirkungen von Träumen
- 4.4.5 Kategorie K6: Langfristige Wirkungen von Träumen
- 4.4.6 Kategorie K7: Spezieller sozialer Aspekt
- 4.4.7 Charakteristische Antworten der Gruppen
- 4.5 Diskussion
- 5 Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die subjektive Bedeutung von Träumen im Alltagsgeschehen. Ziel ist es, psychologische und psychoanalytische Traumdeutungen im Lichte der Neurowissenschaften zu betrachten und kontroverse Aspekte zu beleuchten. Die Arbeit kombiniert empirische Forschung mit einer Auseinandersetzung mit historischen und theoretischen Ansätzen zur Traumdeutung.
- Subjektive Bedeutung von Träumen im Alltag
- Konfrontation psychoanalytischer und neurophysiologischer Perspektiven auf Träume
- Historische Entwicklung der Traumdeutung
- Empirische Untersuchung der Traumdeutung anhand verschiedener Methoden
- Analyse der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung bezüglich der unterschiedlichen Auffassungen über die Bedeutung von Träumen und formuliert die Forschungsfragen. Es skizziert die Vorgehensweise und den Aufbau der gesamten Arbeit, um dem Leser einen roten Faden für das Verständnis des komplexen Themas zu geben. Die Einleitung dient als wichtiger Rahmen für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit der Traumforschung.
2 Verwendete Begriffe und theoretische Zugänge: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "Traum" und beleuchtet verschiedene historische und theoretische Zugänge zur Traumdeutung. Es spannt einen Bogen von den alten Kulturen Mesopotamiens und Roms über das christliche Mittelalter bis hin zu modernen psychoanalytischen, neurophysiologischen und psychologischen Ansätzen. Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere empirische Untersuchung und dient dem kritischen Vergleich verschiedener Interpretationen.
3 Design und Methodik der empirischen Studie: Hier wird die Methodik der empirischen Studie detailliert beschrieben. Es werden die Methoden der Datenerhebung, -auswertung und die Zusammensetzung der Stichprobe erläutert. Dieser Abschnitt ist essentiell, um die Transparenz und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten und den wissenschaftlichen Anspruch der Arbeit zu untermauern. Die detaillierte Beschreibung der gewählten Methoden ermöglicht eine kritische Bewertung der Studie.
4 Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie, die durch verschiedene statistische Verfahren gewonnen wurden (deskritive Statistik, bivariate und multivariate Analysen, qualitative Inhaltsanalyse). Die Ergebnisse werden systematisch dargestellt und interpretiert, wobei der Fokus auf die verschiedenen Aspekte der Traumdeutung gelegt wird (Erinnerung an Träume, Häufigkeit, Interpretation, Kommunikation, Einfluss auf den Alltag). Dieser Abschnitt liefert die Grundlage für die anschließende Diskussion.
Schlüsselwörter
Traumdeutung, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, Empirische Forschung, Qualitative Inhaltsanalyse, Multivariate Statistik, Traumsymbolik, Alltagsgeschehen, Subjektive Bedeutung, historische Traumdeutungen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Subjektive Bedeutung von Träumen im Alltag
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die subjektive Bedeutung von Träumen im Alltagsgeschehen. Sie betrachtet psychologische und psychoanalytische Traumdeutungen im Licht der Neurowissenschaften und beleuchtet kontroverse Aspekte. Die Arbeit kombiniert empirische Forschung mit einer Auseinandersetzung mit historischen und theoretischen Ansätzen zur Traumdeutung.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die subjektive Bedeutung von Träumen im Alltag zu erforschen und psychoanalytische sowie neurophysiologische Perspektiven auf Träume zu konfrontieren. Sie untersucht die historische Entwicklung der Traumdeutung und analysiert empirische Daten mittels verschiedener Methoden.
Welche Methoden wurden in der empirischen Studie angewendet?
Die empirische Studie verwendet eine Kombination aus verschiedenen Methoden: Deskription und bivariate Inferenzstatistik zu geschlossenen Fragen, multivariate Clusteranalyse, multivariate Faktoranalyse und qualitative Inhaltsanalyse. Die Datenerhebung und -auswertung werden detailliert im Kapitel 3 beschrieben.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Problemstellung, Forschungsfragen, Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Verwendete Begriffe und theoretische Zugänge): Definition zentraler Begriffe, historische und theoretische Ansätze zur Traumdeutung (von Mesopotamien bis zu modernen Ansätzen). Kapitel 3 (Design und Methodik der empirischen Studie): Detaillierte Beschreibung der Methodik (Datenerhebung, -auswertung, Stichprobe). Kapitel 4 (Ergebnisse): Präsentation der Ergebnisse der empirischen Studie (deskritive Statistik, multivariate Analysen, qualitative Inhaltsanalyse), Interpretation der Ergebnisse bezüglich verschiedener Aspekte der Traumdeutung. Kapitel 5 (Resümee und Ausblick): Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 4 präsentiert und umfassen deskriptive Statistiken, Ergebnisse der bivariaten und multivariaten Analysen (Clusteranalyse, Faktoranalyse) sowie Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Analysen beleuchten verschiedene Aspekte der Traumdeutung wie Erinnerung an Träume, Häufigkeit, Interpretation, Kommunikation und Einfluss auf den Alltag. Die multivariate Clusteranalyse identifiziert drei Gruppen von Traumdeutern, und die Faktoranalyse zeigt vier wesentliche Einflüsse auf die Traumdeutung auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Traumdeutung, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, Empirische Forschung, Qualitative Inhaltsanalyse, Multivariate Statistik, Traumsymbolik, Alltagsgeschehen, Subjektive Bedeutung, historische Traumdeutungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Traumdeutung, Psychoanalyse, Neurowissenschaften und die subjektive Bedeutung von Träumen im Alltag interessieren.
- Quote paper
- Sefika Schwaiger (Author), 2016, Die subjektive Bedeutung von Träumen im Alltagsgeschehen. Psychologische und psychoanalytische Traumdeutungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367325