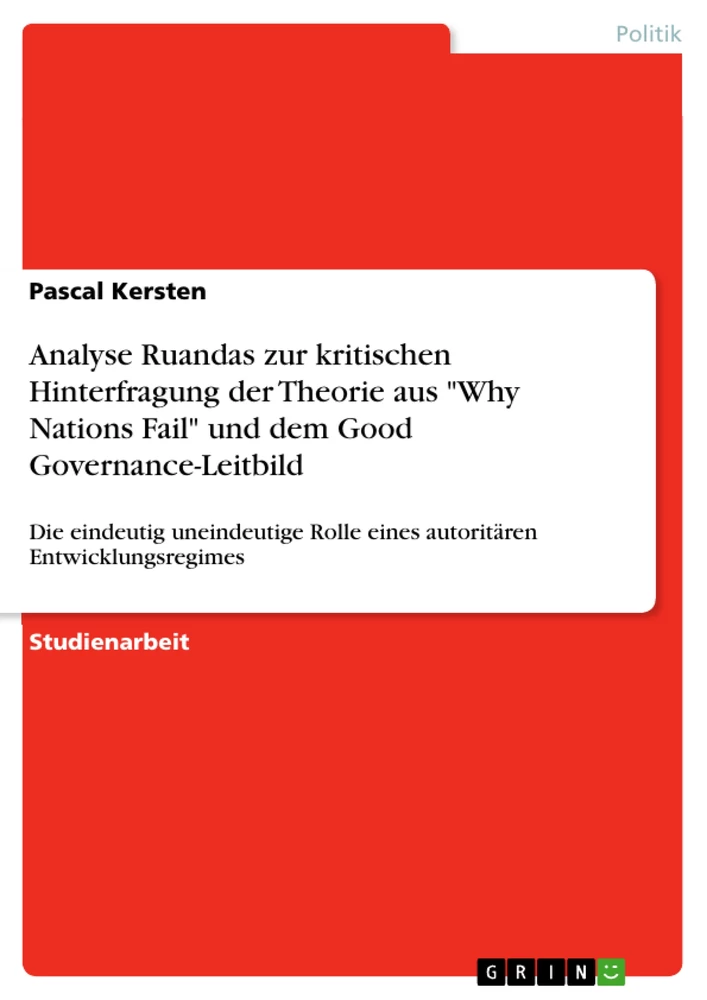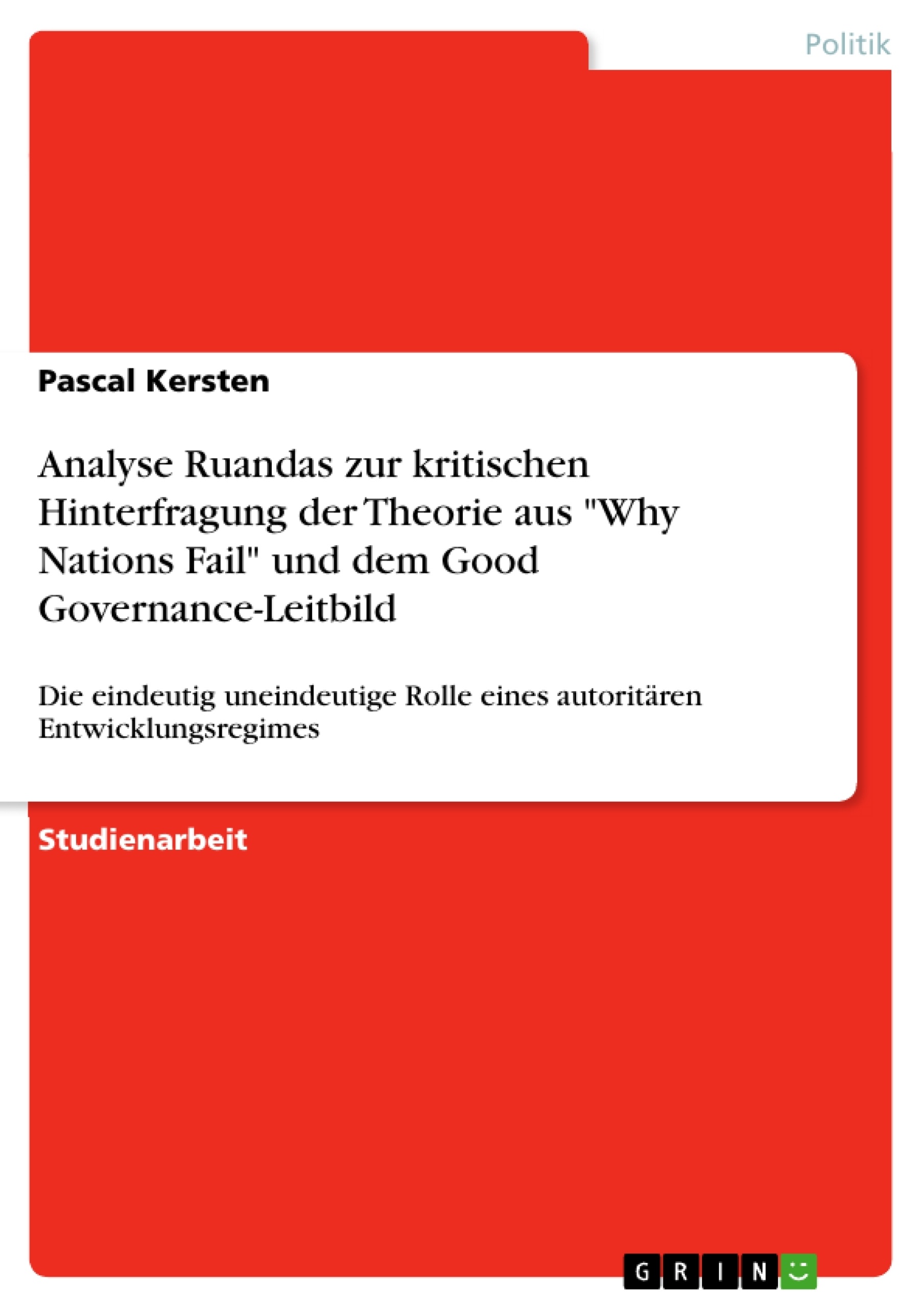Welche Substanz hat das entwicklungspolitische Paradigma namens Good Governance? Wie lassen sich normativ geprägte Analysekonzepte, wie etwa die Theorie aus „Why Nations Fail“ mit Entwicklungsmodellen von Ländern wie China, Singapur oder auch Ruanda in Einklang bringen? Was nutzt eigentlich die handlungsleitende Orientierung von entwicklungspolitischen Akteuren gemäß den Good Governance-Prinzipien in der realen Verbesserung der Lebensverhältnisse vieler Millionen Menschen auf der Welt? Diese Fragen bilden den Kontext für das Thema dieser Hausarbeit; nämlich der kritischen Betrachtung der Theorie aus Why Nations Fail von den beiden Wissenschaftlern Daron Acemoglu und James Robinson und der Good Governance-Konzeption, mittels einer Fallstudie über das ostafrikanische Land Ruanda.
Die Fragestellung lautet daher wie folgt: Warum trägt die Analyse Ruandas mittels der Theorie aus Why Nations Fail der kritischen Betrachtung des Good-Governance Leitbildes bei? Um diese Ausgangsfrage zu bearbeiten wird eine These aufgestellt, die im Verlaufe dieser Arbeit behandelt wird: Das Fallbeispiel Ruanda verdeutlicht, dass die autoritäre Rolle des Staates eine ambivalente und durchaus konstruktive Funktion in der Entwicklung des Landes zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen einnimmt.
Dieser Beitrag sollte eher als Impuls verstanden werden, statt als eine finale Aussage. Schließlich muss betont werden, dass die Demokratieförderung als solche in dieser Arbeit nicht näher analysiert werden soll, da sie innerhalb des Konzeptes aus Why Nations Fail intendiert ist und sich entsprechend an inklusiven Institutionen orientiert. Das Fallbeispiel Ruanda stellt insbesondere im Hinblick auf die westliche Sichtweise der Demokratieförderung einen interessanten Impuls zur Herausbildung alternativer Entwicklungsmodelle dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil
- Multiperspektivische Betrachtung der Good Governance-Konzeption
- Why Nations Fail
- Tugendkreis
- Teufelskreis
- Kritik an Why Nations Fail
- Parallelen und Unterschiede zwischen der Theorie aus Why Nations Fail und der Good Governance-Konzeption
- Empirischer Teil
- Good Governance in Ruanda
- Politikwissenschaftliche Legitimationsfragen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die Theorie aus "Why Nations Fail" und die Good Governance-Konzeption anhand einer Fallstudie über Ruanda. Die zentrale Frage ist, inwiefern die Analyse Ruandas mittels der Theorie aus "Why Nations Fail" zur kritischen Betrachtung des Good-Governance-Leitbildes beiträgt. Die Arbeit stellt die These auf, dass Ruandas autoritäre Regierungsführung eine ambivalente, aber konstruktive Rolle in der Entwicklung des Landes zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen spielt.
- Kritische Analyse der Good Governance-Konzeption und ihrer verschiedenen Perspektiven
- Präsentation und Bewertung der Theorie aus "Why Nations Fail"
- Fallstudie Ruanda: Analyse der Rolle des autoritären Staates in der Entwicklung
- Vergleich der Theorie aus "Why Nations Fail" mit der Good Governance-Konzeption im Kontext Ruandas
- Diskussion der politischen Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Beitrag der Analyse Ruandas zur kritischen Betrachtung der Good Governance-Konzeption und der Theorie aus "Why Nations Fail". Sie formuliert die These, dass Ruandas autoritäre Rolle eine ambivalente, aber konstruktive Funktion in der Entwicklung einnimmt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit – einen theoretischen und einen empirischen Teil – und begründet die Wahl Ruandas als Fallbeispiel aufgrund seiner bemerkenswerten wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Genozid im Kontext seines autoritären Regierungsstils. Die Arbeit betont ihren Impulscharakter und fokussiert sich nicht auf eine detaillierte Analyse der Demokratieförderung.
Theorieteil: Dieser Teil beginnt mit einer multiperspektivischen Betrachtung der Good Governance-Konzeption, die die unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven von Organisationen wie der Weltbank und der OECD beleuchtet. Anschließend wird die Theorie aus "Why Nations Fail" mit ihren Konzepten des Tugend- und Teufelskreises vorgestellt. Abschließend werden die Parallelen und Unterschiede zwischen der Good Governance-Konzeption und der Theorie aus "Why Nations Fail" herausgearbeitet, um ein fundiertes theoretisches Fundament für die spätere Fallstudienanalyse zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven und der Herausarbeitung ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen.
Empirischer Teil: Der empirische Teil analysiert Ruanda als Fallbeispiel im Kontext der Good Governance-Prinzipien und der Theorie aus "Why Nations Fail". Hier wird untersucht, inwieweit die autoritäre Regierungsführung Ruandas zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung und politischen Stabilisierung beigetragen hat. Dieser Abschnitt wird die ambivalente Rolle des Staates in der Entwicklung zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen beleuchten und die zentrale These der Arbeit anhand von empirischen Daten und Argumenten untermauern. Die politikwissenschaftlichen Legitimationsfragen im Kontext Ruandas werden ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Good Governance, Why Nations Fail, Ruanda, autoritäres Regime, inklusive und extraktive Institutionen, wirtschaftliche Entwicklung, politische Stabilität, Entwicklungszusammenarbeit, Fallstudie, entwicklungspolitisches Paradigma.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Analyse von Good Governance und "Why Nations Fail" am Beispiel Ruandas
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Theorie aus "Why Nations Fail" und die Good Governance-Konzeption anhand einer Fallstudie über Ruanda. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern trägt die Analyse Ruandas mittels der Theorie aus "Why Nations Fail" zur kritischen Betrachtung des Good-Governance-Leitbildes bei? Die Arbeit stellt die These auf, dass Ruandas autoritäre Regierungsführung eine ambivalente, aber konstruktive Rolle in der Entwicklung des Landes zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen spielt.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Good Governance-Konzeption aus multiperspektivischer Sicht, berücksichtigt verschiedene Ansätze von Organisationen wie Weltbank und OECD und behandelt detailliert die Theorie von "Why Nations Fail", einschließlich der Konzepte des Tugend- und Teufelskreises. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich und der Gegenüberstellung beider Theorien.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Fallstudienanalyse. Ruanda dient als Fallbeispiel, um die Theorien von "Why Nations Fail" und Good Governance zu überprüfen und deren Anwendbarkeit in einem konkreten Kontext zu untersuchen. Die Analyse beleuchtet die ambivalente Rolle des autoritären Staates in der Entwicklung Ruandas.
Warum wurde Ruanda als Fallbeispiel ausgewählt?
Ruanda wurde aufgrund seiner bemerkenswerten wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Genozid von 1994 im Kontext seines autoritären Regierungsstils ausgewählt. Die Wahl des Landes erlaubt es, die Theorien auf eine reale Situation mit spezifischen Herausforderungen und Erfolgen anzuwenden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Theorieteil, einen empirischen Teil und ein Fazit. Der Theorieteil analysiert die Good Governance-Konzeption und die Theorie aus "Why Nations Fail". Der empirische Teil konzentriert sich auf die Fallstudie Ruanda, untersucht die Rolle des autoritären Staates und die damit verbundenen politikwissenschaftlichen Legitimationsfragen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die These vor, während das Fazit die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Good Governance, Why Nations Fail, Ruanda, autoritäres Regime, inklusive und extraktive Institutionen, wirtschaftliche Entwicklung, politische Stabilität, Entwicklungszusammenarbeit, Fallstudie, entwicklungspolitisches Paradigma.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass Ruandas autoritäre Regierungsführung eine ambivalente, aber konstruktive Funktion in der wirtschaftlichen Entwicklung und politischen Stabilisierung des Landes spielt, indem sie zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen balanciert.
Welche Limitationen hat die Arbeit?
Die Arbeit betont ihren Impulscharakter und fokussiert sich nicht auf eine detaillierte Analyse der Demokratieförderung. Die Tiefe der Analyse ist durch den Rahmen der Arbeit begrenzt.
- Quote paper
- Pascal Kersten (Author), 2016, Analyse Ruandas zur kritischen Hinterfragung der Theorie aus "Why Nations Fail" und dem Good Governance-Leitbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366866