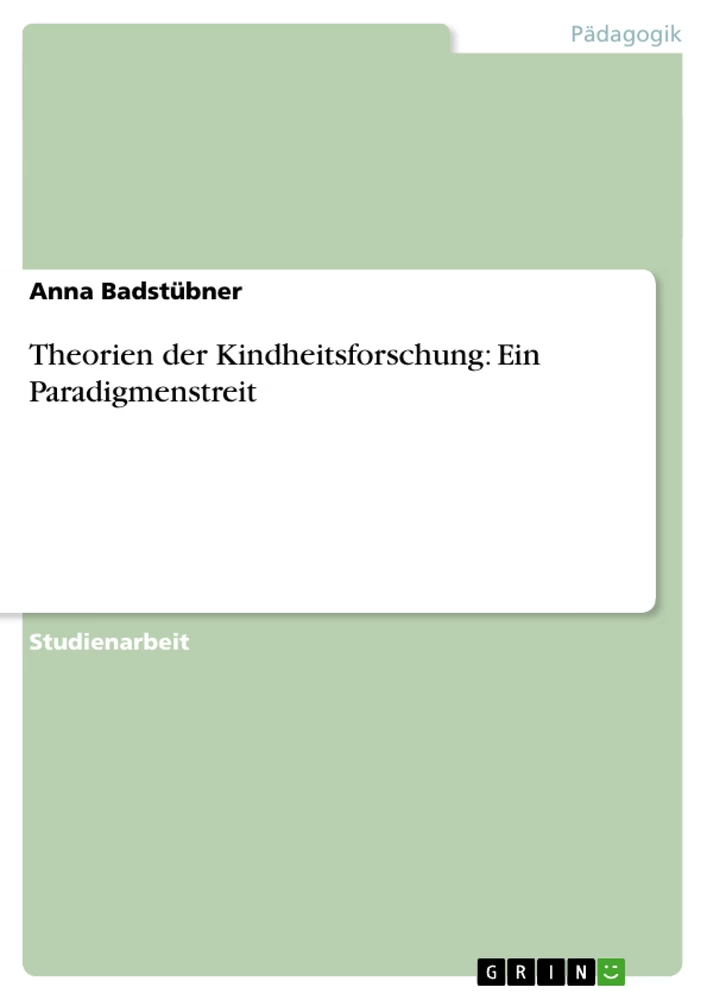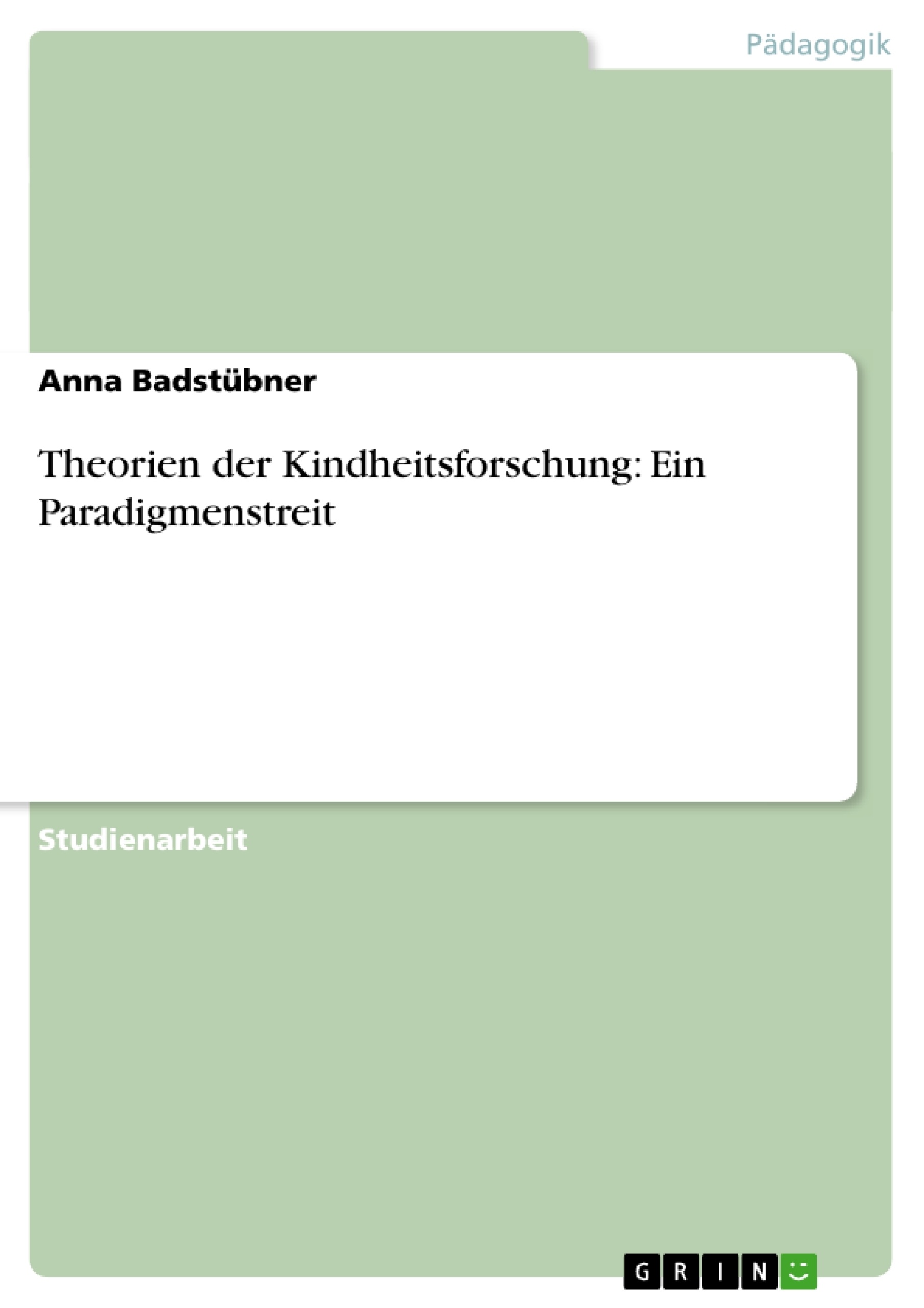Seit geraumer Zeit vollzieht sich in den Sozialwissenschaften und somit auch innerhalb der Kindheitsforschung ein Perspektivenwechsel (Honig, Leu & Nissen, 1996). Zinnecker (1996) spricht sogar von einer beständigen Entwertung älterer Konzepte durch neue Wissenschaftler, die innerhalb eines nicht enden wollenden Kreislaufs in rasendem Tempo andere Begrifflichkeiten und Erklärungsmodelle vorschlagen. Das Wissenschaftsfeld ist somit seines Erachtens von Kampf und Konkurrenz geprägt. Er betont jedoch auch, dass „neue Kinder und neue Kindheiten [...] auch neue Theorien und Forschungsdesigns“ verlangen (ebd, S.51). Die Wissenschaft muss sich daher ebenfalls den sozialen historischen und kulturellen Wandlungsprozessen anpassen, die Kindern neue Herausforderungen stellen (Mayall, 1996; Honig, Lange & Leu, 1999; Olk, 2003). Diese Annahme erklärt auch, warum in der neueren Literatur zur Kindheitsforschung immer deutlicher ein paradigmatischer Wechsel von der Pädagogik zur Soziologie erkennbar ist (Winkler, 2003), der nicht nur einen Erkenntnisfortschritt innerhalb der Wissenschaft reflektiert, sondern auch und vor allem „das Brüchig-Werden eines epochaltypischen Kindheitsmodells“ (Honig, Lange & Leu, 1999, S.13). Wie dieser sich konkret gestaltet, soll das Thema dieser Arbeit darstellen. Dafür wird zunächst die traditionelle Sicht auf Kinder beleuchtet, um sich dann der neueren Kindheitsforschung zuzuwenden. Am Schluss der Arbeit stehen ein Vergleich der Paradigmen und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die traditionelle Sichtweise auf Kinder und Kindheit
- 2.1 Grundlegende Annahmen
- 2.2 Kritik am Entwicklungs- und Sozialisationsparadigma
- 3. Die Soziologie der Kindheit
- 3.1 Grundannahmen der neueren Kindheitsforschung
- 3.2 Probleme und Kritik
- 4. Eine Gegenüberstellung
- 4.2 Tabellarischer Vergleich der (scheinbaren) Unterschiede
- 4.2 Gemeinsamkeiten
- 5. Ausblick und abschließende Bemerkungen
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Paradigmenwechsel in der Kindheitsforschung. Sie beleuchtet die traditionelle Sichtweise auf Kinder und Kindheit und setzt sie in Beziehung zur neueren Kindheitsforschung, die von der Soziologie geprägt ist. Die Arbeit analysiert kritisch die grundlegenden Annahmen beider Paradigmen und stellt sie gegenüber.
- Traditionsgebundene Konzepte von Kindheit im Kontext von Entwicklungspsychologie und Sozialisationsforschung
- Kritik an der erwachsenenzentrierten Sichtweise und dem Entwicklungs- und Sozialisationsparadigma
- Soziologische Perspektiven auf Kindheit und die Berücksichtigung des sozialen Kontextes
- Die Rolle der Familie und der Gesellschaft bei der Gestaltung von Kindheit
- Der Einfluss der Reformpädagogik auf das moderne Verständnis von Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Wandel in der Kindheitsforschung, der durch die Übernahme soziologischer Perspektiven gekennzeichnet ist. Kapitel 2 betrachtet die traditionelle Sichtweise auf Kinder und Kindheit, die auf Reifungs- und Wachstumsprozessen basiert. In diesem Kapitel werden die zentralen Annahmen der Entwicklungspsychologie und der Sozialisationsforschung erläutert und kritisch beleuchtet. Kapitel 3 befasst sich mit der neueren Kindheitsforschung, die die soziale Konstruktion von Kindheit betont. Hierbei werden die Grundannahmen der Soziologie der Kindheit und die damit verbundenen Kritikpunkte diskutiert.
Kapitel 4 bietet einen Vergleich der beiden Paradigmen, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden. Der Ausblick in Kapitel 5 reflektiert die zukünftige Entwicklung der Kindheitsforschung.
Schlüsselwörter
Kindheitsforschung, Entwicklungspsychologie, Sozialisation, Soziologie der Kindheit, Paradigmenwechsel, Kritik, Reformpädagogik, Adultismus, Kinderrechte, sozialer Kontext, Lebensbedingungen, Bedeutung des Kindes.
- Quote paper
- Anna Badstübner (Author), 2005, Theorien der Kindheitsforschung: Ein Paradigmenstreit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36685