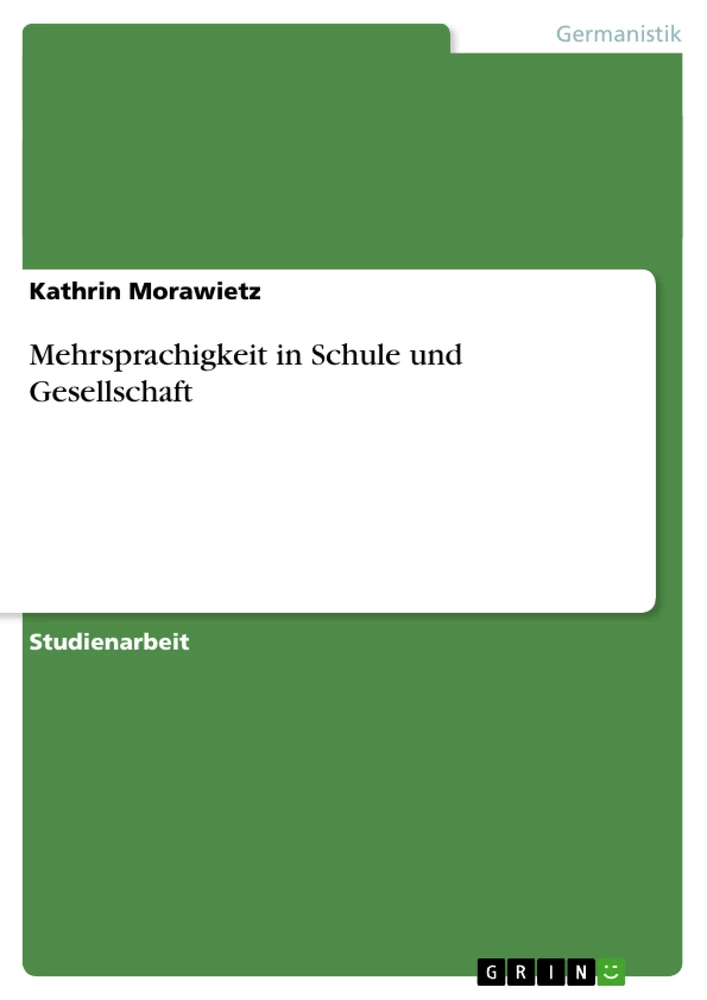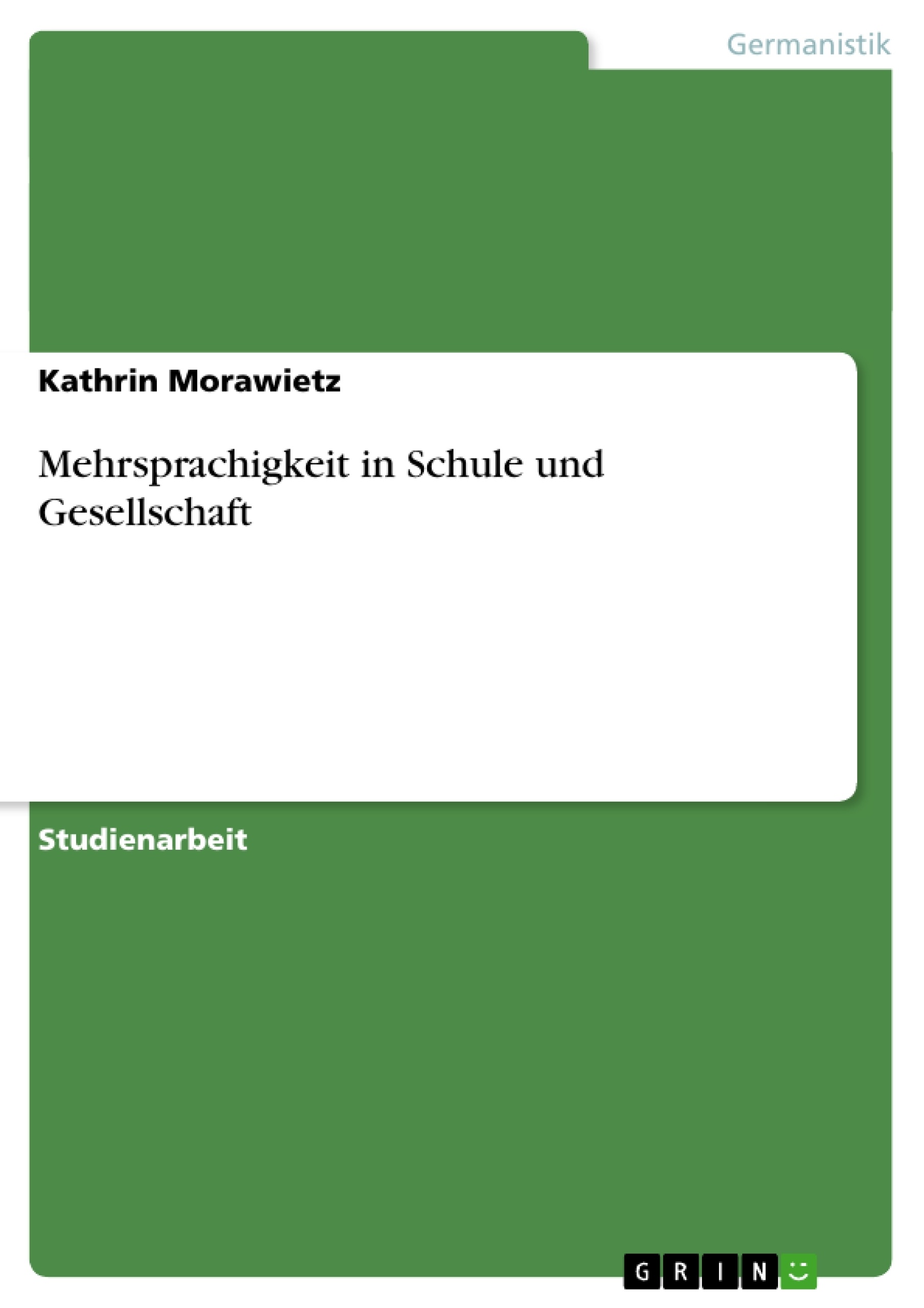Mehrsprachigkeit ist in der Schule nicht vorgesehen, sondern wird meist als Defizit aufgefasst. Einsprachigkeit stellt dagegen den normalen, wünschenswerten Zustand dar und lässt sich mit der Vorstellung eines sprachhomogenen Nationalstaates verbinden. Die Mehrsprachigkeit der Schüler wird oft auch dann ignoriert, wenn eine Klasse mehrheitlich von nichtdeutschen Schülern besucht wird. Die Schule orientiert sich am „allgemeinen Kind“1, das nicht zuge wandert, einsprachig und in einer sprachlich und kulturell homogenen Gesellschaft aufgewachsen ist.2 Der Sprachwissenschaftler Leo Weisgerber geht davon aus, dass Zweisprachigkeit Vorteile, aber auch Gefahren berge und deshalb der Elite vorbehalten sei, da nur sie die Vorteile nutzen könne, der Mensch jedoch einsprachig angelegt sei. Dabei verachtet Weisgerber die Tatsache, dass Mehrsprachigkeit die Regel, Einsprachigkeit dagegen die Ausnahme in unserer Gesellschaft darstellt. Weisgerbers Ansicht nach, prägt das muttersprachliche Weltbild die kulturelle Identität eines Menschen, deshalb sieht er eine Gefährdung im Zweitspracherwerb und ist von der Vorstellung überzeugt, dass die meisten Menschen Zweitsprachigkeit nicht verkraften können. Es gibt vielfältige Gründe dafür, warum Kinder eine andere Sprache sprechen: die Eltern sprechen eine andere Sprache als die La ndessprache und die Muttersprache der Kinder stellt somit eine Minderheitensprache dar; die Elternteile sprechen ve rschiedene Sprachen (Mischehen); die Eltern lebten mit ihren Kindern zeitweise im Ausland, wo die Kinder Europa- oder Auslandsschulen besuchten; das Land ist offiziell zweisprachig und bietet Schulen an, an denen beide Landessprachen gelernt werden können (Kanada: Englisch / Französisch; Finnland: Finnisch / Schwedisch). Verschiedene Sprachen besitzen in unserer Gesellschaft einen unterschiedlichen Status. An erster Stelle (höchster Status) steht die Mehrheitssprache Deutsch, gefolgt von den prestigeträchtigen Schulfremdsprachen Englisch und Französisch sowie Herkunftssprachen, die als Begegnungssprachen angeboten werden. Das Schlusslicht bilden Minderheitensprachen
wie kurdisch oder albanisch. [...] 1 Vgl. Neumann, Ursula / Wilkens, Gabriela S.: Multikulturalität und Mehrsprachigkeit als Lernbedingungen im Literaturunterricht. In: Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.): Grundzüge der Literaturdidaktik, 2001, S.80. 2 Vgl. Neumann / Wilkens, 2001, S.78ff.
Inhaltsverzeichnis
- Mehrsprachigkeit in Gesellschaft und Schule
- Restringierter und elaborierter Code
- Individuelle Zweisprachigkeit
- Zweisprachigkeit und Identitätsentwicklung
- Didaktische Ansätze
- Der kommunikative Ansatz
- Der interkulturelle Ansatz
- Der bilinguale Ansatz
- Typologie von Schulmodellen
- Grundtypen von Schulmodellen
- Segregation
- Sprachschutzprogramme (Maintenance- oder Language Shelter)
- Submersion in multinationalen Regelklassen
- Immersion
- Zusammengesetzte Klassen
- Muttersprachlicher Unterricht
- Kritik am Muttersprachlichen Unterricht
- Muttersprachliche Lehrkräfte
- Anforderungen an den Muttersprachlichen Unterricht
- Konzepte im Ausland
- Modelle Interkultureller Erziehung
- Fehleranalyse: Interlanguage vs. Fossilierungen
- Zum Einsatz von Sprachbüchern
- Sprachspiele und Spracherwerb
- Formen und Funktionen des kindlichen Sprachspiels
- Witze im Kontext des kindlichen Sprachspiels
- Sprachspiele in mehrsprachigen Lerngruppen
- Interaktions- und Gesellschaftsspiele
- Integrativer Sprach- und Literaturunterricht
- Schrifterwerb in zwei Sprachen
- Typische Erscheinungen beim Erwerb der Schriftsprache Deutsch
- Koordination des Sprach- und Schrifterwerbs im Anfangsunterricht
- Beispiele für einen koordinierten Anfangsunterricht
- Sprachspiele im Anfangsunterricht
- Grammatikunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen
- Implizite vs. explizite Grammatik
- Sprachbewusstheit
- Sprachspiele im Grammatikunterricht
- Situatives vs. systematisches Lernen
- Schwerpunkte des Grammatikunterrichts
- Literaturunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen
- Textproduktion in mehrsprachigen Lerngruppen
- Lehr- und Lernbarkeit des Schreibens
- Umgang mit Rechtschreibfehlern
- Innersprachliche Mehrsprachigkeit
- Zum Varietätenerwerb von Migrantenkindern
- Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität
- Idiomatische Wendungen
- Schwierigkeiten beim Erwerb einer zweisprachigen Idiomatik
- Nonverbale Kommunikation
- Zukünftige Anforderungen an den Unterricht in mehrsprachigen Lerngruppen
- Anforderungen an Lehrkräfte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Mehrsprachigkeit in der Schule und untersucht die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Sprachvielfalt in Bildungseinrichtungen ergeben. Dabei werden verschiedene didaktische Ansätze und Schulmodelle sowie die Rolle der Sprachspiele im Spracherwerb beleuchtet. Im Fokus steht die Frage, wie der Unterricht in mehrsprachigen Lerngruppen gestaltet werden kann, um eine optimale Förderung aller Schüler zu gewährleisten.
- Didaktische Ansätze für Mehrsprachigkeit in der Schule
- Typologie und Grundtypen von Schulmodellen
- Sprachspiele als Werkzeug für den Spracherwerb
- Schrifterwerb und Grammatikunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen
- Herausforderungen und zukünftige Anforderungen an den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Mehrsprachigkeit in Gesellschaft und Schule. Es werden verschiedene Formen der Zweisprachigkeit und ihre Bedeutung für die Identitätsentwicklung beleuchtet. Des Weiteren wird der Unterschied zwischen restringiertem und elaboriertem Code erläutert und die Defizit- und Differenz-Hypothese diskutiert.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene didaktische Ansätze für den Unterricht in mehrsprachigen Lerngruppen vorgestellt, darunter der kommunikative, der interkulturelle und der bilinguale Ansatz. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Typologie von Schulmodellen, während das vierte Kapitel verschiedene Grundtypen von Schulmodellen, wie z.B. Segregation, Sprachschutzprogramme und Immersion, beschreibt.
Das fünfte Kapitel behandelt Modelle interkultureller Erziehung, während das sechste Kapitel die Fehleranalyse in der Sprachvermittlung, insbesondere den Unterschied zwischen Interlanguage und Fossilierungen, beleuchtet. Im siebten Kapitel werden die Einsatzmöglichkeiten von Sprachbüchern in mehrsprachigen Lerngruppen diskutiert.
Das achte Kapitel widmet sich dem Thema Sprachspiele und Spracherwerb. Es werden verschiedene Formen und Funktionen des kindlichen Sprachspiels sowie die Nutzung von Sprachspielen in mehrsprachigen Lerngruppen untersucht.
Die Kapitel neun bis elf behandeln den integrativen Sprach- und Literaturunterricht, den Schrifterwerb in zwei Sprachen und den Grammatikunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen.
Kapitel zwölf und dreizehn konzentrieren sich auf den Literaturunterricht und die Textproduktion in mehrsprachigen Lerngruppen. Das vierzehnte Kapitel beschäftigt sich mit der innersprachlichen Mehrsprachigkeit, insbesondere dem Varietätenerwerb von Migrantenkindern.
Das fünfzehnte Kapitel befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität, wobei insbesondere idiomatische Wendungen und nonverbale Kommunikation betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit, didaktische Ansätze, Schulmodelle, Sprachspiele, Spracherwerb, Schrifterwerb, Grammatikunterricht, Literaturunterricht, Textproduktion, interkulturelle Erziehung, Fehleranalyse, Migranten, und die Herausforderungen für den Unterricht in mehrsprachigen Lerngruppen.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Morawietz (Autor:in), 2005, Mehrsprachigkeit in Schule und Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36678