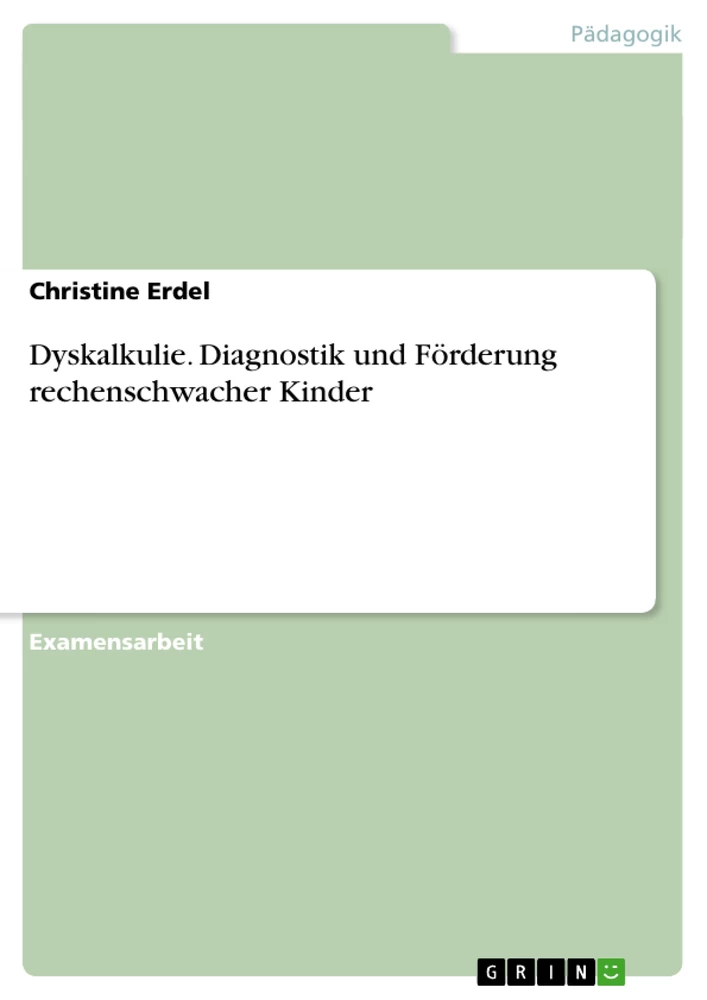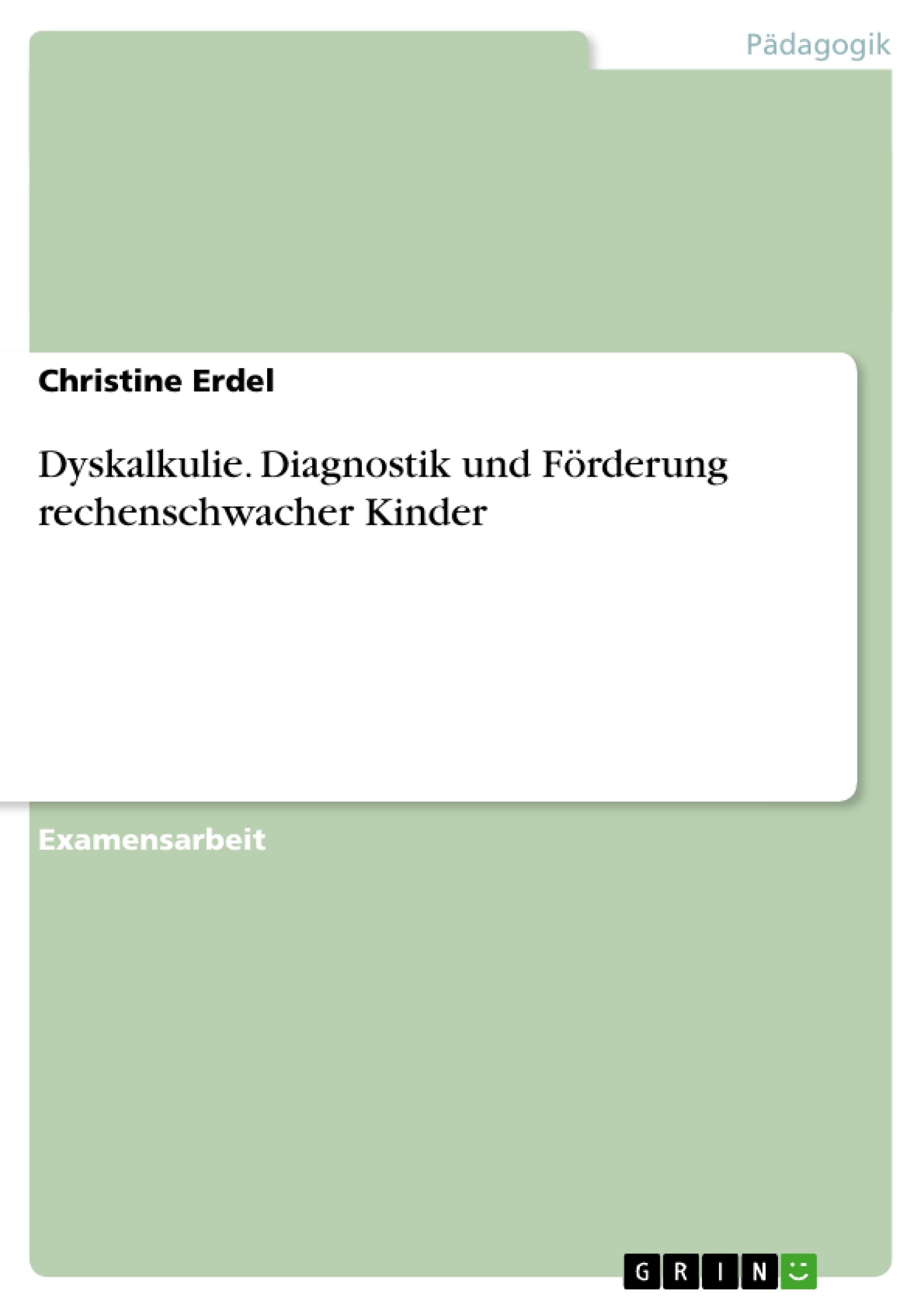Ebenso wie Lesen und Schreiben, ist auch das Rechnen eine grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn und wichtig für die spätere Berufswahl. Die Grundrechenarten müssen beherrscht werden und ein Verständnis für Rechenoperationen muss entwickelt sein.
Die Lese-Rechtschreibschwäche ist schon lange als Problemfeld bekannt, die Schwierigkeiten und Probleme beim Erlernen des Rechnens sind dagegen erst seit den 80er Jahren ins Blickfeld von Wissenschaftlern und Schulpraktikern gerückt. „Dyskalkulie“, „Rechenschwäche“, „Rechenstörung“ – die Anzahl der Begrifflichkeiten, die in der Literatur zu diesem Thema auftauchen, sind beinahe ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen dieser Störung. Eines ist jedoch allen gemeinsam: Manche Kinder haben von Beginn an ganz besondere Probleme beim Erlernen grundlegender mathematischer Operationen, die nicht ad hoc erklärbar sind.
In dieser Zulassungsarbeit werden die Begriffe „Dyskalkulie“, „Rechenschwäche“ und „Rechenstörung“ synonym verwendet.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst auf den Begriff „Dyskalkulie“ näher eingegangen. Es wird der Versuch einer Definition gemacht, wobei verschiedene Begriffsmöglichkeiten vorgestellt werden. Anschließend werden die typischen Merkmale der Dyskalkulie erläutert.
Im zweiten Teil wird ein Überblick über die denk- und lernpsychologischen Grundlagen des Rechnens gegeben. Dieser erstreckt sich von den neuropsychologischen Voraussetzungen über das Entwicklungsmodell von Ayres bis hin zu den Modellen von Piaget und Aebli.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen der Dyskalkulie. Individuumsbezogene, soziokulturelle und familiäre und schulische Ursachen werden hier näher beschrieben.
Der vierte Teil widmet sich der Diagnostik. Es wird sowohl auf die Diagnostik im basalen als auch im pränumerischen Bereich eingegangen. Die weiteren Unterkapitel informieren über die Fehleranalyse und informelle und formelle Testverfahren.
Im fünften Kapitel steht die Förderung rechenschwacher Kinder im Mittelpunkt. Zunächst werden einige präventive Maßnahmen vorgestellt, bevor es dann um die konkrete Intervention geht. Abschließend wird noch kurz auf die juristischen Aspekte zur Förderung in Bayern eingegangen.
Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Begrifflichkeit und Phänomen
- Der Begriff „Rechenschwäche” / „Dyskalkulie”
- Der Terminus „Dyskalkulie”
- Verschiedene Definitionen
- Grissemanns „Diskrepanzdefinitionen”
- Grundformen der Rechenschwäche
- Primäre und sekundäre Dyskalkulie
- Erscheinungsformen der Rechenschwäche
- Probleme bei der Sinneswahrnehmung
- Häufige Wahrnehmungsstörungen
- Defizite in den kognitiven Fähigkeiten
- Typische Rechenprobleme
- Wie rechnet das Kind?
- Verhaltensauffälligkeiten
- Denk- und lernpsychologische Grundlagen des Rechnens
- Neuropsychologische Voraussetzungen für mathematisches Denken
- Das Entwicklungsmodell nach Ayres
- Entwicklung des operatorischen Denkens nach Piaget
- Aeblis mathematische Operationstheorie
- Ursachen für Rechenstörungen
- Teilleistungsschwächen
- Individuumsbezogene Ursachen
- Kongenitale Ursachen
- Neuropsychologische Ursachen
- Psychische Komponenten
- Soziokulturelle und familiäre Ursachen
- Schulische Ursachen
- Diagnostik
- Aspekte der Diagnostik im basalen Bereich
- Diagnostik im pränumerischen Bereich
- Fehleranalyse
- Informelle Diagnostik des Leistungsstandes
- Formelle Testverfahren
- Förderung von Kindern mit Rechenschwäche
- Prävention
- Vom zählenden Rechnen zur Abrufbarkeit der Basisfakten
- Fallbeispiel
- Hängen bleiben am zählenden Rechnen
- Strukturgelenktes Rechnen
- Rechenausdrücke als Handlungsanweisungen und als Namen für mathematische Objekte
- Hinweise zum methodischen Vorgehen
- Rechnen erlebt
- Addition und Subtraktion
- Multiplikation und Division
- Edukinestetik im Unterricht
- Intervention
- Fallbeispiel
- Beratung des Umfelds
- Beratungsgrundsätze
- Beratung von Lehrern
- Beratung von Eltern
- Grenzen der Beratung
- Private Institute: A.L.F. e.V. in Nürnberg
- Die Elterninitiative IFRK e.V.
- Juristische Aspekte zur Förderung in Bayern
- Unterstützung außerhalb der Schule
- Schulrechtliche Gesichtspunkte
- Zusammenfassung
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Dyskalkulie”
- Erscheinungsformen der Rechenschwäche und ihre Ursachen
- Diagnostik und Förderungsmöglichkeiten für Kinder mit Dyskalkulie
- Rechtliche Aspekte der Förderung in Bayern
- Aktuelle Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Dyskalkulie und untersucht die verschiedenen Aspekte dieser Rechenstörung. Der Fokus liegt dabei auf der Definition, den Erscheinungsformen, den Ursachen und der Förderung von Kindern mit Rechenschwäche.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt den Begriff „Dyskalkulie” und untersucht verschiedene Definitionen sowie die Erscheinungsformen der Rechenschwäche. Kapitel 2 beleuchtet die denk- und lernpsychologischen Grundlagen des Rechnens, insbesondere die neuropsychologischen Voraussetzungen und verschiedene Entwicklungstheorien. Kapitel 3 widmet sich den Ursachen von Rechenstörungen, wobei Teilleistungsschwächen, individuumsbezogene, soziokulturelle und schulische Faktoren betrachtet werden. Kapitel 4 befasst sich mit der Diagnostik von Dyskalkulie, inklusive verschiedener Methoden und Testverfahren. Kapitel 5 behandelt die Förderung von Kindern mit Rechenschwäche, wobei Präventionsmaßnahmen und Interventionsmöglichkeiten im Detail beleuchtet werden. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Mathematiklernen, Rechenstörungen, Diagnostik, Förderung, Prävention, Intervention, Teilleistungsschwächen, neuropsychologische Grundlagen, Entwicklungstheorien, Ursachen, Schulische und familiäre Einflüsse, Rechtliche Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Christine Erdel (Author), 2004, Dyskalkulie. Diagnostik und Förderung rechenschwacher Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36566