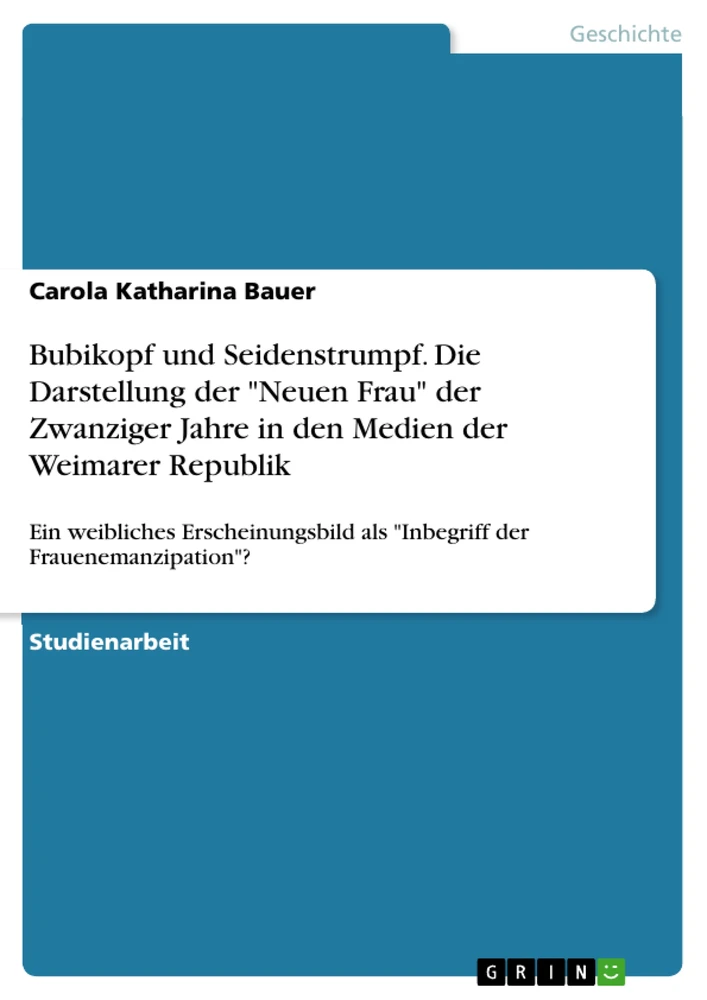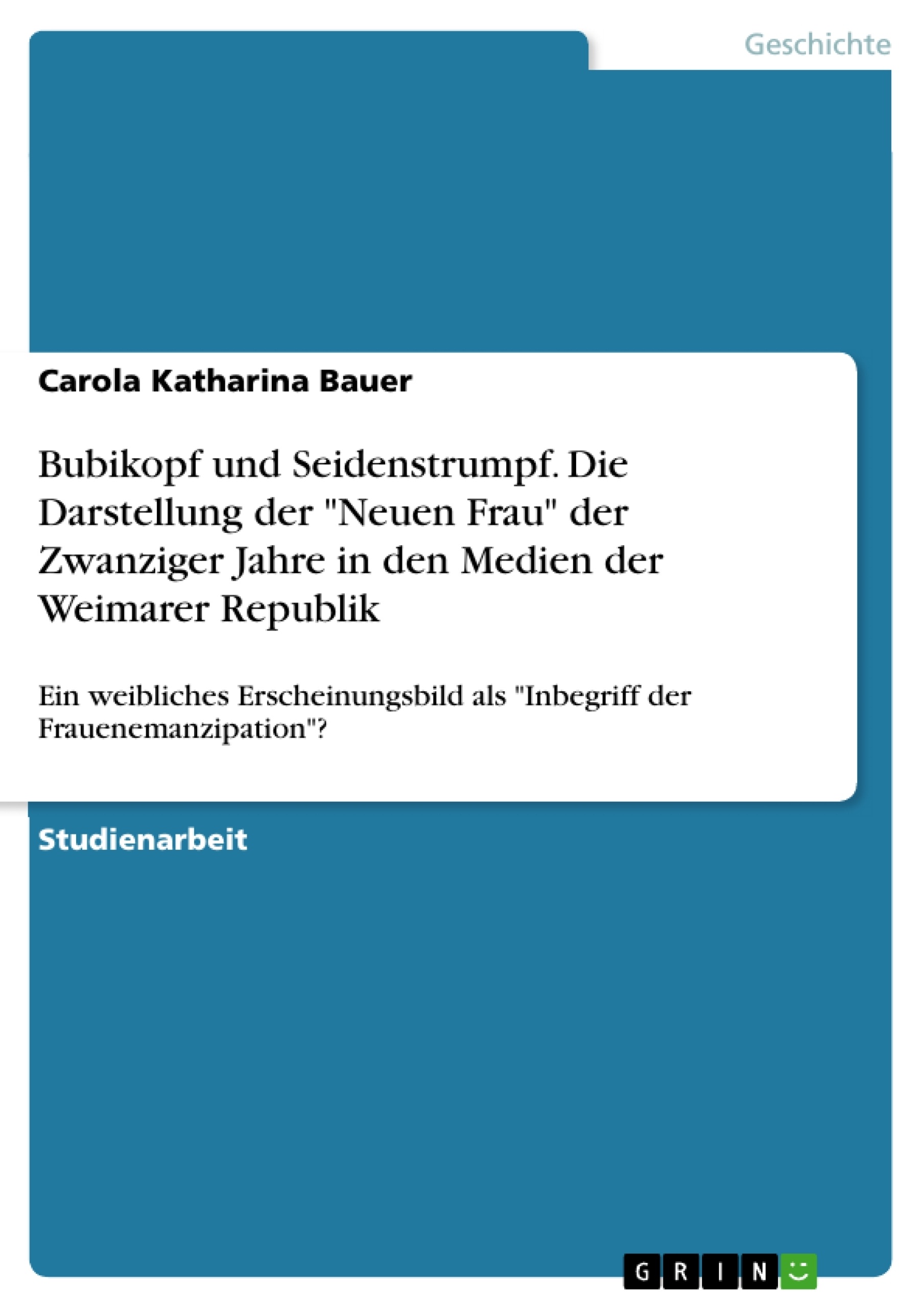Ausgehend von der Annahme, dass Mode immer auch mit bestimmten Bedeutungszuschreibungen versehen wird, werde ich mich in meiner Seminararbeit mit dem modischen weiblichen Erscheinungsbild der Weimarer Republik in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigen.
Nach einer genauen Beschreibung der Veränderungen in der Frauenmode und dem damit verbundenen neuen weiblichen Körperideal wird die Darstellung der ‚Neuen Frau’ in den Medien der Weimarer Republik im ersten Teil meiner Ausführungen im Vordergrund stehen. Dabei soll untersucht werden, wie das neue modische Erscheinungsbild in den Filmen, den Illustrierten, der Belletristik und der zeitgenössischen, wissenschaftlichen Fachliteratur medial konstruiert wurde.
Im zweiten Teil meiner Seminararbeit werde ich ‚Neuland betreten’ und mich einem von der Forschung bisher vernachlässigten Gebiet widmen: Anhand von Beiträgen aus den satirischen und humoristischen Blättern der Weimarer Republik soll die Untersuchung der Darstellung der ‚Neuen Frauen’ in den zeitgenössischen Karikaturen den Hauptteil der Seminararbeit ausmachen.
Insgesamt möchte ich anhand einer umfassenden Analyse der medialen Präsentation des neuen Mode- und Körperideals zeigen, dass das veränderte Aussehen der Bürgerinnen der Weimarer Republik zu einer Art Projektionsfläche wurde und man dieses – in Anbetracht der in der neuen Verfassung verankerten, gesetzlichen Gleichstellung der Geschlechter – als „Inbegriff der ... Frauenemanzipation“ mit einem neuen Selbstverständnis und veränderten Verhaltensweisen der Frauen in Verbindung brachte – im negativen wie im positiven Sinne.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung. Aufgabenstellung und Leitfragen
- 2. Das Erscheinungsbild der ‚Neuen Frau’ in der Weimarer Republik der Zwanziger Jahre – Darstellung in den Medien
- 2.1. Bubikopf und kurze Röcke: Die Veränderungen der Frauenmode in den Zwanzigern und die Entwicklung eines neuen Körperideals
- 2.2. Die Darstellung der ‚Neuen Frau’ in der Presse, der Belletristik, den Filmen und der wissenschaftlichen Literatur der Weimarer Republik
- a) Die ‚Neue Frau’ in der zeitgenössischen Presse unter besonderer Berücksichtigung der Frauen- und Modezeitschriften
- b) Die ‚Neue Frau’ in der Kunst: Belletristik und Film
- c) Die ‚Neue Frau’ in der Kritik: Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur und dem Sammelband Die Frau von Morgen, wie wir sie wünschen
- 3. Gesonderte Untersuchung der Darstellung der ‚Neuen Frau’ in der zeitgenössischen Karikatur
- 4. Resümee und Ausblick. „Haarschnitt ist noch nicht Freiheit.“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das modische Erscheinungsbild der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik der 1920er Jahre. Ziel ist es, die mediale Konstruktion dieses Bildes zu analysieren und dessen Verbindung zu den emanzipatorischen Konzepten der Zeit zu beleuchten. Dabei wird der Fokus sowohl auf positive als auch negative Konnotationen gelegt, die mit dem veränderten weiblichen Selbstverständnis assoziiert wurden.
- Veränderungen in der Frauenmode der 1920er Jahre und die Entwicklung eines neuen Körperideals
- Mediale Darstellung der „Neuen Frau“ in Presse, Belletristik, Film und wissenschaftlicher Literatur
- Darstellung der „Neuen Frau“ in der zeitgenössischen Karikatur
- Vergleich der medialen Präsentation mit der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Frauen
- Die Ambivalenz des neuen Frauenbildes zwischen Emanzipation und traditionellen Rollenbildern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung. Aufgabenstellung und Leitfragen: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des modischen weiblichen Erscheinungsbildes der 1920er Jahre in der Weimarer Republik und dessen Zusammenhang mit der Frauenemanzipation. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in eine Analyse der Veränderungen in der Frauenmode und eine detaillierte Untersuchung der medialen Darstellung der „Neuen Frau“, einschließlich der Karikaturen, gliedert. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse, um das veränderte Aussehen der Frauen als Projektionsfläche gesellschaftlicher Veränderungen zu verstehen.
2. Das Erscheinungsbild der ‚Neuen Frau’ in der Weimarer Republik der Zwanziger Jahre – Darstellung in den Medien: Dieses Kapitel beschreibt die radikale Veränderung der Frauenmode in den 1920er Jahren. Es analysiert den Wandel von korsettierten, unpraktischen Kleidern hin zu taillenlosen, geradlinigen und funktionalen Kleidungsstücken, kurzen Röcken und dem Bubikopf. Die Übernahme männlich konnotierter Elemente in der Frauenmode wird hervorgehoben. Das Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen dem neuen, knabenhaften Körperideal und dem wachsenden Interesse an Diäten und Frauensport. Es betont aber auch die Kontinuität zu früheren Kleidungsreformbewegungen, wobei der Fokus auf der Demokratisierung der Mode durch Massenproduktion und die damit einhergehende öffentliche Diskussion liegt.
2.1. Bubikopf und kurze Röcke: Die Veränderungen der Frauenmode in den Zwanzigern und die Entwicklung eines neuen Körperideals: Dieser Abschnitt detailliert die konkreten Veränderungen in der Frauenmode der 1920er Jahre. Er beschreibt den Übergang von den traditionellen, figurbetonten Kleidern zu den geradlinigen, praktischen und funktionalen Kleidungsstücken, die die weiblichen Formen nicht mehr betonen, sondern kaschieren. Die Einführung des Bubikopfes und des kurzen Rockes werden im Kontext der sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen analysiert, ebenso wie die Bedeutung von Coco Chanel und Paul Poiret für den Modestill. Der Abschnitt beleuchtet das neue, knabenhafte Körperideal und dessen Auswirkungen auf das Schönheitsempfinden der Zeit.
2.2. Die Darstellung der ‚Neuen Frau’ in der Presse, der Belletristik, den Filmen und der wissenschaftlichen Literatur der Weimarer Republik: Dieser Abschnitt analysiert die vielschichtigen medialen Darstellungen der „Neuen Frau“. Er untersucht die Rolle von Mode- und Frauenzeitschriften, die das neue Frauenbild mit Bildern und Texten konstruierten. Die Verknüpfung des neuen Erscheinungsbildes mit der weiblichen Selbstständigkeit und dem Vordringen in traditionell männliche Domänen wird beleuchtet. Der Abschnitt untersucht die verschiedenen medialen Präsentationen in Film und Belletristik, mit einem Fokus auf die literarische Darstellung in Romanen von weiblichen Autorinnen. Er unterscheidet dabei zwischen den Typen der „Garçonne“ und des „Girls“ und analysiert die spezifischen Konnotationen, die mit diesen Typen verbunden waren.
3. Gesonderte Untersuchung der Darstellung der ‚Neuen Frau’ in der zeitgenössischen Karikatur: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der „Neuen Frau“ in der zeitgenössischen Karikatur der Weimarer Republik. Es hebt die satirischen und humoristischen Blätter hervor, die das neue Frauenbild mit den Mitteln der Übertreibung und Verzerrung behandelten. Das Kapitel unterscheidet zwischen zwei Haupttypen der karikaturistischen Darstellung: die androgyne „Garçonne“ und das amerikanisch geprägte „Girl“. Es analysiert die jeweiligen Konnotationen und die in den Karikaturen zum Ausdruck kommenden Vorurteile und gesellschaftlichen Ängste gegenüber den emanzipatorischen Bestrebungen der Frauen.
Schlüsselwörter
Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenmode, Bubikopf, kurze Röcke, Körperideal, Medien, Belletristik, Film, Karikatur, Emanzipation, Geschlechterrollen, Modejournalismus, Garçonne, Girl, Sexualität, Gesellschaftlicher Wandel, Medialisierung des Alltags, Konstitutionsbiologie.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Das Erscheinungsbild der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das modische Erscheinungsbild der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik der 1920er Jahre und analysiert die mediale Konstruktion dieses Bildes in Verbindung mit den emanzipatorischen Konzepten der Zeit. Es werden sowohl positive als auch negative Konnotationen des veränderten weiblichen Selbstverständnisses beleuchtet.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Medien, um das Bild der „Neuen Frau“ zu rekonstruieren. Dazu gehören die Presse (insbesondere Frauen- und Modezeitschriften), Belletristik, Filme, wissenschaftliche Literatur und zeitgenössische Karikaturen. Die Arbeit bezieht sich auch auf den Sammelband "Die Frau von Morgen, wie wir sie wünschen".
Welche Aspekte der „Neuen Frau“ werden untersucht?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Veränderungen in der Frauenmode der 1920er Jahre (Bubikopf, kurze Röcke), die Entwicklung eines neuen Körperideals, die mediale Darstellung in verschiedenen Medien, die Darstellung in der Karikatur und den Vergleich der medialen Präsentation mit der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Frauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ambivalenz des neuen Frauenbildes zwischen Emanzipation und traditionellen Rollenbildern.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Aufgabenstellung und Leitfragen, ein Kapitel zur Darstellung der „Neuen Frau“ in den Medien (inkl. Unterkapiteln zu Mode, Presse, Belletristik, Film und wissenschaftlicher Literatur), ein Kapitel zur Darstellung in der zeitgenössischen Karikatur und abschließend ein Resümee mit Ausblick.
Wie wird die Frauenmode der 1920er Jahre beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den radikalen Wandel der Frauenmode von korsettierten Kleidern zu taillenlosen, geradlinigen und funktionalen Kleidungsstücken, kurzen Röcken und dem Bubikopf. Die Übernahme männlich konnotierter Elemente und der Zusammenhang mit Diäten und Frauensport werden analysiert. Die Bedeutung von Coco Chanel und Paul Poiret wird ebenfalls erwähnt.
Welche Rolle spielen die Medien in der Konstruktion des Bildes der „Neuen Frau“?
Die Medien spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie Mode- und Frauenzeitschriften, Belletristik, Film und wissenschaftliche Literatur das neue Frauenbild konstruierten und die Verknüpfung des neuen Erscheinungsbildes mit weiblicher Selbstständigkeit und dem Vordringen in traditionell männliche Domänen darstellen. Die Arbeit unterscheidet zwischen den Typen der „Garçonne“ und des „Girls“ und analysiert die damit verbundenen Konnotationen.
Wie werden Karikaturen in die Analyse einbezogen?
Die Karikaturen werden als wichtige Quelle betrachtet, um die satirischen und humoristischen Aspekte des neuen Frauenbildes zu analysieren. Die Arbeit unterscheidet zwischen der androgynen „Garçonne“ und dem amerikanischen „Girl“ und untersucht die in den Karikaturen zum Ausdruck kommenden Vorurteile und gesellschaftlichen Ängste.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neue Frau, Weimarer Republik, Frauenmode, Bubikopf, kurze Röcke, Körperideal, Medien, Belletristik, Film, Karikatur, Emanzipation, Geschlechterrollen, Modejournalismus, Garçonne, Girl, Sexualität, Gesellschaftlicher Wandel, Medialisierung des Alltags, Konstitutionsbiologie.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Bedeutung hatte das modische weibliche Erscheinungsbild der 1920er Jahre in der Weimarer Republik und wie steht es im Zusammenhang mit der Frauenemanzipation?
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen. Ein zentrales Thema ist die Ambivalenz des neuen Frauenbildes: Der "Haarschnitt ist noch nicht Freiheit".
- Quote paper
- Carola Katharina Bauer (Author), 2007, Bubikopf und Seidenstrumpf. Die Darstellung der "Neuen Frau" der Zwanziger Jahre in den Medien der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365549