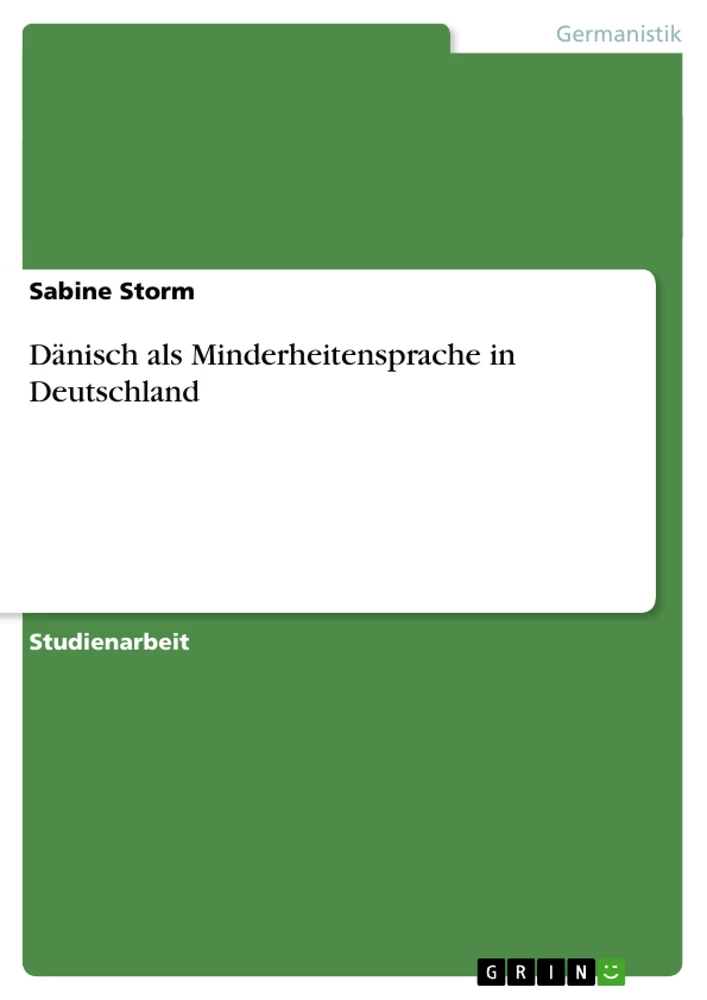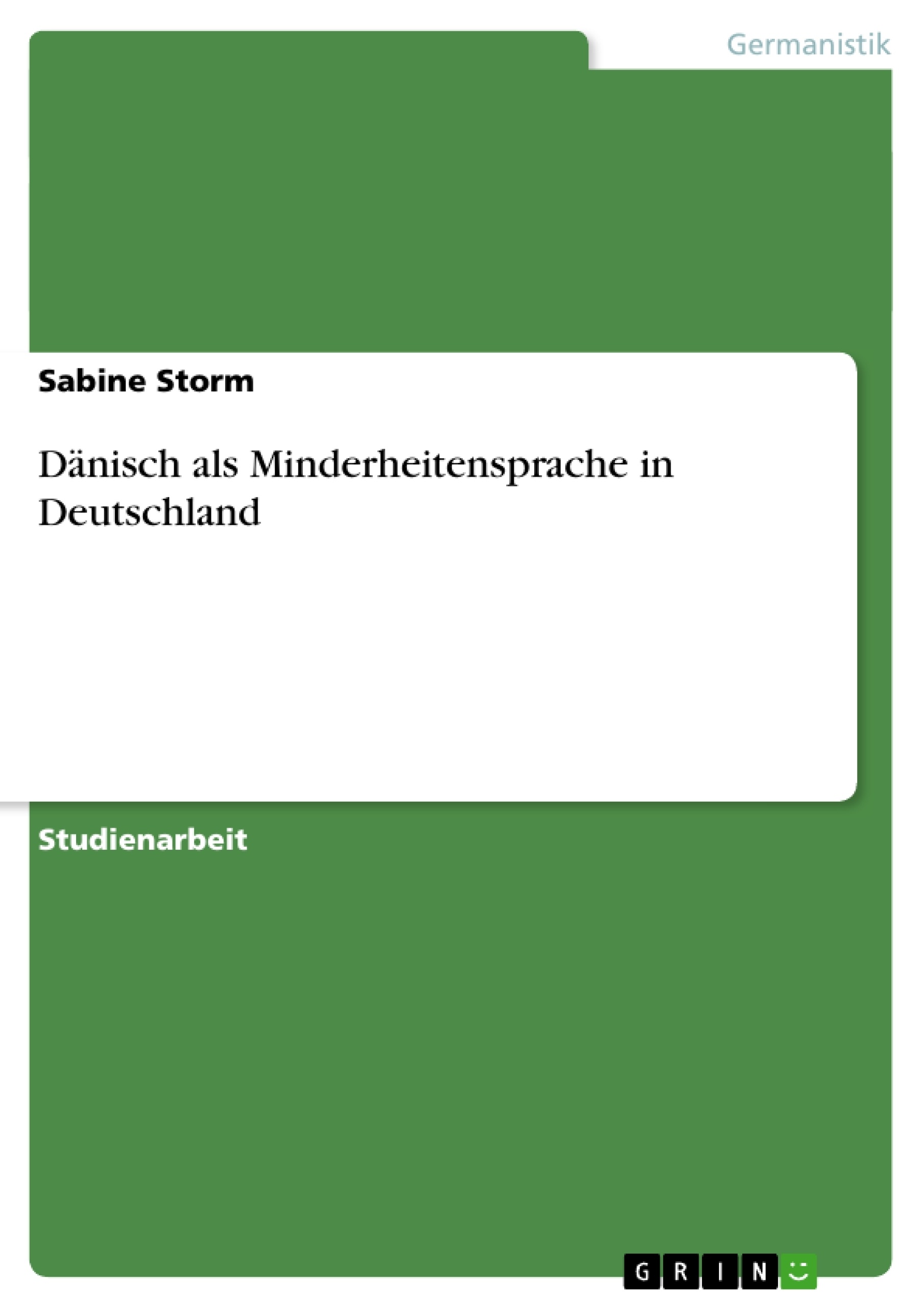Einführung in das Thema
Dänisch als Minderheitensprache in Deutschland ist ein Thema, das mir als Bewo hnerin Flensburgs schon mehrmals begegnet ist. Gerade in Flensburg sind viele Schilder und offizielle Broschüren zweisprachig, dänisch und deutsch. Durch die Grenznähe hört man auf der Straße immer wieder dänisch, ich habe Freunde, die auf dem dänischen Gymnasium in Flensburg ihr Abitur abgelegt haben und es gibt z. B. Filialen dänischer Banken (Sydbank), eine Bücherei (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig) und eine Tageszeitung (Flensborg Avis), die in dänischer Sprache erscheint. Ich habe drei Semester Betriebliche Bildung und Management mit Dänisch studiert und beherrsche daher Dänisch in Wort und Schrift. Eine sprachliche Minderheit ist eine „zahlenmäßig kleinere Sprachgemeinschaft, die mit (einer) größeren Sprachgemeinschaft(en) in einem Gemeinwesen zusammenlebt. Die Möglichkeit der Majorisierung birgt grundsätzlich die Gefahr der Unterdrückung, v.a. der übermäßigen Einschränkung von sprachlichen Rechten. Demgegenüber wird heute bisweilen sogar das Menschenrecht auf Verwendung der eigenen Sprache gefordert, und zwar nicht auf private, sondern auf öffentl. Verwendung als Schulsprache, Amtssprache, in den Medien. Die Konflikte zwischen sprachlichen Minderheiten und Mehrheiten sind z.T. sehr intensiv erforscht worden. Neben allgemein als für die sprachliche Minderheit unbefriedigend empfundene Situationen gibt es einzelne günstige, so z.B. für die Deutschsprachigen in Südtirol (Italien) oder in Nordschleswig (Dänemark).“1
In dieser Hausarbeit möchte ich nun herausfinden, wie es dazu kam, dass die dänische Sprache in Deutschland als Minderheitensprache gilt, wie verbreitet sie in Deutschland tatsächlich ist und was dafür getan wird, dass sie als Minderheitensprache geschützt wird. Außerdem möchte ich herausfinden, ob die dänische Sprache, wie sie in Deutschland gesprochen wird, mit der Sprache im Mutterland übereinstimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema
- Die dänische Minderheit in Deutschland
- Die geschichtliche Entstehung der Minderheit in Deutschland
- Institutionen der dänischen Minderheit
- Dänischer Sprachgebrauch in Deutschland
- Dänischer Sprachgebrauch bei Schülern dänischer Schulen in Südschleswig
- Dänischer Sprachgebrauch bei erwachsenen Angehörigen der dänischen Minderheit in Deutschland
- Dänisch als Institutionssprache
- Europäische Rechtsgrundlagen zu Minderheiten und ihren Sprachen
- Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
- Die europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
- Unterschiede zwischen Dänisch als Nationalsprache und als Minderheitensprache
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die dänische Minderheit in Deutschland, ihren historischen Hintergrund und den gegenwärtigen Status der dänischen Sprache. Die Arbeit beleuchtet die Verbreitung der dänischen Sprache, die Maßnahmen zu ihrem Schutz und die Unterschiede zur dänischen Sprache im Mutterland.
- Die geschichtliche Entwicklung der dänischen Minderheit in Deutschland.
- Der aktuelle Sprachgebrauch des Dänischen in Deutschland.
- Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz der dänischen Sprache als Minderheitensprache.
- Ein Vergleich zwischen dem Dänischen in Deutschland und im Mutterland.
- Die Rolle von Institutionen und Organisationen der dänischen Minderheit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Thema: Die Einleitung beschreibt die persönliche Begegnung der Autorin mit der dänischen Sprache in Flensburg und definiert den Begriff „sprachliche Minderheit“. Sie hebt die potenziellen Konflikte zwischen Sprachminderheiten und -mehrheiten hervor und erwähnt positive Beispiele wie die Deutschsprachigen in Südtirol. Die Arbeit benennt die Forschungsfragen: die Entstehung der dänischen Minderheit, die Verbreitung der Sprache in Deutschland, Schutzmaßnahmen und den Vergleich mit dem Dänischen im Mutterland.
Die dänische Minderheit in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die heutige dänische Minderheit in Deutschland (ca. 50.000 Menschen, 8-10% der Bevölkerung in Südschleswig), ihre geographische Verteilung und die Existenz eigener Einrichtungen und Institutionen. Es liefert einen Überblick über die Thematik und bildet die Basis für die detaillierteren Ausführungen in den folgenden Kapiteln.
Die geschichtliche Entstehung der Minderheit in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der dänischen Minderheit, beginnend mit dem Verlust des Herzogtums Schleswig an Preußen im Jahr 1864. Es beschreibt die Volksabstimmungen nach dem Ersten Weltkrieg, die zur Teilung Schleswigs führten und die Entstehung der dänischen Minderheit in Deutschland. Es erwähnt auch die Bemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg, Südschleswig wieder an Dänemark anzuschließen, und die letztendlich erfolgte Anerkennung der dänischen Minderheit als gleichberechtigt in der Kieler Erklärung von 1949 und die Bedeutung der Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955.
Schlüsselwörter
Dänische Minderheit, Südschleswig, Minderheitensprache, Sprachpolitik, Deutschland, Dänemark, Volksabstimmung, Kieler Erklärung, Bonn-Kopenhagener Erklärungen, Sprachgebrauch, Institutionen, Gleichberechtigung, Rechtsgrundlagen, Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die dänische Minderheit in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der dänischen Minderheit in Deutschland. Sie untersucht deren historische Entwicklung, den aktuellen Status der dänischen Sprache in Deutschland, den rechtlichen Schutz der Sprache und vergleicht die Situation mit der des Dänischen in Dänemark.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtliche Entstehung der dänischen Minderheit, den gegenwärtigen Sprachgebrauch (bei Schülern, Erwachsenen und in Institutionen), die europäischen Rechtsgrundlagen zum Schutz von Minderheitensprachen (Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen), die Unterschiede zwischen Dänisch als National- und Minderheitensprache, sowie die Rolle von Institutionen der dänischen Minderheit.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur dänischen Minderheit in Deutschland (einschließlich ihrer historischen Entstehung und der vorhandenen Institutionen), zum dänischen Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten, zu den europäischen Rechtsgrundlagen, einem Vergleich zwischen Dänisch als National- und Minderheitensprache und abschließend eine Konklusion.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit untersucht die Entstehung der dänischen Minderheit, die Verbreitung der dänischen Sprache in Deutschland, die Maßnahmen zu ihrem Schutz und den Vergleich mit dem Dänischen im Mutterland (Dänemark).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Inhalte der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Dänische Minderheit, Südschleswig, Minderheitensprache, Sprachpolitik, Deutschland, Dänemark, Volksabstimmung, Kieler Erklärung, Bonn-Kopenhagener Erklärungen, Sprachgebrauch, Institutionen, Gleichberechtigung, Rechtsgrundlagen, Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen.
Welche Bedeutung haben die Kieler Erklärung und die Bonn-Kopenhagener Erklärungen?
Die Kieler Erklärung von 1949 und die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 sind wichtige Meilensteine in der Anerkennung und dem Schutz der dänischen Minderheit in Deutschland. Sie bekräftigen die Gleichberechtigung der Minderheit.
Wie groß ist die dänische Minderheit in Deutschland?
Die dänische Minderheit in Deutschland zählt ungefähr 50.000 Menschen und macht 8-10% der Bevölkerung in Südschleswig aus.
Wo konzentriert sich die dänische Minderheit in Deutschland?
Die dänische Minderheit konzentriert sich hauptsächlich in Südschleswig.
Wie wird der dänische Sprachgebrauch in der Hausarbeit untersucht?
Die Hausarbeit untersucht den dänischen Sprachgebrauch bei Schülern dänischer Schulen, bei erwachsenen Angehörigen der Minderheit und in dänischen Institutionen.
- Quote paper
- Sabine Storm (Author), 2003, Dänisch als Minderheitensprache in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36498