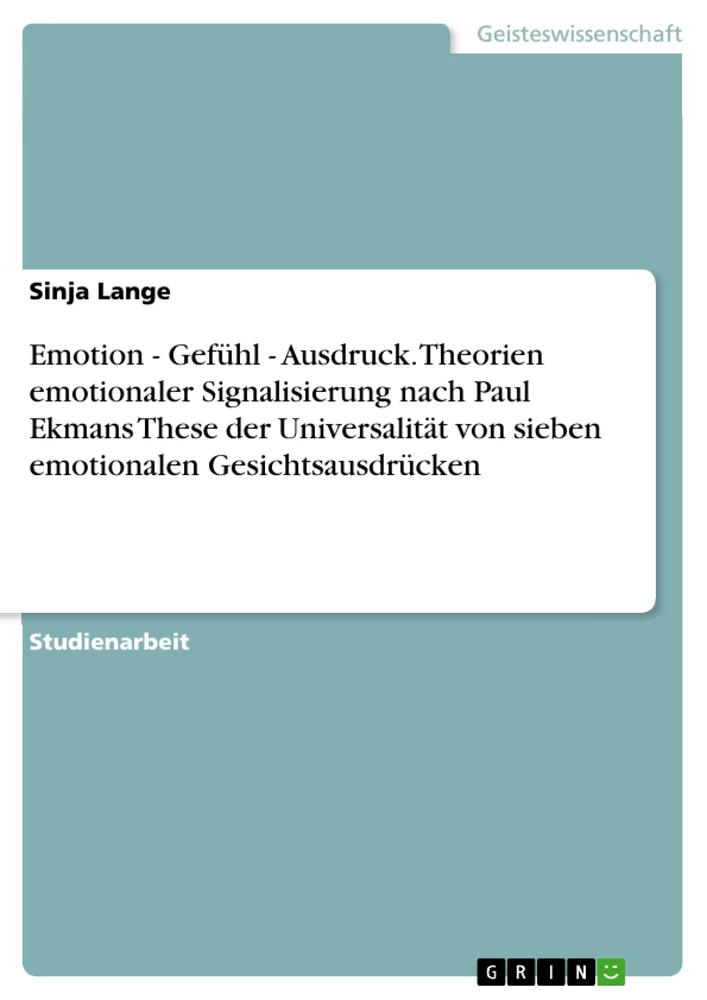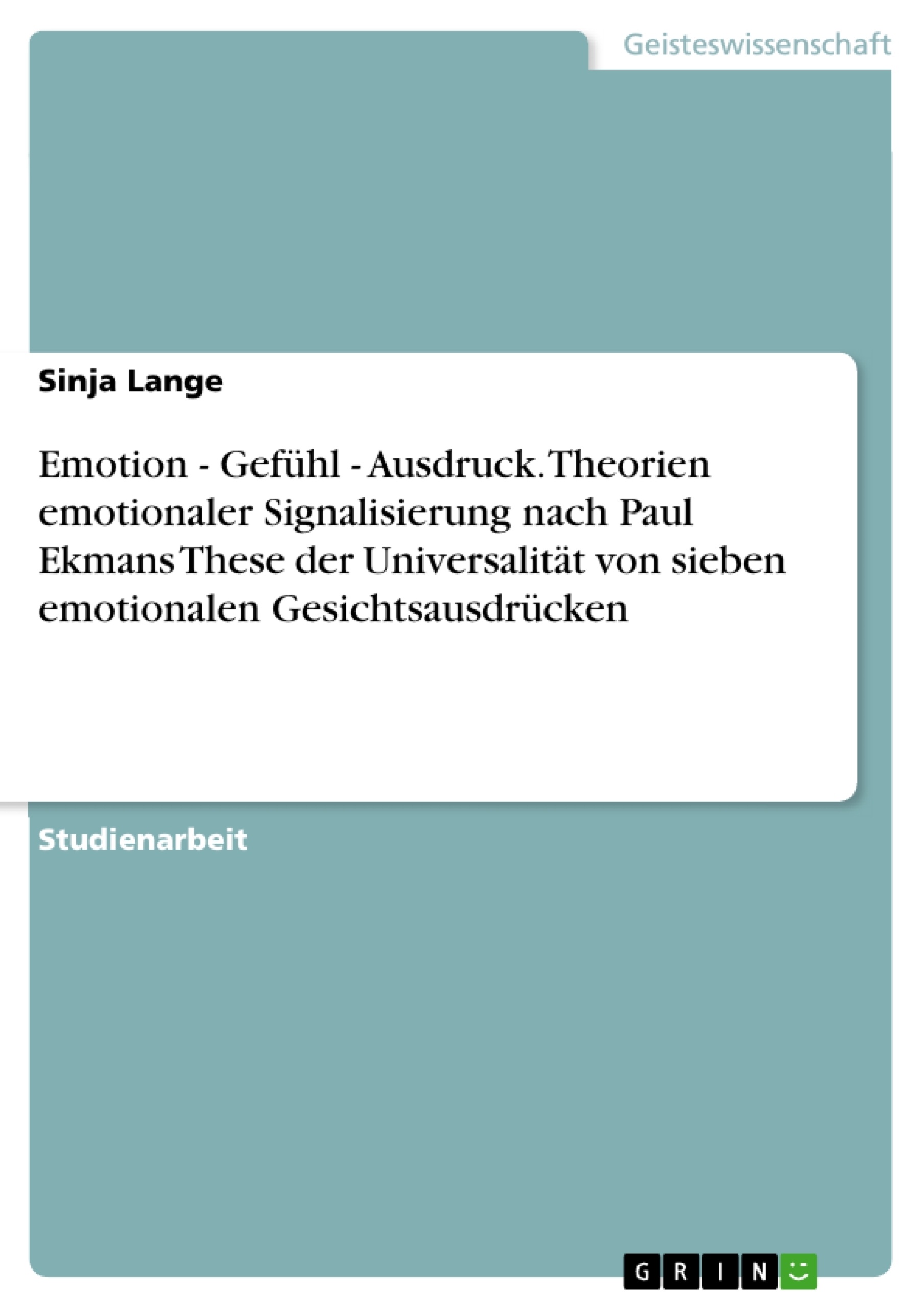Gibt es Emotionen, die jeder Mensch auf der Welt auf die gleiche Art und Weise ausdrückt? Wenn ja, werden sie dann auch gleich empfunden? Oder ist Kultur und Erziehung der determinierende Faktor für das emotionale Erleben eines Menschen? Die zunächst dichotom wirkenden Aussagen werden in unzähligen Disziplinen ausgetragen, ob in der Psychologie zwischen Evolutionisten und Behavioristen; in der Ethnologie zwischen Universalisten und Kulturrelativisten, in der Philosophie, der Ethologie oder der Linguistik (vgl. auch „Nature-Nuture-Debate“).
Mit seiner psychologisch-ethologischen Perspektive erklärt Paul Ekman das Phänomen der „Instinkt-Dressur-Verschränkung“ von Emotionen auf eine neuro-kulturelle Weise. Dabei legt er sein handlungstheoretisch und funktionalistisch geprägtes Augenmerk primär auf die Physiologie des Gesichts. Mit seiner Argumentation stellt er sich auf die Seite der Evolutionisten und Universalisten und knüpft somit an die zwei Jahrhunderte zuvor begonnenen Untersuchungen Charles Darwins zum Ausdruck der Gefühlsbewegungen an.
Im Folgenden werde ich den Diskurs um seine These der Universalität der sieben Emotionen - Angst, Ekel, Freude, Trauer, Überraschung, Wut, Verachtung - aus vier unterschiedlichen, für den historischen Zusammenhang der Kontroverse relevante Annäherungen an das Thema, analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der ekman'schen Forschung
- Paul Ekmans Studien
- Kulturrelativismus
- Raymond L. Birdwhistell
- „Going Native“
- Gregory Bateson
- Robert I. Levy
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Diskurs um Paul Ekmans These der Universalität von sieben Basisemotionen. Ziel ist es, Ekmans Ansatz mit kulturrelativistischen und ethnopsychologischen Perspektiven zu vergleichen und die methodologischen Implikationen unterschiedlicher Herangehensweisen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Frage nach der kulturellen Kontextualität emotionaler Ausdrücke.
- Universalität vs. Kulturrelativismus emotionaler Ausdrücke
- Methodologische Ansätze in der Emotionsforschung
- Der Einfluss von Kultur und Erziehung auf das emotionale Erleben
- Analyse der methodischen Konzepte von Ekman, Birdwhistell, Bateson und Levy
- Die Rolle der Physiognomie im Ausdruck von Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Emotionen und ihrer Ausdrucksformen ein. Sie beleuchtet die psychologische Definition von Emotionen als psychische, unwillkürliche Erregungszustände, die durch Betroffenheit konstituiert und nonverbal vermittelt werden. Die Arbeit stellt die zentrale Frage nach der Universalität emotionaler Ausdrucksweisen und der Rolle von Kultur und Erziehung in diesem Zusammenhang. Sie kündigt die Analyse von Ekmans These der Universalität von sieben Basisemotionen an und beschreibt die methodologische Perspektive der Arbeit, die sich auf den Vergleich verschiedener methodischer Ansätze konzentriert.
Grundlagen der ekman'schen Forschung: Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen von Paul Ekmans Forschung und setzt sie in den Kontext der vorherigen Arbeiten Charles Darwins zum Ausdruck der Gefühle. Es wird kritisch auf Darwins methodisches Vorgehen eingegangen, welches als lückenhaft und teilweise problematisch (rassistisch und sozialdarwinistisch) dargestellt wird. Ekman wird als einer der ersten präsentiert, der Emotionen als eigenständige Einheiten ansah und den Gesichtsausdruck als zentrale Informationsquelle für Emotionen identifizierte. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion von Ekmans deduktivem Vorgehen als Grundlage für den anschließenden Vergleich mit anderen Ansätzen.
Schlüsselwörter
Emotionen, Gesichtsausdruck, Universalität, Kulturrelativismus, Ethnopsychologie, Paul Ekman, Charles Darwin, Methodologie, Emotionsforschung, kulturelle Kontextualität, Mimik.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse des Diskurses um die Universalität von Emotionen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert den Diskurs um Paul Ekmans These der Universalität von sieben Basisemotionen. Er vergleicht Ekmans Ansatz mit kulturrelativistischen und ethnopsychologischen Perspektiven und untersucht die methodologischen Implikationen unterschiedlicher Herangehensweisen. Der Fokus liegt auf der kulturellen Kontextualität emotionaler Ausdrücke.
Welche Autoren werden im Text behandelt?
Der Text behandelt vor allem die Arbeiten von Paul Ekman, aber auch von Charles Darwin, Raymond L. Birdwhistell, Gregory Bateson und Robert I. Levy. Der Vergleich ihrer methodischen Ansätze bildet einen zentralen Bestandteil der Analyse.
Welche zentralen Themen werden im Text behandelt?
Zentrale Themen sind die Universalität versus der Kulturrelativismus emotionaler Ausdrücke, methodologische Ansätze in der Emotionsforschung, der Einfluss von Kultur und Erziehung auf das emotionale Erleben, die Analyse der methodischen Konzepte der genannten Autoren und die Rolle der Physiognomie im Ausdruck von Emotionen.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Einleitung, Grundlagen der ekman'schen Forschung, Kulturrelativismus, „Going Native“, und Fazit gegliedert. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kritik wird an Ekman und Darwin geübt?
Der Text kritisiert Darwins methodisches Vorgehen als lückenhaft und teilweise problematisch (rassistisch und sozialdarwinistisch). Ekmans deduktives Vorgehen wird rekonstruiert und im Vergleich mit anderen Ansätzen analysiert.
Was ist die zentrale Forschungsfrage des Textes?
Die zentrale Frage ist, inwieweit emotionale Ausdrucksweisen universell sind und welche Rolle Kultur und Erziehung in diesem Zusammenhang spielen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Emotionen, Gesichtsausdruck, Universalität, Kulturrelativismus, Ethnopsychologie, Paul Ekman, Charles Darwin, Methodologie, Emotionsforschung, kulturelle Kontextualität und Mimik.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Emotionsforschung, Kulturwissenschaften und Methodologie beschäftigt.
Welche methodologische Perspektive wird eingenommen?
Der Text vergleicht verschiedene methodische Ansätze in der Emotionsforschung und konzentriert sich auf die Analyse der methodologischen Implikationen unterschiedlicher Herangehensweisen an die Erforschung emotionaler Ausdrücke.
- Quote paper
- Sinja Lange (Author), 2015, Emotion - Gefühl - Ausdruck. Theorien emotionaler Signalisierung nach Paul Ekmans These der Universalität von sieben emotionalen Gesichtsausdrücken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/364791