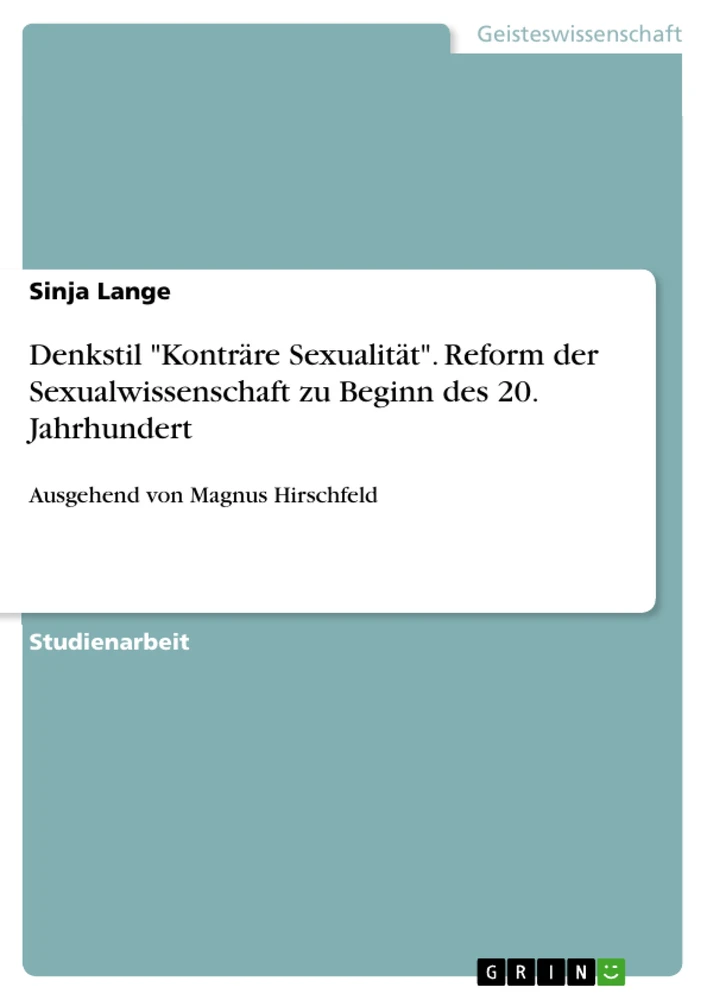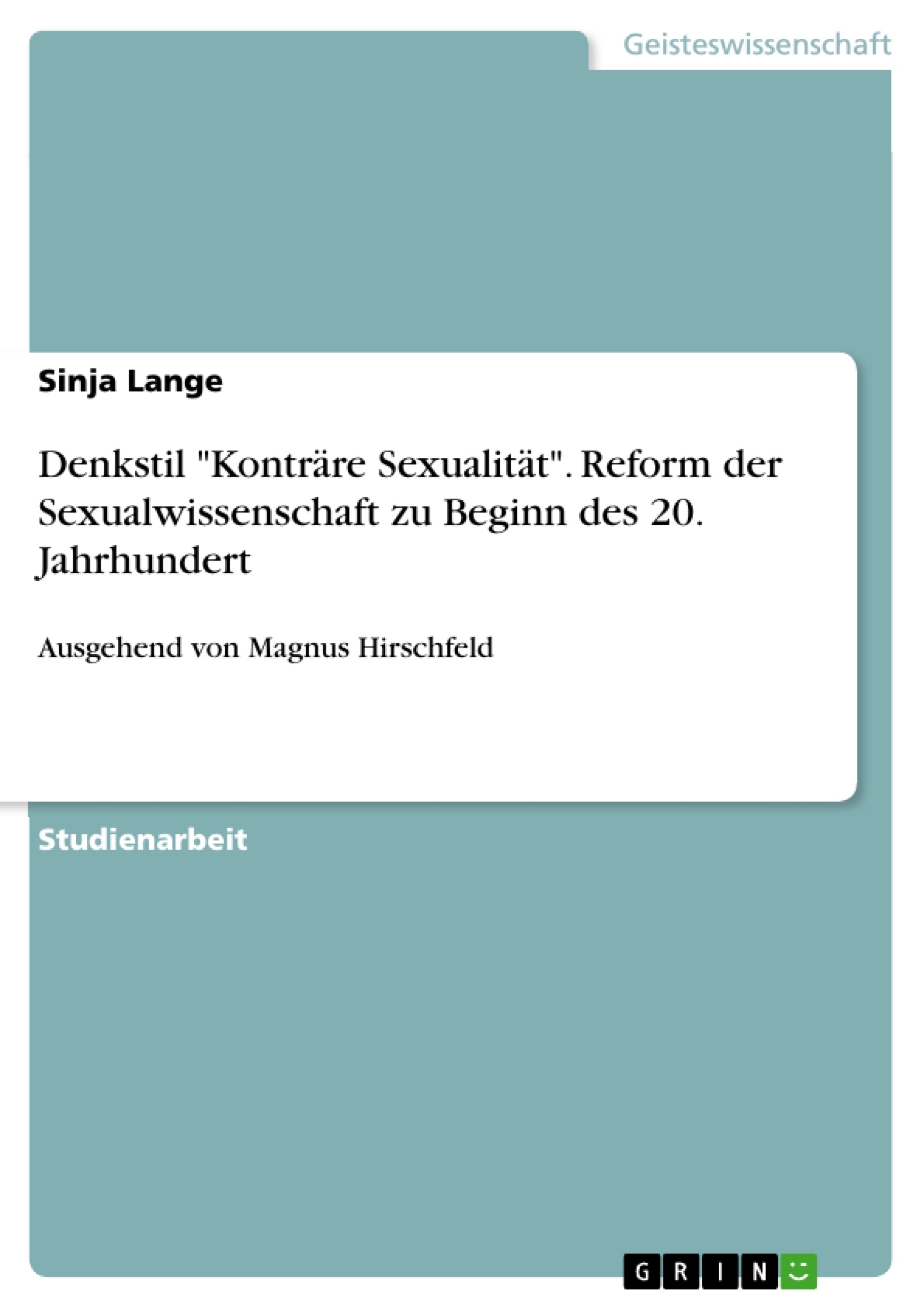Woher kommen unsere Identitätskonzepte? Woher kommen die Vorurteile gegen Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht in die üblichen Schubladen passen? Wann sind sie entstanden?
Birgit Bauer kritisiert, dass diese Konzepte als "natürlich" hingenommen und nicht reflektiert werden. Homogene Gruppen, die "Ausschlussmechanismen aufgrund normierten und eng definierter Identitäten" tradieren, existierten "transhistorisch" und "transkulturell" (Bauer 2001: 332-334). Unser Denken, Verhalten und die Art wie wir sind, ist stetig geprägt vom Diskurs um identitätsstiftende Rollenzuschreibungen. "Wissen ist Macht" und es beeinflusst die Normen einer Gesellschaft zu Gunsten der Mehrheit. Im 19. Jahrhundert kriminalisierte die legale politische Agenda männliche Homosexualität als Verbrechen, später als psychische Krankheit. Die Effekte des "Power-Knowledge" (Foucault 1980) reichten so weit, dass Sodomiten gesellschaftlich ausgestoßene waren, sich sogar aus Sorge vor ihren eigenen Gefühlen umbrachten.
Zu dieser Zeit entstand in der Wissenschaft, vor allem der Medizin und Psychiatrie, die Bezeichnungen "Konträr Sexuelle" geprägt durch den Berliner Psychiater Carl Westphal (1833-1890), "Urning" durch Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895), um von der negativen Wertung der Homosexuellen abzulenken. Selbst Foucault zeugte den beiden Tribut, da sie den Beginn einer neuen Ära in der Beschäftigung mit gleichgeschlechtlicher Liebe und ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit einleiteten: "The sodomite had been a temporary aberration; the homosexual was now a new species" (Foucault 1980: 43). Sie setzten also den Grundstein der aufkommenden Sexualwissenschaften und dem politischen Kampf um die Legitimation der Homosexualität. Doch wie konnte ein so prekäres Thema zum wissenschaftlichen Diskurs werden? Wie erreichten die Intellektuellen eine Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft?
Um diese Fragen zu beantworten werde ich zuerst die gesellschaftlich-normative Haltung zu Sexualität und besonders Homosexualität beschreiben. Am Beispiel von Magnus Hirschfeld rekonstruiere ich den wissenschaftlichen Diskurs von der Pathologisierung der Homosexualität bis zur Institutionalisierung der Sexualwissenschaften. Anhand von Ludwig Flecks Konzept einer wissenschaftlichen Tatsache werde ich erklären, wie der Diskurs zu einem spezifischen Denkstil innerhalb einer Expertengruppe Berliner Wissenschaftler wurde, welcher eine Aufklärung in der Gesellschaft beförderte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexual- und Homosexualitätsverständnis des 19. Jahrhundert
- Magnus Hirschfeld - Mediziner und Revolutionär
- Biografische Einordung
- Beitrag und Einfluss Hirschfelds wissenschaftlicher Laufbahn
- Anerkennung der Homosexualität als wissenschaftliche Tatsache
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Begriff "Konträre Sexualität" und untersucht dessen Bedeutung im Kontext der Reform der Sexualwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere im Hinblick auf die wissenschaftliche Arbeit von Magnus Hirschfeld. Ziel ist es, die Entstehung des wissenschaftlichen Diskurses um Homosexualität als wissenschaftliche Tatsache zu beleuchten und die Entwicklung von "Konträrer Sexualität" als Kategorie zu verstehen.
- Die historische Entwicklung von Sexual- und Homosexualitätskonzepten im 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Magnus Hirschfeld und sein Beitrag zur Institutionalisierung der Sexualwissenschaften
- Die Anerkennung der Homosexualität als wissenschaftliche Tatsache
- Die Entstehung des Denkstils "Konträre Sexualität"
- Die Bedeutung des wissenschaftlichen Diskurses für die gesellschaftliche Wahrnehmung von Homosexualität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik "Konträre Sexualität" ein und beleuchtet die gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurse, die den Begriff geprägt haben. Sie verweist auf die Relevanz der Thematik im Kontext historischer Vorurteile und Stereotypen.
Das zweite Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Sexual- und Homosexualitätsverständnisses im 19. Jahrhundert. Es beschreibt das "Ein-Geschlechter-Modell" der Antike und den Wandel hin zum Zweigeschlechtermodell in der Aufklärung, wobei die Rolle der Medizin und der gesellschaftlichen Moral im Vordergrund stehen.
Kapitel drei widmet sich der Person Magnus Hirschfelds. Es beleuchtet seine Biografie, seine wissenschaftliche Laufbahn und seinen Einfluss auf die Entwicklung der Sexualwissenschaften. Im Fokus steht seine Arbeit zur Anerkennung der Homosexualität als wissenschaftliche Tatsache.
Schlüsselwörter
Konträre Sexualität, Homosexualität, Sexualwissenschaft, Magnus Hirschfeld, Carl Westphal, Karl Heinrich Ulrichs, Ludwig Fleck, "Ein-Geschlechter-Modell", Zweigeschlechtermodell, wissenschaftliche Tatsache, Diskursanalyse, historische Entwicklung, gesellschaftliche Normen.
- Arbeit zitieren
- Sinja Lange (Autor:in), 2014, Denkstil "Konträre Sexualität". Reform der Sexualwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/364787