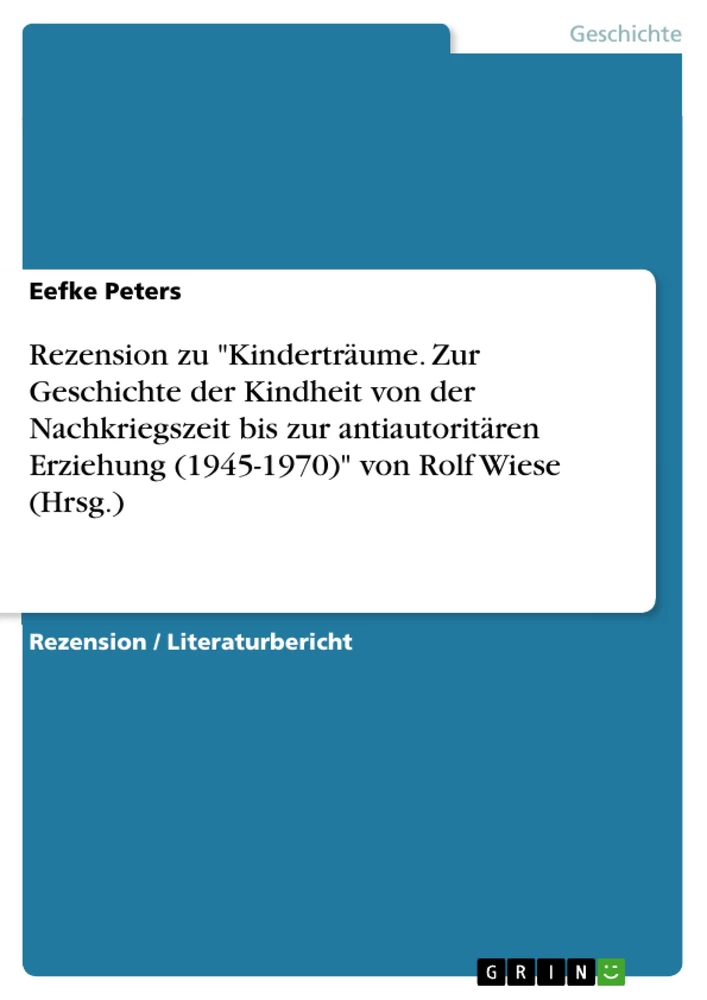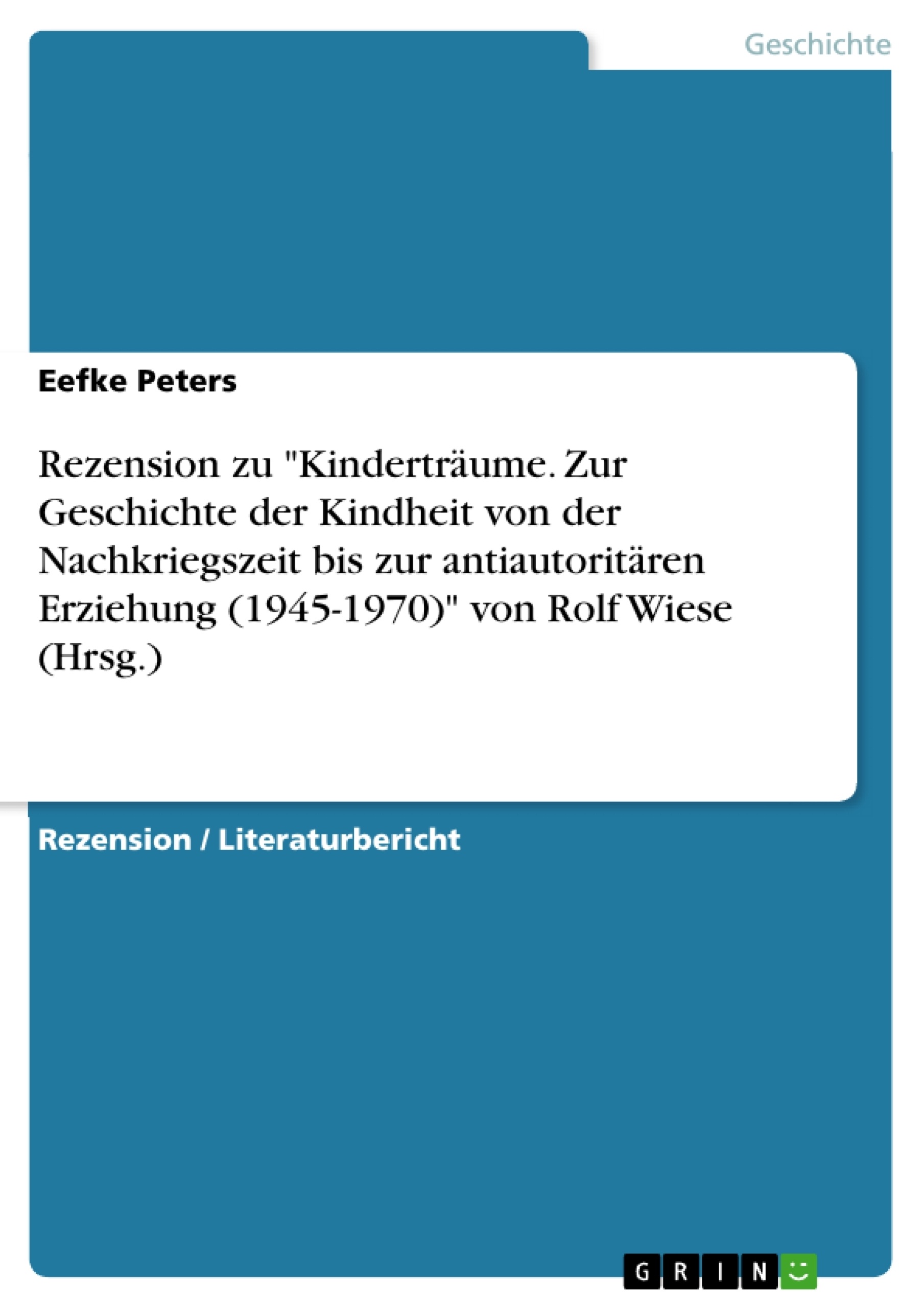Rolf Wiese, ein Professor des Instituts für Volkskunde und Kulturanthropologie an der Universität Hamburg , beginnt sein Buch mit einem erklärendem Vorwort. Parallel zur Herausgabe des von verschiedenen Autoren geschriebenen Buches, fand 1992 eine Ausstellung zum Buchtitel im Freilichtmuseum am Kiekeberg statt.
Die Lebensumstände von Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg, die Umbrüche in der Familie und der Schule sind neben dem großen Aspekt der Entwicklung des Spielens Thema dieses Buches. Die Geschichte von den oft zerstörten Familienstrukturen zu den sich wieder vereinenden Strukturen, wird sachlich und verständlich dargestellt. Deutlich wird die Schwierigkeit Kindern nach dem 2. Weltkrieg Möglichkeiten einer Kindheit zu geben. Das Land musste neu aufgebaut werden, es mangelte an Gebäuden und Personal um Kindern eine angebrachte Schulbildung zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kinder(t)räume - Von den Trümmern zur "Anti-autoritären Erziehung"
- Der "große Unterschied" zwischen Stadt und Land
- Spielzeug und Spiel
- Feste, Brauchtum und Rituale
- Spielzeug, das Leben veränderte
- Kindermode - Von der Not zur "Jeans-Generation"
- Die "Jungen Pioniere"
- Kindheit im Spannungsfeld von Tradition und Wandel
- Schulkinder - In der DDR und in der Bundesrepublik
- Der "Zweite Weltkrieg" als Thema in Kinderbüchern
- Kranke Kinder - Behinderte Kinder
- Die Konfirmation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Kinder(t)räume" befasst sich mit der Entwicklung der Kindheit von der Nachkriegszeit bis zur antiautoritären Erziehung (1945-1970). Es analysiert die Lebensumstände von Kindern in dieser Epoche, die Veränderungen innerhalb der Familie und der Schule sowie die Entwicklung des Spielens.
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Kindheit
- Die Entwicklung des Spielens und des Spielzeugs
- Die Veränderung von Familienstrukturen und -rollen
- Die Entwicklung der Schulbildung nach dem Krieg
- Die Bedeutung von Zeitzeugenberichten für die Rekonstruktion der Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort erläutert die Entstehungsgeschichte des Buches und den Bezug zur gleichnamigen Ausstellung im Freilichtmuseum am Kiekeberg.
- Der erste Artikel befasst sich mit den Lebensumständen von Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg, den Umbrüchen in der Familie und der Schule sowie mit der Entwicklung des Spielens. Die Autoren betonen die Schwierigkeiten, Kindern nach dem Krieg Möglichkeiten einer Kindheit zu ermöglichen, da das Land neu aufgebaut werden musste.
- Der zweite Artikel widmet sich dem "großen Unterschied" zwischen Stadt und Land, insbesondere im Hinblick auf Spielmöglichkeiten und Spielzeuge. Er beschreibt die Herausforderungen der fehlenden Infrastruktur und die Rolle von Trümmern als Spielplätze in den Städten.
- Die Artikel 3-6 analysieren die Entwicklung des Spielens und des Spielzeugs von den Trümmern der Nachkriegszeit bis zur Anti-autoritären Erziehung. Sie beleuchten die verschiedenen Spielformen, das Aufkommen neuer Spielzeuge und die Herausforderungen, die sich aus dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse ergaben.
- Die Artikel 7-11 untersuchen die Veränderung von Festen und Bräuchen sowie die Entwicklung der Kindermode in der Nachkriegszeit.
- Die Artikel 12-14 befassen sich mit der Entwicklung der Schulbildung in der DDR und der Bundesrepublik, den Themen des Zweiten Weltkriegs in Kinderbüchern und mit der Situation von kranken und behinderten Kindern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Kindheit, Nachkriegszeit, antiautoritäre Erziehung, Spiel, Spielzeug, Familie, Schule, Zeitzeugen, sozialer Wandel, Familienstrukturen, Bildung, Spielzeuggeschichte, Kindermode.
- Quote paper
- Eefke Peters (Author), 2015, Rezension zu "Kinderträume. Zur Geschichte der Kindheit von der Nachkriegszeit bis zur antiautoritären Erziehung (1945-1970)" von Rolf Wiese (Hrsg.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/364439