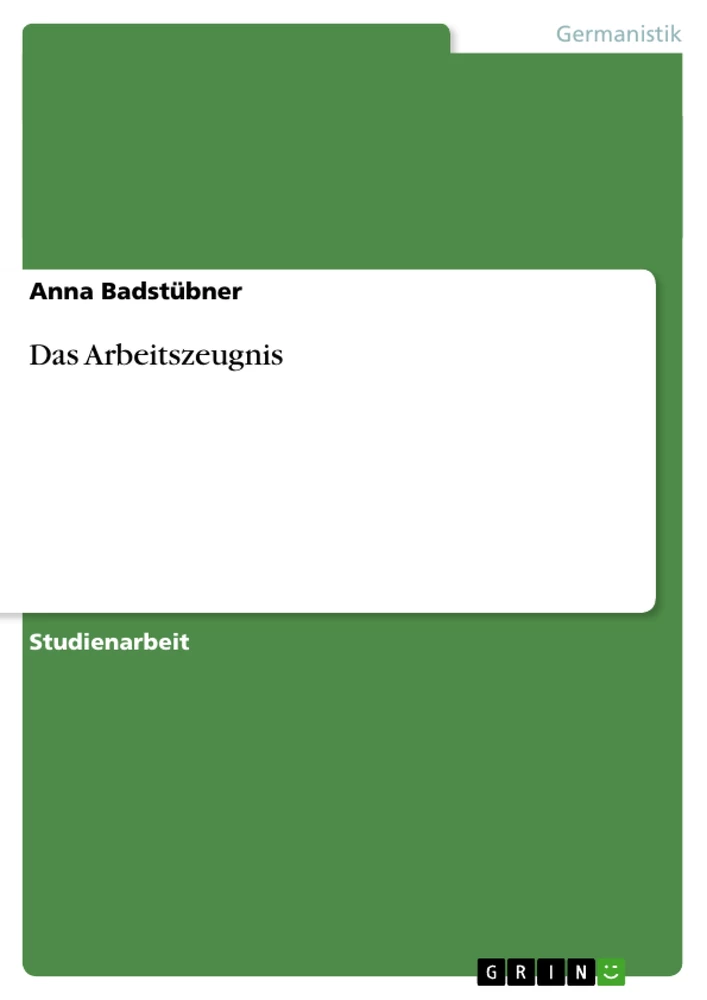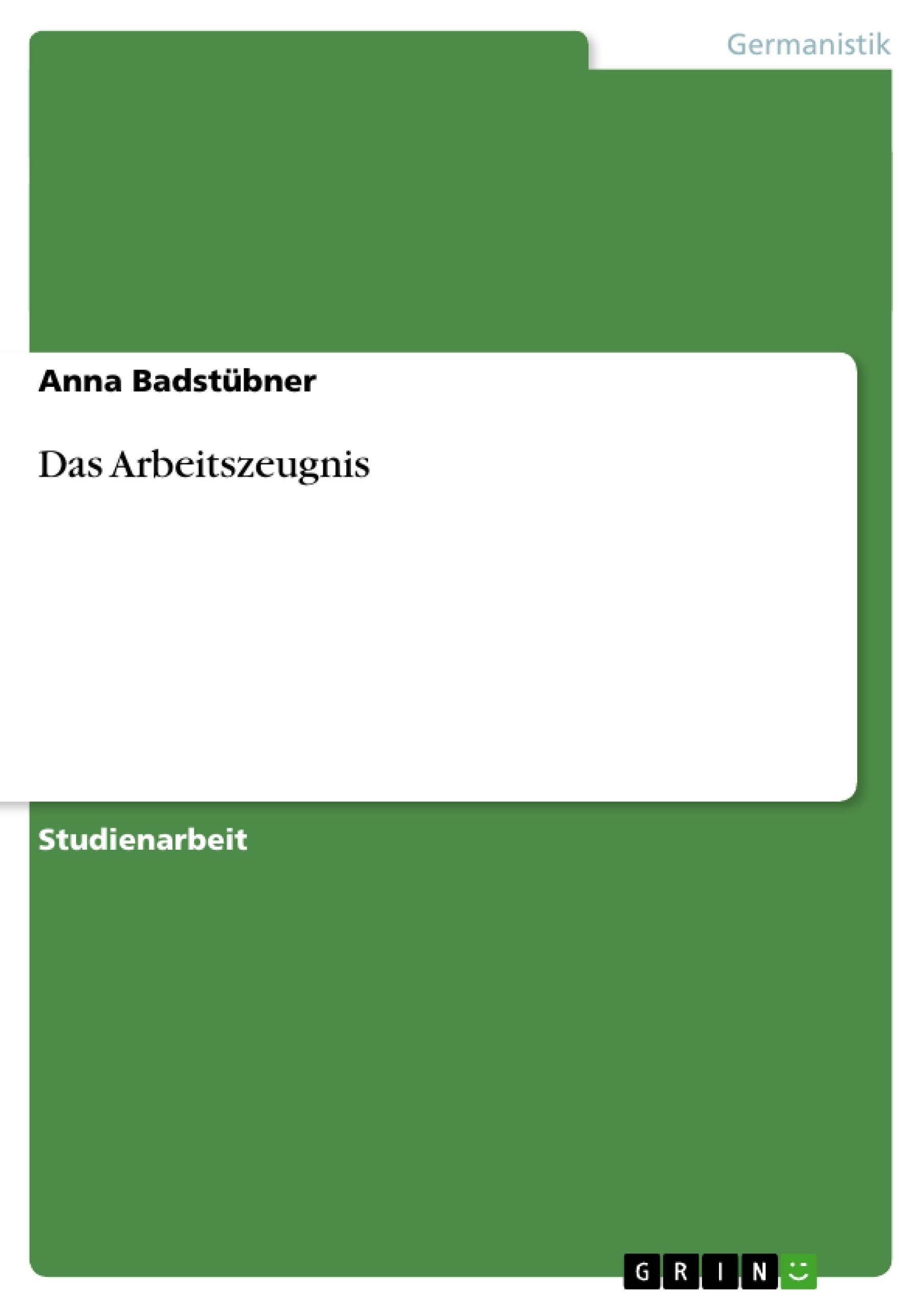Einführung
Es ist nicht schwer, die Berechtigung dieser Hausarbeit über das Thema Arbeitszeugnis in der Germanistik zu finden, denn es handelt sich hierbei um eine grundlegende Textsorte des Arbeitslebens. Sie wurde von Rolf (1993) innerhalb der deklarativen Textsorten in die personendimensionierenden, leistungsbezogenen Textsorten eingeordnet. Aber nicht nur für die Wissenschaft im Allgemeinen und für die Linguistik im Besonderen ist das Arbeitszeugnis ein beliebtes Thema, sondern auch für alle Menschen, die im Arbeitsleben stehen. Zum einen, weil sie Arbeitgeber sind und selbst solche Zeugnisse ausstellen müssen, zum andern, weil sie Arbeitnehmer sind und einen gesetzlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis haben. Deshalb möchte ich zunächst auf die Bedeutung des Arbeitszeugnisses eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Bedeutung des Arbeitszeugnisses
- 3. Rechtliche Grundlagen
- 4. Grundsätze
- 5. Form des Arbeitszeugnisses
- 6. Inhalt des Arbeitszeugnisses
- 6.1 Zeugnisarten
- 6.1.1 Einfaches Zeugnis
- 6.1.2 Qualifiziertes Zeugnis
- 6.2 Formulierung
- 6.3 Zeugniscode
- 7. Muster
- 7.1 Zeugnisse aus früherer Zeit
- 7.2 Muster einfacher Zeugnisse
- 7.3 Muster qualifizierter Zeugnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Textsorte „Arbeitszeugnis“ aus germanistischer Sicht. Ziel ist es, die Bedeutung, die rechtlichen Grundlagen, die formalen und inhaltlichen Anforderungen sowie verschiedene Arten von Arbeitszeugnissen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert das Arbeitszeugnis als alltagssprachliche Textsorte und deren Bedeutung im Arbeitsleben.
- Bedeutung des Arbeitszeugnisses für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Rechtliche Grundlagen und Ansprüche im Bezug auf Arbeitszeugnisse
- Formale Anforderungen an die Gestaltung und den Aufbau von Arbeitszeugnissen
- Unterscheidung zwischen einfachen und qualifizierten Arbeitszeugnissen
- Grundsätze der Wahrheit, Vollständigkeit, Klarheit und des wohlwollenden Verständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung begründet die Relevanz des Themas „Arbeitszeugnis“ für die Germanistik, indem sie das Arbeitszeugnis als grundlegende Textsorte des Arbeitslebens und Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung positioniert. Sie hebt die Bedeutung für sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer hervor und kündigt die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema an.
2. Bedeutung des Arbeitszeugnisses: Dieses Kapitel beleuchtet die Doppelfunktion des Arbeitszeugnisses als Nachweis der beruflichen Tätigkeit und als Beurteilungsmaßstab für den Arbeitnehmer. Es betont die wachsende Bedeutung des Zeugnisses für Arbeitgeber bei der Vorauswahl von Kandidaten für höherwertige Positionen, da es eine wichtige externe Informationsquelle darstellt.
3. Rechtliche Grundlagen: Hier werden die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 630 BGB) erläutert. Der Anspruch auf ein „einfaches“ Arbeitszeugnis für Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikanten wird hervorgehoben, ebenso die Verjährungsfrist des Anspruchs.
4. Grundsätze: Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Grundsätze für die Erstellung von Arbeitszeugnissen. Wahrheit, Vollständigkeit und Klarheit werden als oberste Prinzipien genannt. Der Grundsatz des wohlwollenden Verständnisses wird erläutert, wobei betont wird, dass negative Aspekte nicht verschwiegen, aber auch nicht übertrieben dargestellt werden sollen. Objektivität und Glaubwürdigkeit werden ebenfalls als wichtige Aspekte genannt.
5. Form des Arbeitszeugnisses: Der Abschnitt befasst sich mit den formalen Aspekten der Zeugnisgestaltung, wie z.B. die schriftliche Ausfertigung auf Firmenpapier oder hochwertigem Papier, die Lesbarkeit, die Sprache (Deutsch) und die Unterschrift des Ausstellers. Die Bedeutung einer korrekten und sauberen Gestaltung wird hervorgehoben.
6. Inhalt des Arbeitszeugnisses: Hier wird die Unterscheidung zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen erläutert. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung nach dem Inhalt, wobei die verschiedenen Arten von Zeugnissen (z.B. vorläufige, endgültige, Zwischenzeugnisse) nur kurz erwähnt werden. Der Abschnitt legt den Grundstein für die detaillierte Betrachtung der Inhalte in den Unterkapiteln.
Schlüsselwörter
Arbeitszeugnis, Textsorte, Germanistik, Rechtliche Grundlagen, § 630 BGB, einfaches Zeugnis, qualifiziertes Zeugnis, Formulierung, Wahrheit, Vollständigkeit, Klarheit, wohlwollendes Verständnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bewerbung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Arbeitszeugnis
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Thema "Arbeitszeugnis"?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Arbeitszeugnis aus germanistischer Perspektive. Sie behandelt die Bedeutung, die rechtlichen Grundlagen, die formalen und inhaltlichen Anforderungen sowie verschiedene Arten von Arbeitszeugnissen. Die Arbeit analysiert das Arbeitszeugnis als alltagssprachliche Textsorte und deren Bedeutung im Arbeitsleben. Der Inhalt umfasst ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung des Arbeitszeugnisses für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die rechtlichen Grundlagen und Ansprüche, die formalen Anforderungen an Gestaltung und Aufbau, die Unterscheidung zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen, sowie die Grundsätze von Wahrheit, Vollständigkeit, Klarheit und wohlwollendem Verständnis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) begründet die Relevanz des Themas. Kapitel 2 (Bedeutung des Arbeitszeugnisses) beleuchtet die Doppelfunktion des Zeugnisses. Kapitel 3 (Rechtliche Grundlagen) erläutert die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen (§ 630 BGB). Kapitel 4 (Grundsätze) beschreibt die Prinzipien der Zeugniserstellung (Wahrheit, Vollständigkeit, Klarheit, wohlwollendes Verständnis). Kapitel 5 (Form des Arbeitszeugnisses) befasst sich mit der formalen Gestaltung. Kapitel 6 (Inhalt des Arbeitszeugnisses) unterscheidet zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen und deren Inhalten. Kapitel 7 (Muster) präsentiert Beispiele verschiedener Zeugnisse.
Welche Arten von Arbeitszeugnissen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet hauptsächlich zwischen einfachen und qualifizierten Arbeitszeugnissen. Es werden zudem kurz vorläufige, endgültige und Zwischenzeugnisse erwähnt. Der Fokus liegt jedoch auf der Unterscheidung nach Inhalt zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Anspruch auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses gemäß § 630 BGB und erläutert den Anspruch auf ein einfaches Arbeitszeugnis für Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikanten sowie die Verjährungsfrist.
Welche Grundsätze sind bei der Erstellung eines Arbeitszeugnisses zu beachten?
Die wichtigsten Grundsätze sind Wahrheit, Vollständigkeit und Klarheit. Der Grundsatz des wohlwollenden Verständnisses bedeutet, dass negative Aspekte nicht verschwiegen, aber auch nicht übertrieben dargestellt werden sollten. Objektivität und Glaubwürdigkeit sind ebenfalls wichtig.
Welche formalen Anforderungen werden an ein Arbeitszeugnis gestellt?
Formale Anforderungen betreffen die schriftliche Ausfertigung auf Firmenpapier oder hochwertigem Papier, die Lesbarkeit, die Sprache (Deutsch) und die Unterschrift des Ausstellers. Eine korrekte und saubere Gestaltung ist wichtig.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitszeugnis, Textsorte, Germanistik, Rechtliche Grundlagen, § 630 BGB, einfaches Zeugnis, qualifiziertes Zeugnis, Formulierung, Wahrheit, Vollständigkeit, Klarheit, wohlwollendes Verständnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bewerbung.
- Quote paper
- Anna Badstübner (Author), 2004, Das Arbeitszeugnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36362