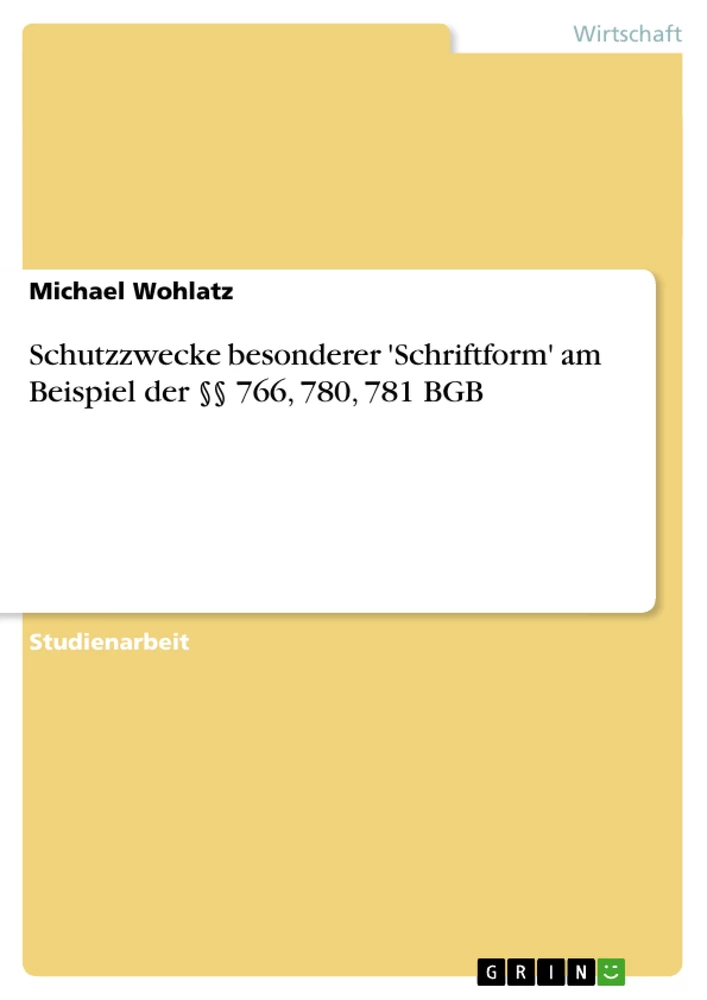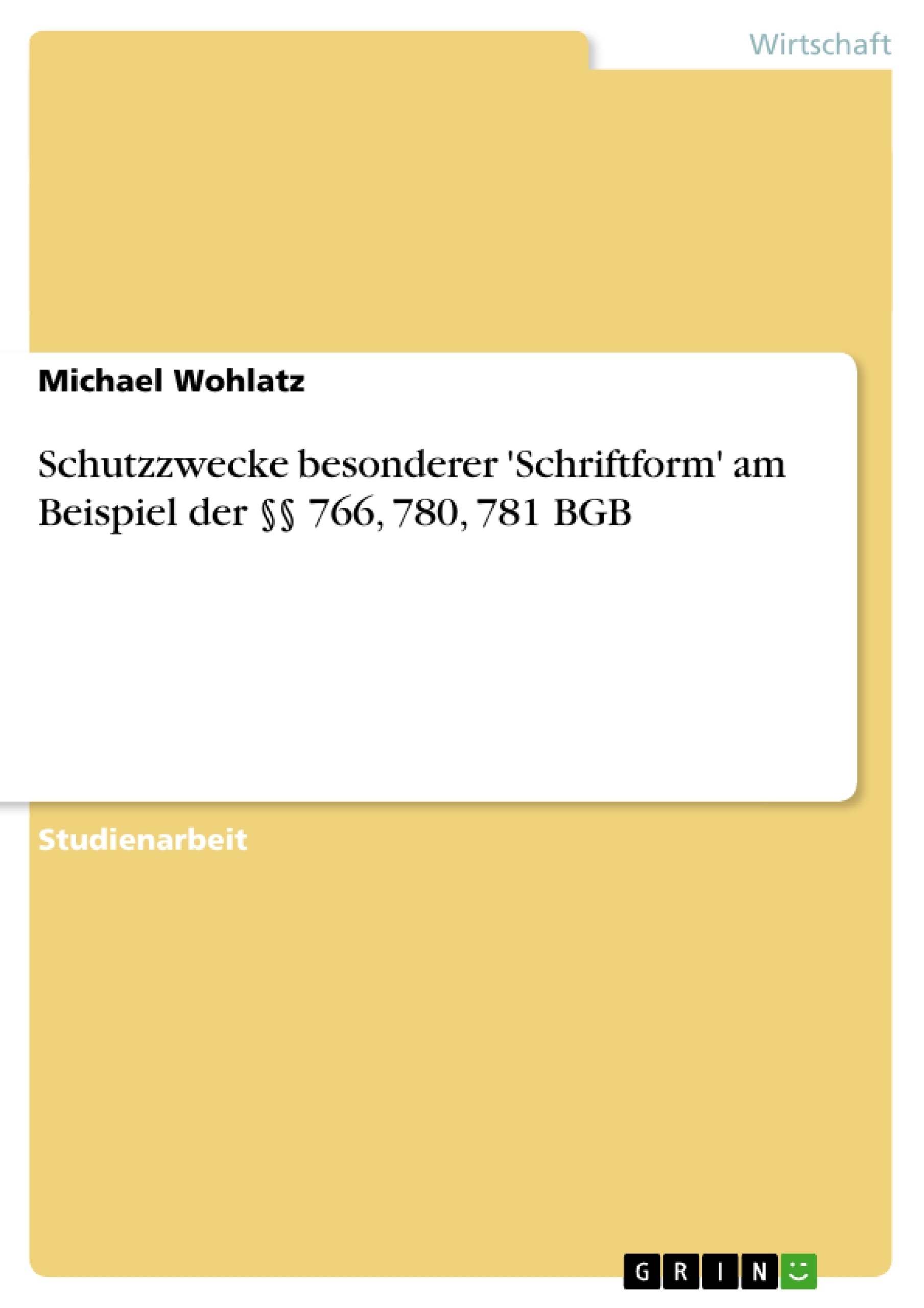Einleitung
§ 126 I BGB sieht vor, dass bei gesetzlich vorgeschriebener Schriftform die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichen unterzeichnet wird. Die Unterschrift hat dabei in der Regel allgemeine Klarstellungs- und Beweisfunktion sowie erfüllt sie den Zweck, die Identität des Ausstellers erkennbar zu machen, die Echtheit der Urkunde zu gewährleisten und dem Empfänger die Prüfung zu ermöglichen, wer die Erklärung abgegeben hat.1 Allerdings gab es im Jahre 2001 insbesondere hinsichtlich des gesetzlichen Schriftformerfordernisses mit der Einführung des „Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr“2 entscheidende Neuerungen: Demnach wurden zwei neue Formtatbestände in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt: die elektronische Form gemäß § 126a BGB und die Textform gemäß § 126b BGB. Die elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz gilt auch nach der europarechtlichen Auffassung in Art 5 I der betreffenden Richtlinie somit nunmehr – soweit zugelassen – als gleichwertig mit der herkömmlichen Unterschrift, wodurch das gesetzliche Schriftformerfordernis des § 126 BGB erfüllt wird. Die elektronische Form kann grundsätzlich die typischen Funktionen der Unterschrift (Abschluss-, Echtheits-, Warn- und eventuell auch die Identitätsfunktion) ersetzen. Die elektronische Form wird allerdings nicht für alle Fälle des gesetzlichen Schriftformerfordernisses zugelassen: Sowohl für die Bürgschaftserklärung gem. § 766 S. 2 BGB, als auch für die Erteilung des Leistungsversprechens zur Gültigkeit des Schuldversprechen gem. § 780 S. 2 BGB und die Erteilung der Anerkenntniserklärung zur Gültigkeit des Schuldanerkenntnis nach § 781 S. 2 BGB ist gesetzlich ausdrücklich deren Erteilung in elektronischer Form ausgeschlossen und muss somit schriftlich erfolgen. Dieses wird grundsätzlich mit der Rechtssicherheit des Erklärungsempfängers und Problemen bei der Warnfunktion, aber auch mangelnder Verankerung im Bewusstsein der Menschen, also fehlender Akzeptanz der elektronischen Form, begründet.3 Nicht nur der Ausschluss der elektronischen Form ist hier beachtenswert, sondern selbst schon die grundlegende Festlegung des Schriftformerfordernisses aller drei ist von Bedeutung, da es eine Abkehr von dem Prinzip der Vertragsfreiheit bedeutet, welches das bürgerliche Recht grundsätzlich verfolgt...
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- B: Formerfordernis der Bürgschaft gem. BGB
- 1. Gesetzliche Regelung
- 2. Funktion und Schutzzwecke des Schriftformerfordernisses im bürgerlichen Recht (Ziele, Methode, Konsequenzen)
- 3. Rechtsprechung und Meinungsbild
- 4. Persönliche Würdigung
- C: Formerfordernis des Schuldanerkenntnisses und des Schuldversprechens gem. BGB
- 1. Gesetzliche Regelung
- 1.1. Das Schuldversprechen
- 1.2. Das Schuldanerkenntnis
- 2. Funktion und Schutzzwecke des Schriftformerfordernisses im bürgerlichen Recht (Ziele, Methode, Konsequenzen)
- 3. Rechtsprechung und Meinungsbild
- 4. Persönliche Würdigung
- 1. Gesetzliche Regelung
- D: Differenzierung des Formerfordernisses „Schriftform“ im Handelsverkehr
- 1. Gesetzliche Regelung
- 2. Voraussetzungen und Reichweite der Formfreiheit
- 2.1. Kaufmannseigenschaft des Bürgen bzw. des Schuldners
- 2.2. Eingehung der Verpflichtung im Betrieb des Handelsgewerbes
- 3. Meinungsbild
- 4. Persönliche Würdigung
- E: Exkurs: Bürgschaft als Haustürgeschäft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schutzzwecke besonderer Schriftformvorschriften im BGB, insbesondere in Bezug auf Bürgschaften (§§ 766, 780, 781 BGB), Schuldanerkenntnisse und Schuldversprechen. Ziel ist es, die Funktion und die Auswirkungen des Schriftformerfordernisses im Zivilrecht zu analysieren und die Unterschiede im Handelsverkehr zu beleuchten.
- Analyse der gesetzlichen Regelungen zur Schriftform bei Bürgschaften, Schuldanerkenntnissen und Schuldversprechen.
- Untersuchung der Schutzzwecke des Schriftformerfordernisses und deren Auswirkungen.
- Bewertung der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung zu diesem Thema.
- Vergleich der Schriftformvorschriften im Zivil- und Handelsrecht.
- Einordnung der Bürgschaft als Haustürgeschäft.
Zusammenfassung der Kapitel
A: Einleitung: Diese Einleitung dient der Einführung in das Thema der Arbeit und der Darstellung der Forschungsfrage und Methodik. Es wird der Fokus auf die Schutzzwecke der Schriftform bei verschiedenen Rechtsgeschäften gelegt, und der Rahmen der Untersuchung wird abgesteckt.
B: Formerfordernis der Bürgschaft gem. BGB: Dieses Kapitel analysiert das Schriftformerfordernis der Bürgschaft nach §§ 766, 780, 781 BGB. Es wird die gesetzliche Regelung detailliert erläutert, die Funktion und die Schutzzwecke des Schriftformerfordernisses im bürgerlichen Recht untersucht (einschließlich Ziele, Methode und Konsequenzen), die Rechtsprechung und das Meinungsbild dazu dargestellt und eine persönliche Würdigung vorgenommen. Die Analyse beleuchtet die Schutzfunktion der Schriftform für den Bürgen und die Bedeutung der Formvorschriften für die Wirksamkeit der Bürgschaftsverpflichtung.
C: Formerfordernis des Schuldanerkenntnisses und des Schuldversprechens gem. BGB: Hier wird das Schriftformerfordernis bei Schuldanerkenntnissen und Schuldversprechen im Detail untersucht. Die gesetzlichen Regelungen für beide Rechtsgeschäfte werden separat erläutert, gefolgt von einer eingehenden Betrachtung der Schutzzwecke der Schriftform. Die Kapitel beleuchten die Rechtsprechung und Meinungsvielfalt zu diesem Thema und münden in einer persönlichen Bewertung der Autorin oder des Autors. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Schutzzwecke und den praktischen Konsequenzen der Schriftform für beide Vertragstypen.
D: Differenzierung des Formerfordernisses „Schriftform“ im Handelsverkehr: In diesem Kapitel werden die Unterschiede im Schriftformerfordernis zwischen dem allgemeinen Zivilrecht und dem Handelsrecht herausgearbeitet. Die gesetzlichen Regelungen werden präsentiert, die Voraussetzungen und die Reichweite der Formfreiheit im Handelsverkehr werden detailliert untersucht, wobei der Fokus auf der Kaufmannseigenschaft der beteiligten Parteien und dem Abschluss des Geschäfts im Rahmen des Handelsbetriebs liegt. Die Arbeit beleuchtet das Meinungsbild zu diesem Thema und schließt mit einer persönlichen Würdigung der Autorin oder des Autors, die die praktischen Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen im Zivil- und Handelsrecht verdeutlicht.
E: Exkurs: Bürgschaft als Haustürgeschäft: Dieser Exkurs behandelt die Besonderheiten, die auftreten, wenn eine Bürgschaft im Rahmen eines Haustürgeschäfts abgeschlossen wird. Es wird der spezifische Schutzbedarf in solchen Situationen beleuchtet und die rechtlichen Konsequenzen untersucht.
Schlüsselwörter
Schriftform, Bürgschaft, Schuldanerkenntnis, Schuldversprechen, BGB, HGB, Schutzzweck, Formfreiheit, Handelsverkehr, Rechtsprechung, Meinungsbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Schriftformerfordernisse im BGB und HGB
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Schutzzwecke besonderer Schriftformvorschriften im BGB, insbesondere bei Bürgschaften (§§ 766, 780, 781 BGB), Schuldanerkenntnissen und Schuldversprechen. Sie analysiert die Funktion und Auswirkungen des Schriftformerfordernisses im Zivilrecht und beleuchtet die Unterschiede im Handelsverkehr.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der gesetzlichen Regelungen zur Schriftform bei Bürgschaften, Schuldanerkenntnissen und Schuldversprechen, die Untersuchung der Schutzzwecke des Schriftformerfordernisses und deren Auswirkungen, die Bewertung der Rechtsprechung und herrschenden Meinung, den Vergleich der Schriftformvorschriften im Zivil- und Handelsrecht und die Einordnung der Bürgschaft als Haustürgeschäft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Formerfordernis der Bürgschaft gem. BGB, Formerfordernis des Schuldanerkenntnisses und des Schuldversprechens gem. BGB, Differenzierung des Formerfordernisses „Schriftform“ im Handelsverkehr und einen Exkurs zur Bürgschaft als Haustürgeschäft. Jedes Kapitel analysiert die jeweilige Thematik detailliert, einschließlich der gesetzlichen Grundlagen, Rechtsprechung, Meinungsbilder und einer persönlichen Würdigung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Funktion und die Auswirkungen des Schriftformerfordernisses im Zivilrecht zu analysieren und die Unterschiede im Handelsverkehr zu beleuchten. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis der Schutzzwecke der Schriftform bei verschiedenen Rechtsgeschäften vermitteln.
Welche Rechtsquellen werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich primär auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und teilweise auf das Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere auf die Paragraphen 766, 780 und 781 BGB, die das Schriftformerfordernis bei Bürgschaften regeln.
Wie wird die Rechtsprechung berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die relevante Rechtsprechung und das Meinungsbild zu den behandelten Themen. Sie analysiert die verschiedenen Standpunkte und integriert diese in die eigene Argumentation.
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Schriftformerfordernis im Zivil- und Handelsrecht?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede im Schriftformerfordernis zwischen Zivil- und Handelsrecht, insbesondere die Voraussetzungen und Reichweite der Formfreiheit im Handelsverkehr, z.B. die Rolle der Kaufmannseigenschaft und des Abschlusses des Geschäfts im Handelsbetrieb.
Welche Bedeutung hat die Schriftform für den Schutz des Bürgen?
Die Arbeit beleuchtet die Schutzfunktion der Schriftform für den Bürgen und die Bedeutung der Formvorschriften für die Wirksamkeit der Bürgschaftsverpflichtung. Sie analysiert die Schutzzwecke der Schriftform und deren Auswirkungen auf die Rechtsposition des Bürgen.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Schriftform, Bürgschaft, Schuldanerkenntnis, Schuldversprechen, BGB, HGB, Schutzzweck, Formfreiheit, Handelsverkehr, Rechtsprechung, Meinungsbild.
Wie wird die Bürgschaft als Haustürgeschäft behandelt?
Die Arbeit enthält einen Exkurs, der die Besonderheiten von Bürgschaften im Rahmen von Haustürgeschäften behandelt und den spezifischen Schutzbedarf in solchen Situationen beleuchtet.
- Quote paper
- Michael Wohlatz (Author), 2005, Schutzzwecke besonderer 'Schriftform' am Beispiel der §§ 766, 780, 781 BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36343