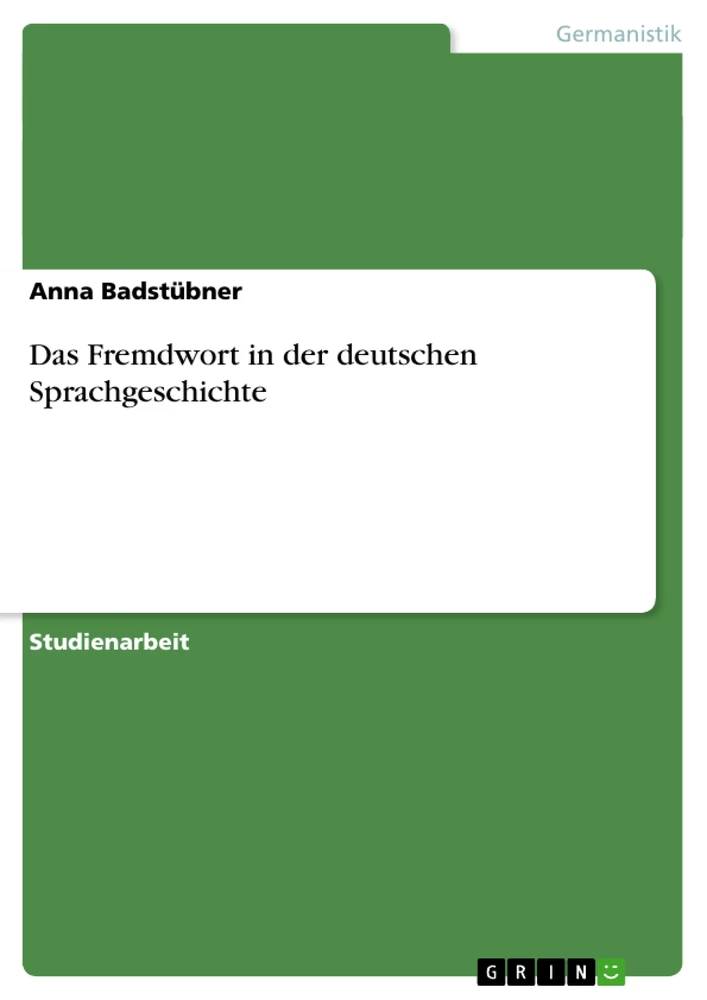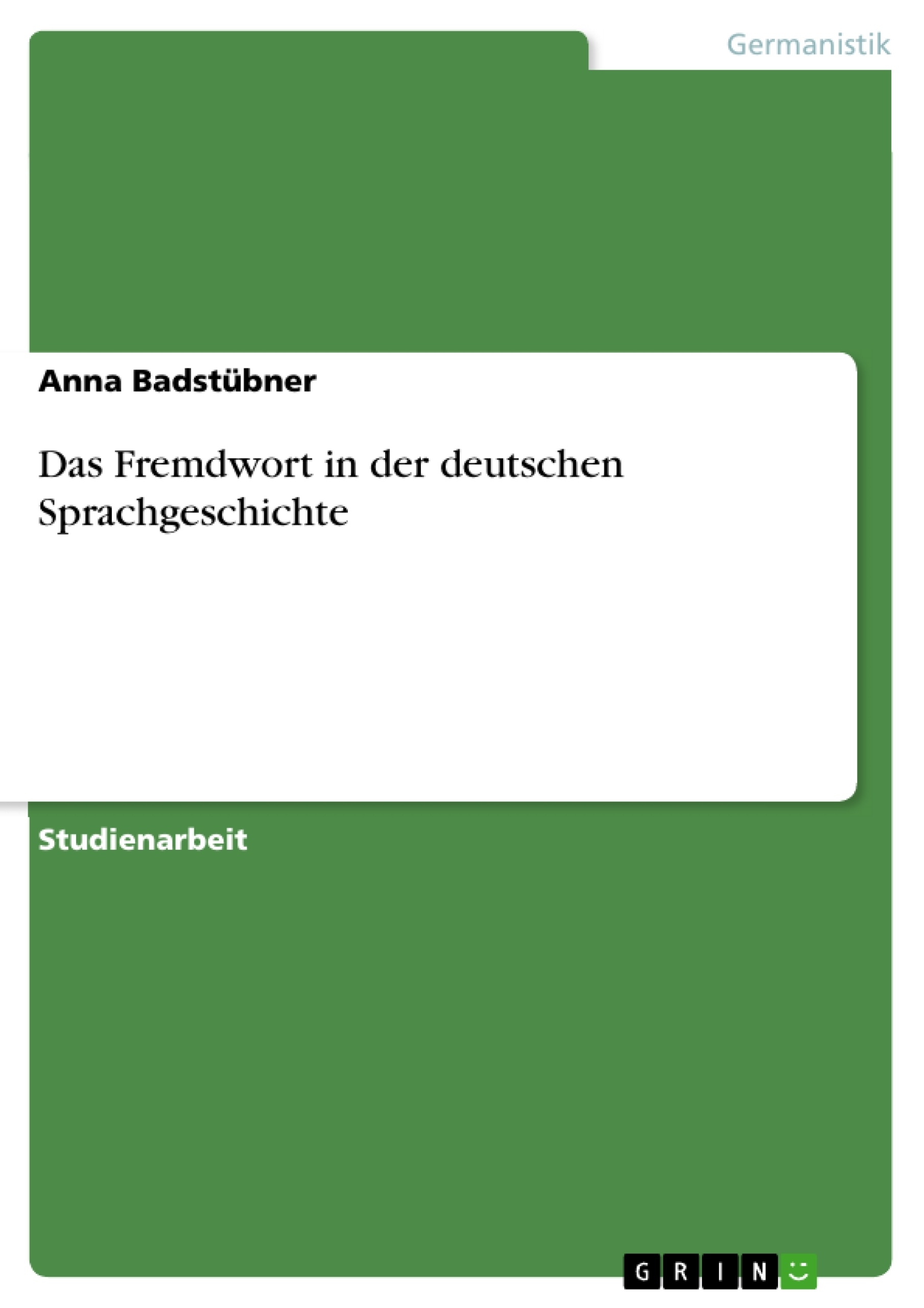Einführung
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit der Bewertung von Fremdwörtern in der Sprachgeschichte des Deutschen. In Anlehnung an Gardt (2001) habe ich eine Vorgehensweise gewählt, die sich nicht chronologisch orientiert, sondern sich auf unterschiedliche „Diskurse“ (Gardt, 2001, 30), unterschiedliche Herangehensweisen bezieht. Schon seit der frühen Neuzeit können diese Diskurse in der Bewertung von Fremdwörtern angetroffen werden. Auch die Geschichte des Neuhochdeutschen wird durch die Diskussion über den Einfluss fremder Sprachen geprägt. So gibt es auch heute noch Vertreter für die verschiedensten Argumente, die innerhalb dieser Diskurse ausschlaggebend sind. Bevor ich auf die Diskurse im Einzelnen eingehe, möchte ich zunächst noch einige allgemeine Bemerkungen zum Thema voranstellen. Die Geschichte einer Sprache wird stets maßgeblich durch die Einstellungen ihrer Sprecher beeinflusst (vgl. Gardt, 2001). Die Bewertung von Fremdwörtern wurde im Laufe der Geschichte „von Grammatikern, Rhetorikern, Sprachtheoretikern und auch Ideologen“ (ebd., 31) vorgenommen. Entsprechend der jeweiligen Überzeugung fiel die Definition des Begriffs „Fremdwort“ unterschiedlich aus. Bei der Bewertung von Fremdwörtern wurden nicht nur die Merkmale des Sprachsystems beschrieben, gleichzeitig wurde das System auch normierend beeinflusst. Unter den Punkten zwei bis fünf werde ich mich mit verschiedenen Diskursen beschäftigen, die sich auf unterschiedliche Dimensionen des Fremdwortbegriffs beziehen. Dazu gehören der sprachstrukturelle, der sprachideologische, der sprachpädagogische und -soziologische und der sprachkritische bzw. sprachpflegerische Fremdwortdiskurs. Es ist nicht möglich, eine klare Abgrenzung unter ihnen vorzunehmen, da sie sich überlappen und jeweils eine Mischung verschiedener Aspekte darstellen. Wenn nicht anders vermerkt, beziehe ich mich auf die Ausführungen von Gardt (2001).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der sprachstrukturelle Fremdwortdiskurs
- 2.1 Die Ausdrucksseite
- 2.2 Die Inhaltsseite
- 3. Der sprachideologische Fremdwortdiskurs
- 3.1 Gemäßigter vs. radikaler Sprachpurismus
- 3.2 Kennzeichen des Sprachpurismus
- 3.3 Der Sprachpurismus in der Geschichte der deutschen Sprache
- 4. Der sprachpädagogische und -soziologische Fremdwortdiskurs
- 5. Der sprachkritische bzw. sprachpflegerische Fremdwortdiskurs
- 5.1 Stilistische Urteile
- 5.2 Kommunikationsspezifische bzw. ethische Urteile
- 6. Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewertung von Fremdwörtern in der deutschen Sprachgeschichte. Sie verfolgt einen diskursanalytischen Ansatz, der verschiedene Perspektiven auf die Thematik beleuchtet, anstatt einer rein chronologischen Darstellung. Die Arbeit analysiert die historischen und aktuellen Debatten um Fremdwörter und deren Integration in die deutsche Sprache.
- Der sprachstrukturelle Diskurs: Grammatische und lexikalische Aspekte der Fremdwörter.
- Der sprachideologische Diskurs: Sprachpurismus und dessen Einfluss auf die Bewertung von Fremdwörtern.
- Der sprachpädagogische und -soziologische Diskurs: Der Einfluss von Bildung und Gesellschaft auf den Umgang mit Fremdwörtern.
- Der sprachkritische und sprachpflegerische Diskurs: Stilistische und ethische Urteile über Fremdwörter.
- Die Entwicklung des Fremdwortverständnisses über die Jahrhunderte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Bewertung von Fremdwörtern in der deutschen Sprachgeschichte. Sie erläutert den gewählten diskursanalytischen Ansatz, der verschiedene historische und aktuelle Perspektiven auf den Umgang mit Fremdwörtern beleuchtet. Die Autorin kündigt die Analyse verschiedener Diskurse an, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, und betont den Einfluss von Grammatikern, Rhetorikern, Sprachtheoretikern und Ideologen auf die Definition und Bewertung des Begriffs "Fremdwort". Die Arbeit verdeutlicht, dass die Bewertung von Fremdwörtern nicht nur deskriptiv, sondern auch normativ war und die Entwicklung der deutschen Sprache beeinflusst hat.
2. Der sprachstrukturelle Fremdwortdiskurs: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die grammatischen und lexikalischen Aspekte von Fremdwörtern. Es analysiert verschiedene Definitionen von "Fremdwort" aus der Geschichte der deutschen Sprachwissenschaft und zeigt die Entwicklung der Terminologie auf. Es werden Merkmale der Ausdrucksseite (Aussprache, Schreibung, Wortbildung, Beugung) und der Inhaltsseite (Verbreitung, Lückenfüllung im Wortschatz) von Fremdwörtern untersucht. Es werden historische Beispiele zur Illustration der jeweiligen Aspekte verwendet, welche unterschiedliche Positionen im Umgang mit der Integration von Fremdwörtern in die deutsche Sprache aufzeigen.
2.1 Die Ausdrucksseite: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Aussprache, Schreibung, Wortbildung und Beugung von Fremdwörtern. Es wird die Entwicklung der deutschen Rechtschreibung in Bezug auf Fremdwörter von der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert beleuchtet. Die unterschiedlichen Positionen (historische vs. phonetische Schreibweise) werden dargestellt und die Debatten um die Integration von Fremdwörtern in die deutsche Sprache werden in den Kontext historischer und bildungspolitischer Entwicklungen gesetzt. Die lang anhaltende Problematik der orthographischen Unsicherheiten im Umgang mit Fremdwörtern wird ebenfalls thematisiert.
2.2 Die Inhaltsseite: Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung der Verbreitung von Fremdwörtern und ihre Funktion als Fachwörter bei der Schließung von Lücken im Wortschatz. Es wird erläutert, dass die Akzeptanz von Fremdwörtern von ihrem Grad der Integration in den Sprachgebrauch abhängt, und der Einfluss von Fremdsprachenkenntnissen auf die heutige Wahrnehmung von Fremdwörtern wird diskutiert. Die Rolle von Fremdwörtern bei der Bezeichnung neuer Sachverhalte, insbesondere in der Informationstechnologie, wird ebenfalls hervorgehoben, sowie frühe Versuche im 17. Jahrhundert, diese Lücken mit neu geschaffenen deutschen Wörtern zu schließen.
Schlüsselwörter
Fremdwörter, deutsche Sprachgeschichte, Sprachpurismus, Sprachdiskurs, Lexik, Grammatik, Wortbildung, Integration, Lehnwörter, Sprachwandel, Orthographie, Sprachideologie, Sprachpädagogik, Sprachkritik, Sprachpflege.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bewertung von Fremdwörtern in der deutschen Sprachgeschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bewertung von Fremdwörtern in der deutschen Sprachgeschichte. Sie verwendet einen diskursanalytischen Ansatz und beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Thematik, anstatt einer rein chronologischen Darstellung. Analysiert werden die historischen und aktuellen Debatten um Fremdwörter und deren Integration in die deutsche Sprache.
Welche Diskurse werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vier Hauptdiskurse: den sprachstrukturellen (grammatische und lexikalische Aspekte), den sprachideologischen (Sprachpurismus und dessen Einfluss), den sprachpädagogischen und -soziologischen (Einfluss von Bildung und Gesellschaft), und den sprachkritischen bzw. sprachpflegerischen (stilistische und ethische Urteile) Diskurs. Jeder Diskurs wird in einzelnen Kapiteln detailliert untersucht.
Was versteht man unter dem sprachstrukturellen Diskurs?
Der sprachstrukturelle Diskurs konzentriert sich auf die grammatischen und lexikalischen Aspekte von Fremdwörtern. Er analysiert verschiedene Definitionen von "Fremdwort" aus der Geschichte der deutschen Sprachwissenschaft und untersucht Merkmale der Ausdrucksseite (Aussprache, Schreibung, Wortbildung, Beugung) und der Inhaltsseite (Verbreitung, Lückenfüllung im Wortschatz).
Was ist der Fokus des sprachideologischen Diskurses?
Der sprachideologische Diskurs befasst sich mit Sprachpurismus und dessen Einfluss auf die Bewertung von Fremdwörtern. Er untersucht gemäßigten versus radikalen Sprachpurismus, Kennzeichen des Sprachpurismus und dessen Geschichte in der deutschen Sprache.
Wie werden sprachpädagogische und -soziologische Aspekte behandelt?
Der sprachpädagogische und -soziologische Diskurs untersucht den Einfluss von Bildung und Gesellschaft auf den Umgang mit Fremdwörtern. Wie wirkt sich Bildungsniveau und gesellschaftliche Normen auf die Akzeptanz und Verwendung von Fremdwörtern aus?
Was beinhaltet der sprachkritische und sprachpflegerische Diskurs?
Der sprachkritische und sprachpflegerische Diskurs analysiert stilistische und ethische Urteile über Fremdwörter. Es werden verschiedene Bewertungskriterien und deren historische Entwicklung untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einführung, sprachstruktureller Diskurs (inkl. Ausdrucks- und Inhaltsseite), sprachideologischer Diskurs, sprachpädagogischer und -soziologischer Diskurs, sprachkritischer und sprachpflegerischer Diskurs, und Zusammenfassung und Schlusswort. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Diskurses.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Fremdwörter, deutsche Sprachgeschichte, Sprachpurismus, Sprachdiskurs, Lexik, Grammatik, Wortbildung, Integration, Lehnwörter, Sprachwandel, Orthographie, Sprachideologie, Sprachpädagogik, Sprachkritik, Sprachpflege.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen diskursanalytischen Ansatz, der verschiedene historische und aktuelle Perspektiven auf den Umgang mit Fremdwörtern beleuchtet.
Welche Erkenntnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die historische Entwicklung der Bewertung von Fremdwörtern in der deutschen Sprache, den Einfluss verschiedener Diskurse auf diese Bewertung und die Bedeutung von sprachstrukturellen, ideologischen, pädagogischen, soziologischen, kritischen und pflegeaspekten.
- Citar trabajo
- Anna Badstübner (Autor), 2004, Das Fremdwort in der deutschen Sprachgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36265