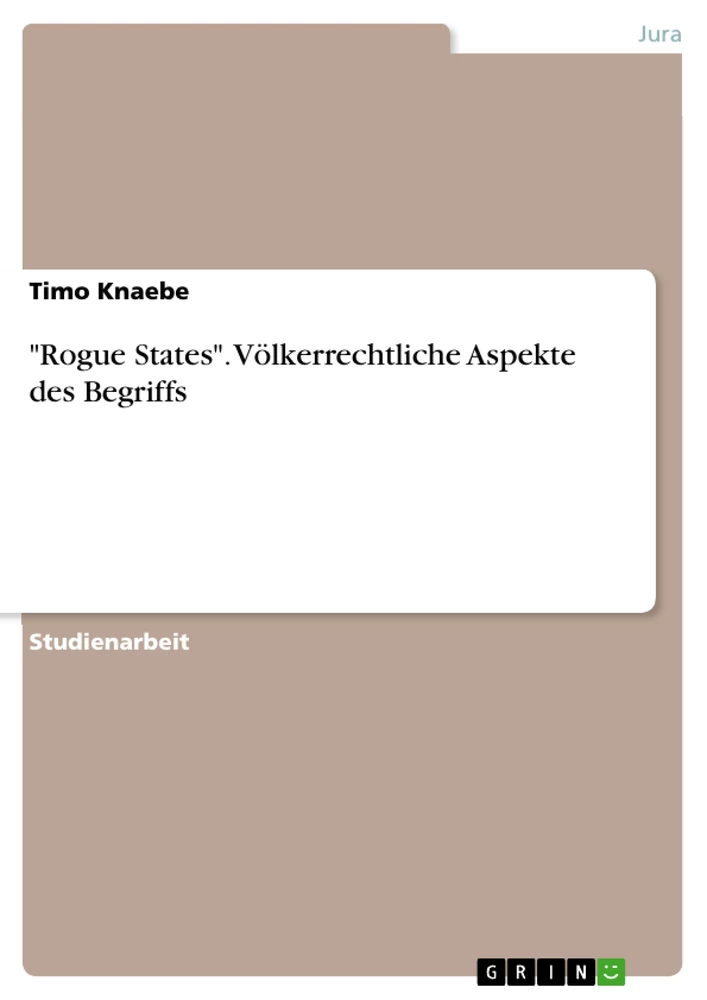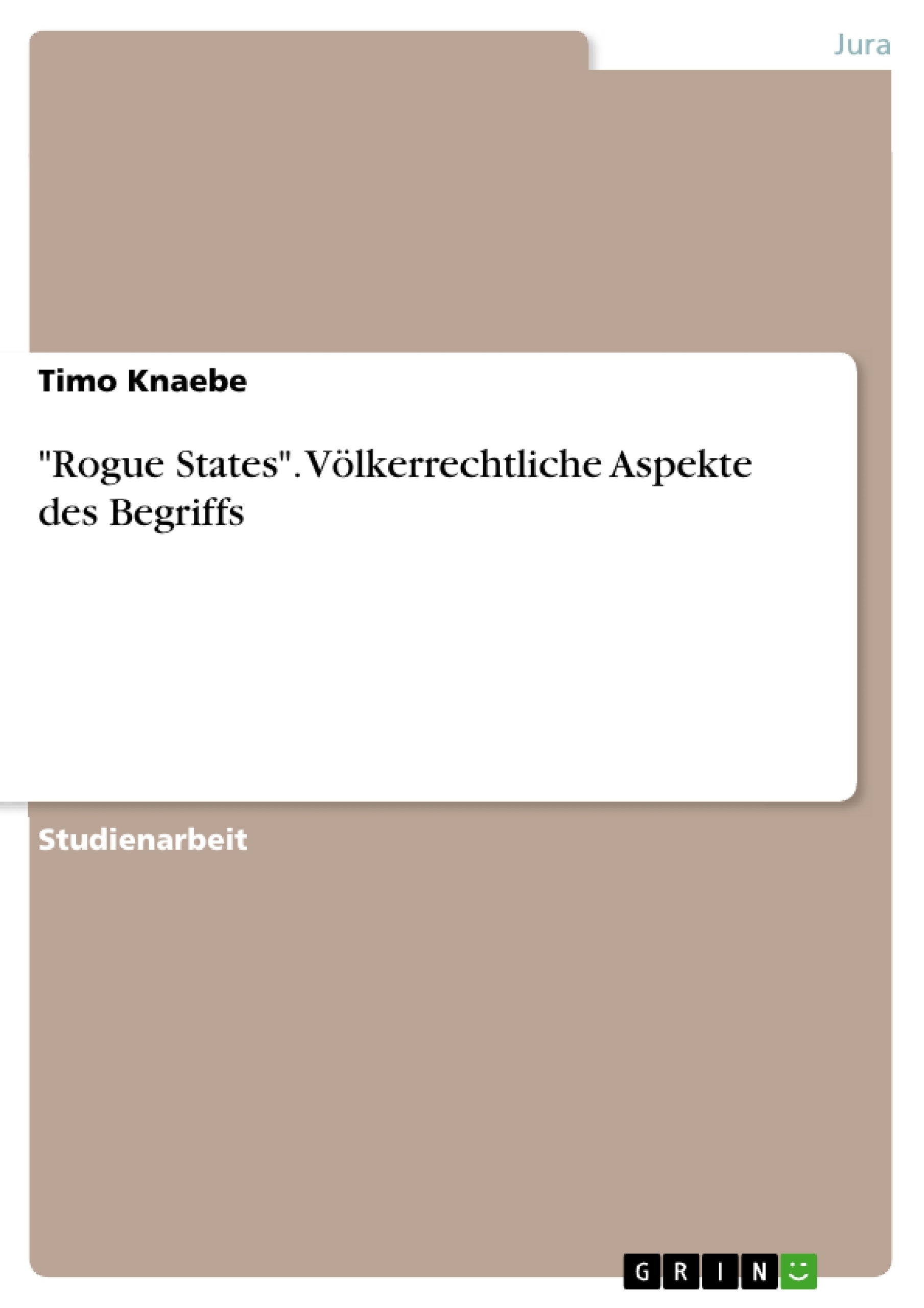Einleitung
Spätestens seit 1994 warnen die USA vor einer neuen Bedrohung – der durch Rogue States, was ins Deutsche zumeist mit Schurkenstaat1 übersetzt wird. Synonym zu diesem werden auch die Begriffe Outlaw, Pariah- oder Backlash-State2 und vor allem für die Staaten Nord Korea, Iran und Kuba die Bezeichnung Axis of Evil verwandt. Wenngleich die se Begriffe in den Medien vieler Länder aufgegriffen wurden, so werden sie nur von wenigen Staaten, neben den USA durch das Vereinigte Königreich und die Ukraine, auch offiziell verwandt.
Bis heute gänzlich ablehnend gegenüber diesen Begriffen ist die Haltung der Permanent Five- Länder Russland, Frankreich und China. Nach ihrer Auffassung benutzten die USA den Term Schurkenstaaten, der als Sammelbegriff Gegenstand dieser Arbeit ist, nur, um so eine Rechtfertigung für den Aufbau eines Nationalen Raketenabwehrsystems zu scha ffen3. Unklar bleibt also, ob demnach ein (zwischenstaatliches) Einvernehmen über die rechtliche Existenz von Schurkenstaaten besteht, also lediglich die Verwendung dieses Begriffs im Verkehr zwischen den Staaten unterschiedlich gehandhabt wird oder ob es sich um ein bloßes Konstrukt, handelt, das (zumeist) unilaterale Vorgehen der USA gegen diese Staaten polisch und völkerrechtlich zu rechtfe rtigen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Herausarbeitung des Begriffs unter rein völkerrechtlichen Aspekten – bewusst außen vor gelassen wurde eine Einarbeitung der lediglich politisch kontrovers diskutierten Irak Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Definitionsansätze
- 1. Juristische Definition
- 2. Politische Verwendung
- 3. Philosophischer Ansatz
- III. Zwischenfazit
- IV. Vom Rogue State zum State of Concern und Zurück
- V. Konstruktion
- VI. Der Rogue State als völkerrechtliche Rechtsfigur
- 1. Feindstaatenklausel, Art. 107 UN-Charta
- 2. Selbstverteidigungsrecht auf Grund permanenter Bedrohung
- 3. Rogue State gleich Failed State?
- 4. Rogue State als staatliche Übung
- VII. Vorgehen der USA gegen Rogue States
- 1. Engagement und Containment Politik
- 2. Secondary Sanctions
- 3. Aufhebung der Staatenimmunität
- VIII. Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff des "Rogue State" aus völkerrechtlicher Perspektive. Ziel ist es, verschiedene Definitionsansätze zu analysieren und die völkerrechtliche Relevanz dieser Bezeichnung zu beleuchten. Dabei werden die Strategien der USA im Umgang mit als "Rogue States" eingestuften Ländern untersucht.
- Definition und Verwendung des Begriffs "Rogue State"
- Völkerrechtliche Implikationen der "Rogue State"-Einstufung
- Strategien der USA im Umgang mit "Rogue States"
- Der Vergleich von "Rogue States" und "Failed States"
- Die Rolle des Völkerrechts im 21. Jahrhundert im Kontext von "Rogue States"
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel dürfte den Kontext und die Bedeutung des Themas "Rogue States" im Völkerrecht des 21. Jahrhunderts skizzieren und die Forschungsfrage formulieren. Es wird voraussichtlich den Rahmen der Arbeit setzen und die zentralen Forschungsfragen und methodischen Ansätze vorstellen.
II. Definitionsansätze: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen des Begriffs "Rogue State", einschließlich juristischer, politischer und philosophischer Ansätze. Es wird vermutlich verschiedene Interpretationen des Begriffs beleuchten und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition hervorheben. Die verschiedenen Fallstudien (Indonesien, Pakistan, Syrien, Kuba, Volksrepublik China) werden wahrscheinlich die unterschiedlichen politischen und völkerrechtlichen Kontexte verdeutlichen, in denen der Begriff angewendet wird, und die Komplexität der Beurteilung von Staaten als "Rogue States" aufzeigen. Der Vergleich der verschiedenen Ansätze wird die Mehrdeutigkeit des Begriffs und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise unterstreichen.
III. Zwischenfazit: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Definitionen zusammen und bereitet den Weg für die weitere Analyse. Es wird voraussichtlich die zentralen Herausforderungen bei der Definition von "Rogue States" zusammenfassen und einen Übergang zu den folgenden Kapiteln bilden, welche die völkerrechtlichen Implikationen und das Vorgehen der USA untersuchen.
IV. Vom Rogue State zum State of Concern und Zurück: Dieses Kapitel dürfte den dynamischen Charakter der Einstufung als "Rogue State" beleuchten und die Möglichkeit einer Veränderung des Status eines Staates untersuchen. Es wird wahrscheinlich den Einfluss von politischen und geostrategischen Faktoren auf die Einstufung und die damit verbundenen Konsequenzen thematisieren.
V. Konstruktion: Dieses Kapitel befasst sich vermutlich mit der Konstruktion des Begriffs "Rogue State" und den damit verbundenen Machtstrukturen. Es wird wahrscheinlich analysieren, wie die Einstufung als "Rogue State" genutzt wird, um politische Ziele zu verfolgen und welche Akteure an der Konstruktion und Anwendung dieses Begriffs beteiligt sind.
VI. Der Rogue State als völkerrechtliche Rechtsfigur: Dieses Kapitel untersucht die völkerrechtliche Relevanz des Begriffs "Rogue State", insbesondere im Hinblick auf die Feindstaatenklausel (Art. 107 UN-Charta), das Selbstverteidigungsrecht und die Frage, ob ein "Rogue State" mit einem "Failed State" gleichgesetzt werden kann. Es wird vermutlich die völkerrechtlichen Grenzen und Möglichkeiten im Umgang mit "Rogue States" diskutieren und die Anwendung völkerrechtlicher Prinzipien auf diese Situationen analysieren. Die Einordnung der "Rogue State"-Thematik innerhalb des bestehenden Völkerrechts wird den Schwerpunkt bilden.
VII. Vorgehen der USA gegen Rogue States: Dieses Kapitel analysiert die Strategien der USA im Umgang mit "Rogue States", einschließlich Engagement-, Containment-Politik, Sekundärsanktionen und der Aufhebung der Staatenimmunität. Es wird die Wirksamkeit und die rechtlichen und ethischen Implikationen dieser Strategien untersuchen und möglicherweise kritische Punkte und Kontroversen ansprechen.
Schlüsselwörter
Rogue State, Völkerrecht, Internationales Recht, USA, Außenpolitik, Failed State, Selbstverteidigung, Sanktionen, Staatenimmunität, UN-Charta, Konfliktprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rogue States" im Völkerrecht
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Begriff des "Rogue State" aus völkerrechtlicher Perspektive. Sie untersucht verschiedene Definitionsansätze, die völkerrechtliche Relevanz dieser Bezeichnung und die Strategien der USA im Umgang mit als "Rogue States" eingestuften Ländern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Verwendung des Begriffs "Rogue State", die völkerrechtlichen Implikationen der "Rogue State"-Einstufung, die Strategien der USA im Umgang mit "Rogue States", den Vergleich von "Rogue States" und "Failed States" sowie die Rolle des Völkerrechts im 21. Jahrhundert im Kontext von "Rogue States". Es werden juristische, politische und philosophische Definitionsansätze betrachtet und die völkerrechtlichen Grundlagen, wie z.B. die Feindstaatenklausel (Art. 107 UN-Charta) und das Selbstverteidigungsrecht, untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Definitionsansätze, Zwischenfazit, Vom Rogue State zum State of Concern und Zurück, Konstruktion des Begriffs, Der Rogue State als völkerrechtliche Rechtsfigur, Vorgehen der USA gegen Rogue States und Schlussfazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Definition und endend mit einer umfassenden Analyse der US-amerikanischen Strategien und der völkerrechtlichen Implikationen.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt verschiedene Fallstudien (Indonesien, Pakistan, Syrien, Kuba, Volksrepublik China) um die unterschiedlichen politischen und völkerrechtlichen Kontexte zu verdeutlichen, in denen der Begriff "Rogue State" angewendet wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Rogue State, Völkerrecht, Internationales Recht, USA, Außenpolitik, Failed State, Selbstverteidigung, Sanktionen, Staatenimmunität, UN-Charta, Konfliktprävention.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage zielt auf die Analyse verschiedener Definitionsansätze des Begriffs "Rogue State" und die Beleuchtung der völkerrechtlichen Relevanz dieser Bezeichnung ab. Zusätzlich wird untersucht, wie die USA mit als "Rogue States" eingestuften Ländern umgehen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine völkerrechtliche Perspektive und analysiert verschiedene Definitionsansätze des Begriffs "Rogue State". Die Methodik beinhaltet die Untersuchung von Literatur und Fallstudien um die völkerrechtlichen Implikationen und die Strategien der USA zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Schlussfazit zusammengefasst. Es ist zu erwarten, dass die Arbeit die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Rogue State" und die Herausforderungen bei seiner Anwendung im Völkerrecht hervorhebt. Sie dürfte auch die komplexen Zusammenhänge zwischen der Einstufung als "Rogue State" und den politischen Strategien der USA beleuchten.
- Quote paper
- LL.M. Timo Knaebe (Author), 2004, "Rogue States". Völkerrechtliche Aspekte des Begriffs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36229