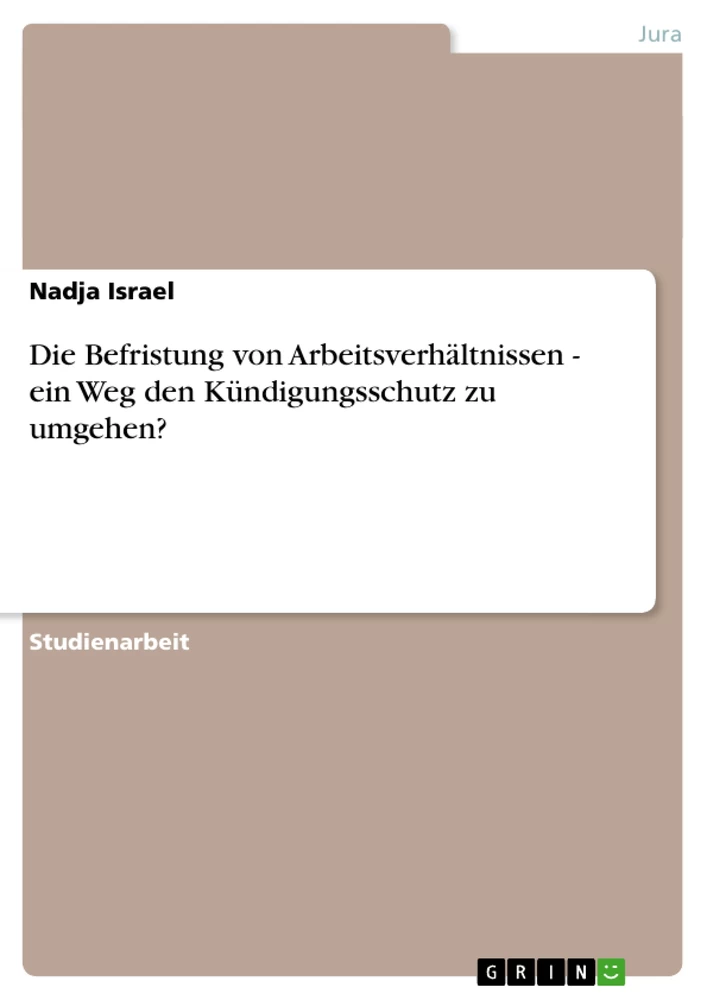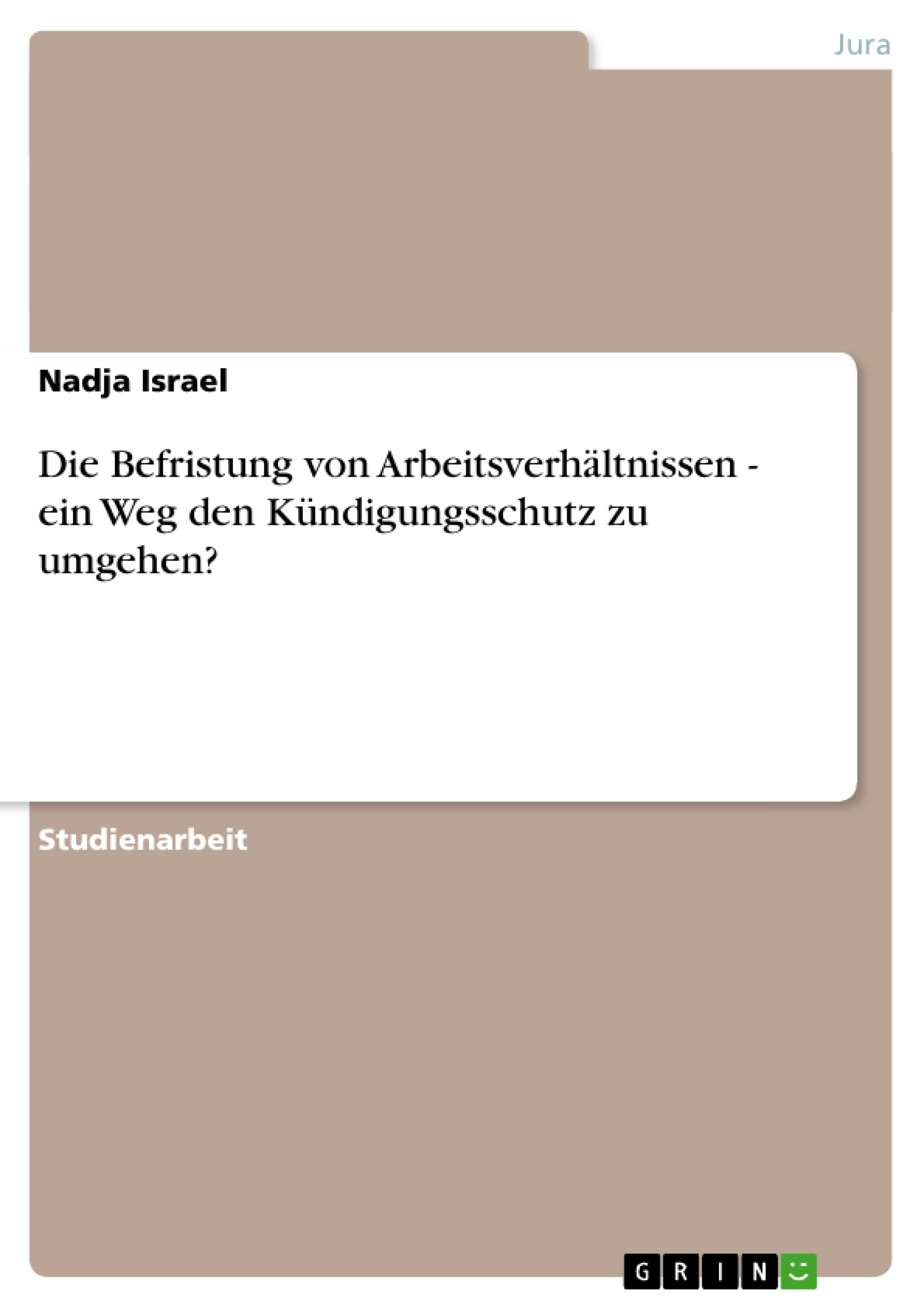Abbildung 1 zeigt eine Eurostat-Statistik, die herausfand, dass sich im Jahr 2000 13,1 % aller weiblichen und 12,5 % aller männlich Beschäftigten in Deutschland in befristeten Arbeitsverhältnissen befanden. Der größte Teil davon waren Auszubildende und Praktikanten. Deutschland ist damit nahe an dem europäischen Durchschnitt, der bei 15 % der Frauen und 13 % der Männer liegt.1 [...] In der Praxis ist es oft üblich neuen Mitarbeitern an einen befristeten Arbeitsvertrag anzubieten. Und aufgrund der derzeitig schlechten Konjunkturlage und Situation auf dem Arbeitsmarkt kann es sich kaum ein Arbeitssuchender erlauben einen Vertrag aufgrund der befristeten Dauer auszuschlagen, noch weniger ausgelernte Auszubildende. Für die Unternehmen gilt es so flexibel wie möglich zu bleiben, um sich den Auftragsänderungen der Kunden schnell anpassen zu können. So können sie sich heutzutage bei Auftragsrückgängen schnell und einfach von befristeten Beschäftigten trennen indem sie den Arbeitsvertrag auslaufen lassen und sich im Fall von Nachfragesteigerungen Leiharbeitnehmern bedienen, die qualifizierter und i. d. R. preiswerter sind als Festangestellte. Unbefristete Verträge werden häufig nur noch in Bereichen mit einer hohen Spezialisierung wie dem Entwicklungsbereich geschlossen. Das erste Gesetz über befristete Arbeitsverhältnisse wurde 1985 verabschiedet und bis heute mehrmals verlängert und verändert, mit dem Ziel, Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern. Aus der Eurostat-Statistik aus dem Jahr 2000 ist weiterhin erkennbar, dass sich zwischen 1992 und 2000 der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse bei männlich befristeten Arbeitnehmer um 2,4 und bei Frauen um 1,9 Prozentpunkte erhöhte.2 Ob die verabschiedeten Gesetze aber tatsächlich eine positive Wirkung auf die Gesamtzahl der Beschäftigungsverhältnisse haben, ist hier die entscheidende Frage, die u. a. Gegenstand dieser Hausarbeit sein soll. 1 Vgl. Franco/Winqvist, S. 1. 2 Vgl. Franco/Winqvist, S. 3.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmer
- 1.2 Entstehung des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
- 1.3 Geltungsbereich des TzBfG
- 2. BEFRISTUNGSARTEN
- 2.1 Sachgrundbefristungen
- 2.2 Befristung ohne sachlichen Grund
- 3. MEHRFACHE BEFRISTUNGEN
- 3.1 Verlängerung
- 3.2 Kettenbefristung
- 3.3 Doppelbefristungen
- 4. BEENDIGUNG DES BEFRISTETEN ARBEITSVERHÄLTNISSES
- 4.1 Automatisches Auslaufen
- 4.2 Vorzeitige Kündigung
- 4.3 Fortsetzung trotz Beendigung
- 4.4 Rechtsstreit um die Wirksamkeit der Befristung
- 4.5 Folgen unwirksamer Befristung
- 5. KLEIN- UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
- 5.1 Neuregelungen für klein- und mittelständische Unternehmen
- 5.2 Bedeutung für klein- und mittelständische Unternehmen
- 6. VOR- UND NACHTEILE
- 6.1 Arbeitgeber
- 6.2 Arbeitnehmer
- 7. JÜNGSTE AUSWIRKUNG DER BEFRISTUNGSGESETZE
- 8. KRITISCHE EINSCHÄTZUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Befristung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland und analysiert, inwieweit diese Praxis als Umgehung des Kündigungsschutzes genutzt wird. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, verschiedene Arten der Befristung und deren Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein besonderer Fokus liegt auf klein- und mittelständischen Unternehmen.
- Rechtliche Grundlagen der Befristung von Arbeitsverträgen
- Arten der Befristung (Sachgrund, ohne Sachgrund, Mehrfachbefristungen)
- Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Relevanz für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
- Kritische Bewertung der Befristungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Dieses Kapitel führt in das Thema der Befristung von Arbeitsverträgen ein, definiert den Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers und beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) sowie dessen Geltungsbereich. Es legt die Grundlage für die folgenden Kapitel, indem es den Kontext und die rechtlichen Grundlagen des Themas etabliert.
2. BEFRISTUNGSARTEN: Hier werden die verschiedenen Arten der Befristung von Arbeitsverträgen detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Sachgrundbefristungen, die auf einem objektiv nachweisbaren Grund beruhen, und Befristungen ohne sachlichen Grund, die strengeren rechtlichen Anforderungen unterliegen. Das Kapitel analysiert die jeweiligen Voraussetzungen und Grenzen dieser Befristungsarten.
3. MEHRFACHE BEFRISTUNGEN: Dieses Kapitel befasst sich mit den komplexen rechtlichen Aspekten von mehrfachen Befristungen, einschließlich Verlängerungen, Kettenbefristungen und Doppelbefristungen. Es analysiert die Bedingungen, unter denen solche Befristungen zulässig sind, und die Rechtsprechung zu diesem Thema. Die möglichen Fallstricke für Arbeitgeber werden beleuchtet.
4. BEENDIGUNG DES BEFRISTETEN ARBEITSVERHÄLTNISSES: Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten der Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses, vom automatischen Auslaufen bis hin zur vorzeitigen Kündigung. Es untersucht die rechtlichen Folgen einer unwirksamen Befristung und die damit verbundenen Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die unterschiedlichen Szenarien und die jeweiligen rechtlichen Konsequenzen werden im Detail analysiert.
5. KLEIN- UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN: Dieses Kapitel betrachtet die spezifischen Auswirkungen der Befristungsregelungen auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Es beleuchtet die besonderen Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Nutzung befristeter Arbeitsverträge für KMU ergeben. Die Neuregelungen und deren Bedeutung für diese Unternehmensgruppe werden eingehend diskutiert.
6. VOR- UND NACHTEILE: Dieses Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile von befristeten Arbeitsverträgen sowohl aus der Perspektive der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer. Es werden die jeweiligen Interessenlagen und die damit verbundenen Argumente gegeneinander abgewogen. Die möglichen positiven und negativen Auswirkungen auf beide Seiten werden umfassend dargestellt.
7. JÜNGSTE AUSWIRKUNG DER BEFRISTUNGSGESETZE: In diesem Kapitel werden die jüngsten Entwicklungen und Auswirkungen der Befristungsgesetze beleuchtet. Aktuelle Rechtsprechung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Praxis werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Befristung, Arbeitsvertrag, Kündigungsschutz, Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Sachgrund, Kettenbefristung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU), Rechtliche Rahmenbedingungen, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Befristung von Arbeitsverträgen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Befristung von Arbeitsverträgen in Deutschland und analysiert, inwieweit diese Praxis als Umgehung des Kündigungsschutzes genutzt wird. Sie beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, verschiedene Arten der Befristung und deren Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mit besonderem Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die rechtlichen Grundlagen der Befristung, verschiedene Arten der Befristung (Sachgrund, ohne Sachgrund, Mehrfachbefristungen), die Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Relevanz für KMU und eine kritische Bewertung der Befristungspraxis. Die einzelnen Kapitel befassen sich detailliert mit der Einleitung, den verschiedenen Befristungsarten, Mehrfachbefristungen, der Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse, den Auswirkungen auf KMU, den Vor- und Nachteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den jüngsten Auswirkungen der Befristungsgesetze und einer kritischen Einschätzung.
Welche Arten von Befristungen werden unterschieden?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen Sachgrundbefristungen (mit objektiv nachweisbarem Grund) und Befristungen ohne sachlichen Grund (mit strengeren rechtlichen Anforderungen). Des Weiteren werden Mehrfachbefristungen wie Verlängerungen, Kettenbefristungen und Doppelbefristungen analysiert.
Wie wird die Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses behandelt?
Das Kapitel zur Beendigung beschreibt verschiedene Szenarien: automatisches Auslaufen, vorzeitige Kündigung, Fortsetzung trotz Beendigung, Rechtsstreitigkeiten um die Wirksamkeit und die Folgen einer unwirksamen Befristung. Die jeweiligen rechtlichen Konsequenzen werden detailliert untersucht.
Welche Bedeutung hat die Befristung für KMU?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Auswirkungen der Befristungsregelungen auf KMU, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Nutzung befristeter Arbeitsverträge für diese Unternehmensgruppe ergeben und diskutiert die Bedeutung der Neuregelungen.
Welche Vor- und Nachteile von befristeten Arbeitsverträgen werden betrachtet?
Die Vor- und Nachteile werden sowohl aus der Perspektive der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer betrachtet, wobei die jeweiligen Interessenlagen und Argumente gegeneinander abgewogen werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Befristung, Arbeitsvertrag, Kündigungsschutz, Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Sachgrund, Kettenbefristung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU), Rechtliche Rahmenbedingungen, Rechtsprechung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)?
Die Hausarbeit liefert einen umfassenden Überblick über das TzBfG und seine Relevanz für die Befristung von Arbeitsverträgen. Für weiterführende Informationen empfiehlt sich die Konsultation von Rechtsquellen und Fachliteratur zum Arbeitsrecht.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Hausarbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die behandelten Themen und Schwerpunkte jedes Abschnitts prägnant beschreibt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Befristung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland umfassend zu untersuchen und zu analysieren, inwieweit diese Praxis als Umgehung des Kündigungsschutzes genutzt wird. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, insbesondere in KMU.
- Quote paper
- Nadja Israel (Author), 2005, Die Befristung von Arbeitsverhältnissen - ein Weg den Kündigungsschutz zu umgehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36209