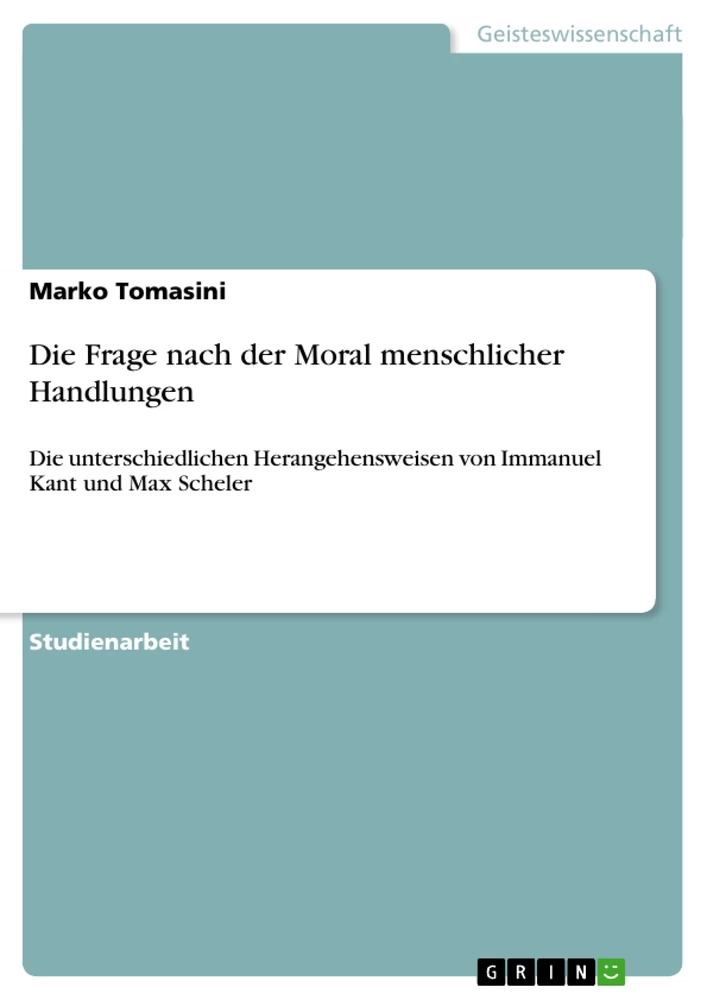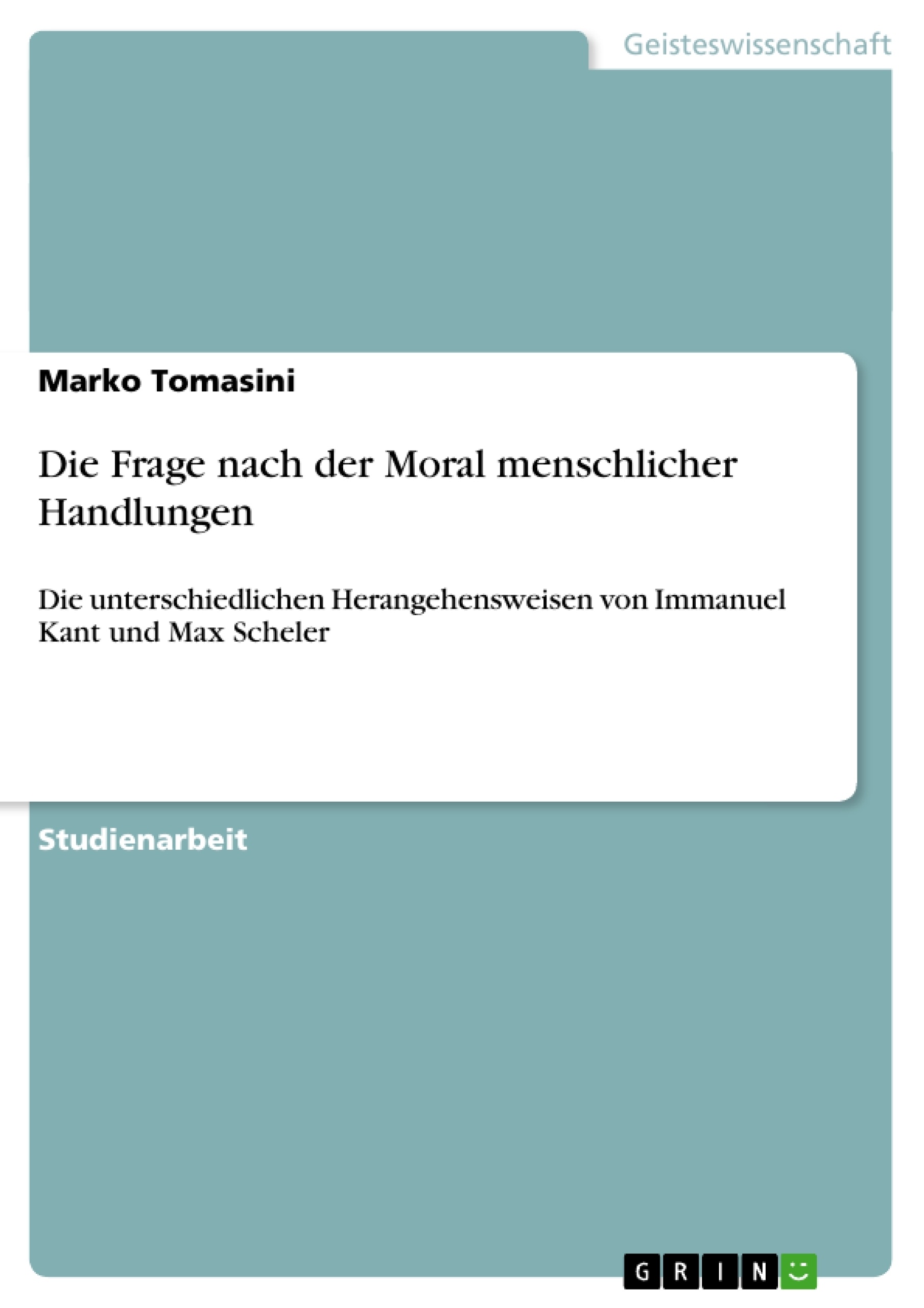Ethik ist der kritische Teil des sittlichen Denkens, welcher sich damit befassen muss, ob moralische Grundsätze und Überzeugungen einer Gesellschaft der Zeit angemessen sind oder aber, ob der gesellschaftliche Ethos überhaupt eine Berechtigung hat als moralisch angesehen zu werden. Diese kritische Hinterfragung, die sich letztendlich auf die allgemein üblichen Handlungsweisen der Menschen bezieht, kann allerdings höchst unterschiedlich ausfallen, je nachdem, nach was genau gefragt wird. Unterschiedliche ethische Ansätze, werden auch immer unterschiedliche Antworten hervorbringen.
Richtet der Utilitarismus (z.B.) sein Augenmerk allein auf den Nutzen den eine Handlung hervorzubringen vermag, so wenden sich andere ethische Prinzipien eher der Handlung selbst zu und hinterfragen die Verallgemeinerungsfähigkeit der Handlungen, ohne auf deren Absichten oder Folgen zu schauen. Verallgemeinerung von Handlungen, besagt nun, dass eine einmal gefundene ethisch korrekte Handlungsweise auch immer Gültigkeit haben muss bzw. dass Handlungen, die nicht verallgemeinerungsfähig sind, auch generell als moralisch falsch anzusehen sind. Andere Prinzipien (wie der angesprochene Utilitarismus, als wohl stärkster Gegensatz zur Pflichtmoral) gehen davon aus, dass es zwar Handlungen gibt, die man allgemein als gut bezeichnen kann („du sollst nicht lügen...“), dass aber diese Handlungen nicht in jeder Situation als moralisch angebracht gelten können. Nicht zu lügen am falschen Zeitpunkt, kann durchaus fatale Folgen für mich selbst, aber auch andere haben.
Anders als der Utilitarismus, schaut die Werteethik nicht direkt auf die Folgen von Handlungen, sondern auf die Qualität der Werte, die in diesen Handlungen liegen. Nach diesen Wertequalitäten gilt es Handlungen gegeneinander abzuwägen, um anschließend Handlungsweisen vorzuziehen bzw. zurückzustellen. In dieser Arbeit sollen zwei dieser ethischen Prinzipien gegenübergestellt und die Unterschiede in der Betrachtungsweise von menschlichen Handlungen deutlich gemacht werden. Das ist zum einem der „kategorische Imperativ“ von Kant als Vertreter der Pflichtenethik und zum anderen die Werteethik von Scheler. Scheler versucht mit seiner (durchaus auch religiös motivierten) Ethiktheorie, ein Gegenstück zur Ethik Kants zu finden, welche für ihn unzureichend ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der kategorische Imperativ
- 2.1 Vernunft und Freiheit
- 2.2 Das „wahrhaft Gute“
- 2.3 Die Pflicht
- 2.4 Die Formeln des kategorischen Imperativs
- 2.4.1 Die erste Formel
- 2.4.2 Die zweite Formel
- 2.4.3 Die dritte Formel
- 2.4.4 Die vierte und fünfte Formel
- 3. Materielle Werteethik
- 3.1 Die Werte bei Scheler
- 3.1.1 Die Rangordnung der Werte und moralisches Handeln
- 3.1.2 Die Rangordnung als Lösung des Problems der Pflichtenkollision
- 3.2 Scheler und die Pflicht
- 3.3 Das Problem des „Wertfühlens“
- 3.1 Die Werte bei Scheler
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht den kategorischen Imperativ Kants mit der materialen Werteethik Schelers. Ziel ist es, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen menschlicher Handlungen aufzuzeigen und die Unterschiede in den ethischen Ansätzen beider Philosophen herauszuarbeiten. Schelers Ethik wird als Gegenstück zu Kants Pflichtmoral präsentiert, die Scheler als unzureichend betrachtet.
- Der kategorische Imperativ als Ausdruck der Pflichtethik
- Die Rolle von Vernunft und Freiheit im Denken Kants
- Schelers materiale Werteethik und die Bedeutung von Werten
- Der Unterschied zwischen Pflicht und Wert in der Moralphilosophie
- Der Vergleich der beiden ethischen Systeme im Hinblick auf die Beurteilung menschlichen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ethik ein und erläutert die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit moralischen Grundsätzen und gesellschaftlichem Ethos. Sie hebt die unterschiedlichen ethischen Ansätze hervor, wie den Utilitarismus und die Pflichtethik, und kündigt den Vergleich des kategorischen Imperativs Kants mit der Werteethik Schelers an. Die Einleitung betont die unterschiedlichen Perspektiven auf das moralisch richtige Handeln, die im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert untersucht werden.
2. Der kategorische Imperativ: Dieses Kapitel behandelt den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Es klärt zunächst die zentralen Begriffe Vernunft und Freiheit im Kontext der Kantischen Philosophie. Die Unterscheidung zwischen Erscheinungswelt und intelligibler Welt wird erläutert, um die Grundlage des moralischen Handelns nach Kant zu verdeutlichen. Der "gute Wille" als einziges unbedingtes Gut wird definiert und von anderen Eigenschaften abgegrenzt. Die verschiedenen Formulierungen des kategorischen Imperativs werden angerissen, ohne jedoch im Detail auf sie einzugehen.
3. Materielle Werteethik: Dieses Kapitel widmet sich Schelers Werteethik. Es beschreibt Schelers Wertbegriff und die Rangordnung der Werte, die für moralisch richtige Handlungen entscheidend ist. Das Problem der Pflichtenkollision und wie die Rangordnung der Werte eine Lösung bietet wird diskutiert. Der Unterschied in der Sichtweise von Pflicht im Vergleich zu Kant wird erläutert. Schließlich wird das Konzept des "Wertfühlens" als zentralen Aspekt der Schelerschen Ethik thematisiert.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Immanuel Kant, Materielle Werteethik, Max Scheler, Pflichtethik, Werteethik, Vernunft, Freiheit, guter Wille, Werte, Pflichtenkollision, Wertfühlen, Moral, Handlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich von Kants kategorischem Imperativ und Schelers Werteethik
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über einen Vergleich zwischen Immanuel Kants kategorischem Imperativ und Max Schelers materialer Werteethik. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung der beiden ethischen Systeme und der Herausarbeitung ihrer Unterschiede hinsichtlich der Beurteilung menschlichen Handelns.
Welche Themen werden behandelt?
Der Text behandelt zentrale Aspekte der Kantischen Pflichtethik, insbesondere den kategorischen Imperativ, die Rolle von Vernunft und Freiheit, und den "guten Willen". Im Gegenzug wird Schelers materiale Werteethik mit ihrem Wertbegriff, der Rangordnung der Werte und dem "Wertfühlen" detailliert erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der beiden Ansätze, insbesondere hinsichtlich der Lösung von Pflichtenkollisionen und der unterschiedlichen Perspektiven auf moralisch richtiges Handeln.
Was ist der kategorische Imperativ nach Kant?
Der Text beschreibt den kategorischen Imperativ als Ausdruck der Kantischen Pflichtethik. Er erklärt die zentralen Begriffe Vernunft und Freiheit im Kontext der Kantischen Philosophie und die Unterscheidung zwischen Erscheinungswelt und intelligibler Welt. Der "gute Wille" wird als einziges unbedingtes Gut definiert. Die verschiedenen Formulierungen des kategorischen Imperativs werden angerissen, jedoch nicht im Detail behandelt.
Was ist Schelers materiale Werteethik?
Der Text erläutert Schelers Werteethik, inklusive seines Wertbegriffs und der für moralisch richtiges Handeln entscheidenden Rangordnung der Werte. Es wird diskutiert, wie diese Rangordnung das Problem der Pflichtenkollision löst. Der Unterschied zur Kantischen Pflichtmoral wird herausgestellt, und das Konzept des "Wertfühlens" als zentraler Aspekt der Schelerschen Ethik wird thematisiert.
Wie werden Kant und Scheler verglichen?
Der Vergleich zwischen Kant und Scheler bildet den Kern des Textes. Er zeigt die unterschiedlichen Betrachtungsweisen menschlichen Handelns auf und arbeitet die Unterschiede in den ethischen Ansätzen beider Philosophen heraus. Schelers Ethik wird als Gegenstück zu Kants Pflichtmoral präsentiert, die Scheler als unzureichend betrachtet. Der Vergleich umfasst die Rolle von Pflicht versus Wert, Vernunft versus Wertgefühl und die unterschiedlichen Lösungsansätze für moralische Konflikte.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen: Kategorischer Imperativ, Immanuel Kant, Materielle Werteethik, Max Scheler, Pflichtethik, Werteethik, Vernunft, Freiheit, guter Wille, Werte, Pflichtenkollision, Wertfühlen, Moral, Handlung.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text richtet sich an Leser, die sich für Ethik und Moralphilosophie interessieren und einen Überblick über die zentralen Konzepte von Kants kategorischem Imperativ und Schelers materialer Werteethik suchen. Er eignet sich insbesondere für akademische Zwecke, beispielsweise zur Vorbereitung auf Seminare oder zur Analyse ethischer Fragestellungen.
- Quote paper
- Marko Tomasini (Author), 2005, Die Frage nach der Moral menschlicher Handlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36019