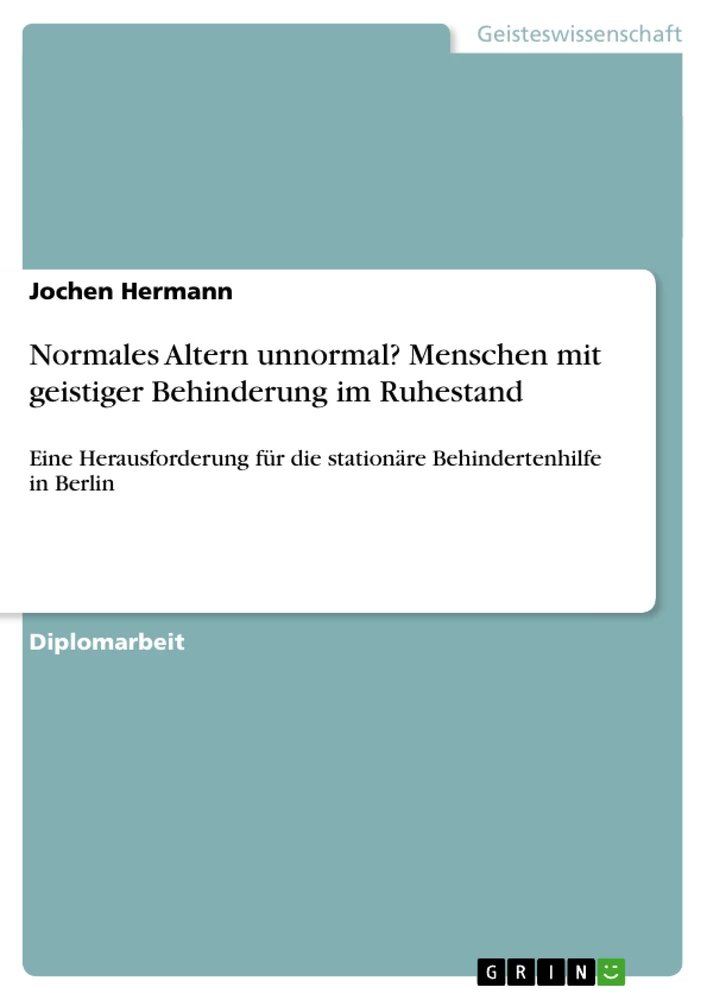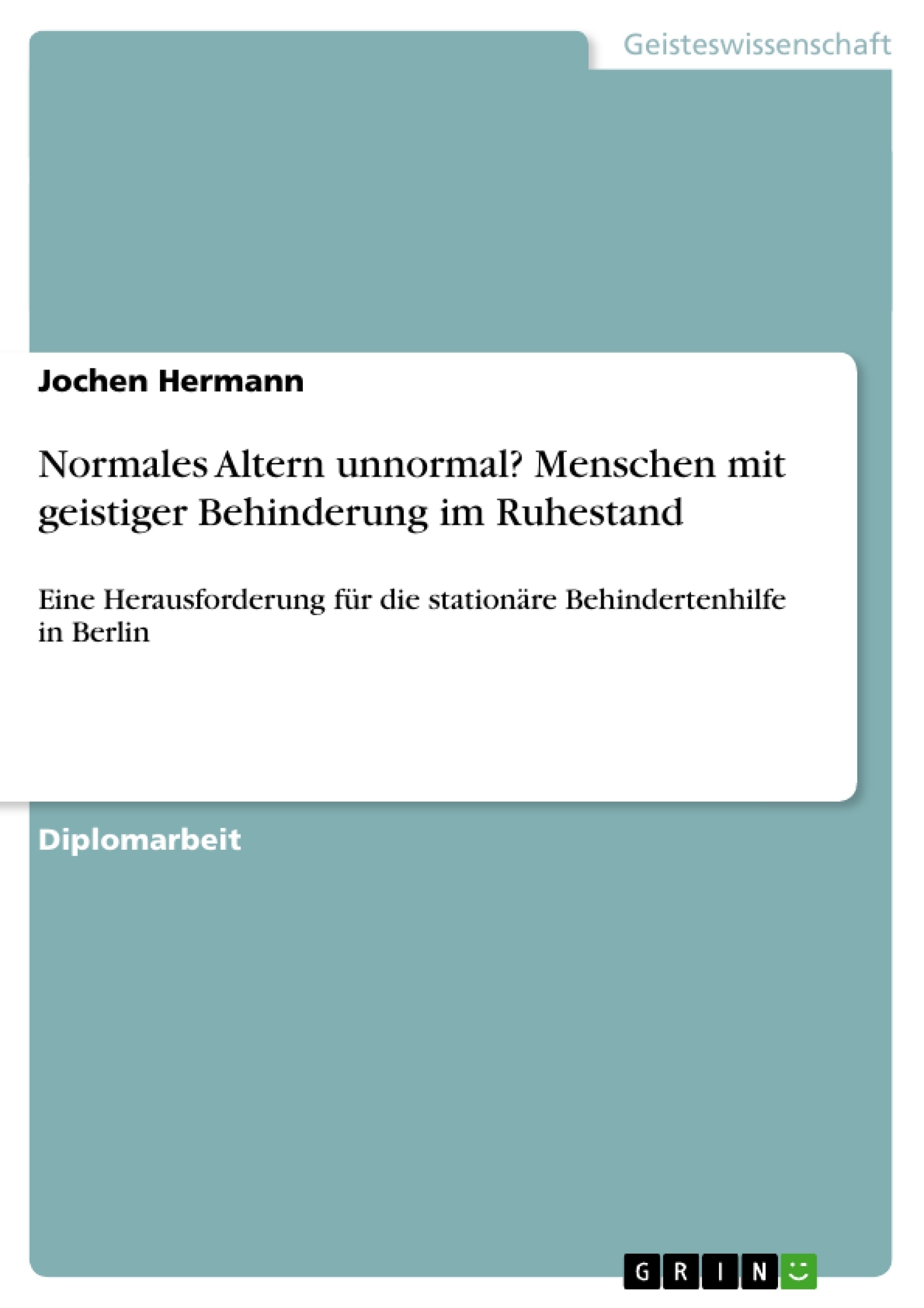Das zunehmende Altern der Gesellschaft in Deutschland ist mittlerweile ein tagespolitisches Thema. Fast wöchentlich werden wir mit neuen Reformideen im Bereich der Sozialsysteme konfrontiert. Dabei geht es fast ausschließlich um den Teil der Bevölkerung, der zu den Menschen ohne Behinderungen gerechnet wird.
Die stationäre Behindertenhilfe in Berlin zeigt, dass das Älterwerden und die damit einhergehenden Effekte nicht nur auf den Teil der Bundesbürger zutrifft, der in den Medien regelmäßig präsent ist.
Menschen ohne Behinderung scheiden aus dem Arbeitsleben aus und genießen in freier Selbstbestimmung ihren Ruhestand. Bewohner institutioneller Wohnformen haben feste Tagesstrukturen und sind durch diese fremdbestimmt. Ist daher überhaupt ein Ruhestand in einer stationären Wohnform mit den derzeitigen Strukturen der Behindertenhilfe möglich, und wie kann dieser ausgestaltet sein?
Die Darstellung des Altersquerschnitts in der stationären Behindertenhilfe in Berlin ist aus heutiger Sicht bisher nicht repräsentativ und aktuell dargestellt. Daher wurden 9 Wohneinrichtungen Berlins für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Bewohner befragt. Dem Vergleich der Angebotsinhalte mit den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner ist dabei eine gewichtige Rolle zugekommen.
Die Ergebnisse finden nachfolgend ihren Niederschlag. Einerseits wird dargestellt, welche heilpädagogischen Grundlagen ein Ruhestand in einer stationären Wohnform hat und wie andererseits die rechtlichen Voraussetzungen gelagert sind.
Daraus ergeben sich Anforderungen an die stationäre Behindertenhilfe in Berlin. Dabei geht es sowohl um Voraussetzungen, die die Einrichtungsträger schaffen müssen, um fachliche Anforderungen an die Mitarbeiter im Betreuungsdienst als auch um inhaltliche Ausgestaltungsmöglichkeiten der Betreuung und Assistenz von alten Menschen mit geistiger Behinderung im Ruhestand. Welche Rolle die politischen Entscheidungsträger dabei spielen können ist ebenfalls angeführt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist die maskuline Personalform gewählt. Dies schließt ausdrücklich die weibliche Form mit ein und hat keinerlei diskriminierende Bedeutung.
Unter Berücksichtigung des Datenschutzes sind die Fragebögen der einzelnen Einrichtungs- und Bewohnerbefragungen nicht enthalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Altern der Gesellschaft in Deutschland
- 2.1. Ursachen der demographischen Entwicklung
- 2.1.1. Die Entwicklung der Fertilität
- 2.1.2. Die Entwicklung der Mortalität
- 2.1.3. Die Entwicklung der Migration
- 2.2. Folgen des demographischen Wandels
- 3. Das Altern von Menschen mit geistiger Behinderung
- 3.1. Behinderung, Geistige Behinderung und Menschenbild
- 3.1.1. Behinderung
- 3.1.2. Geistige Behinderung - eine Frage des Menschenbildes
- 3.2. Definition des „alten“ Menschen mit geistiger Behinderung
- 3.3. Das Dritte Reich, die Euthanasie und die Auswirkungen
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Die Erfassung der Altersstruktur
- 4.1. Problemlage und Projekt
- 4.2. Handlungskonzept
- 4.3. Die Methodenauswahl
- 4.3.1. Die Methodenauswahl der Einrichtungsbefragung
- 4.3.1.1. Fragenevaluation der Einrichtungsbefragung
- 4.3.1.2. Der Fragebogen für die Leistungsanbieter
- 4.3.2. Die Methodenauswahl der Bewohnerbefragung
- 4.3.2.1. Fragesituation der Bewohnerbefragung
- 4.3.2.2. Fragenevaluation der Bewohnerbefragung
- 4.3.2.3. Der Fragebogen für die Bewohnerbefragung
- 4.4. Die Durchführung der Datensammlungen
- 4.4.1. Die Durchführung der Einrichtungsbefragung
- 4.4.1.1. Kontaktherstellung mit anderen Einrichtungen
- 4.4.1.2. Die Befragung zur Altersstruktur
- 4.4.2. Die Durchführung der Bewohnerbefragung
- 4.5. Die Auswertung der empirischen Erhebungen
- 4.5.1. Auswertung zur Altersstruktur in den befragten Einrichtungen
- 4.5.2. Auswertung zur internen Tagesstruktur in den befragten Einrichtungen
- 4.5.2.1. Auswertung der inhaltlichen Gestaltung der internen Tagesstruktur
- 4.5.2.2. Auswertung der Bewohnerbefragung in der internen Tagesstruktur
- 4.6. Zusammenfassung
- 5. Ruhestand im Behindertenheim
- 5.1. Aus dem Arbeitsleben ins Pflegeheim?
- 5.2. Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.2.1. Theoretisch-psychologische Aspekte
- 5.2.2. Der Zusammenhang zwischen dem Erleben von Heimat und dem Verhalten
- 5.2.3. Sicherheit und der Verlust der vertrauten Umgebung
- 5.3. Grundbedürfnisse von alten Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.4. Versorgungsstrukturelle Überlegungen
- Exkurs: Das Normalisierungsprinzip und Empowerment in der Behindertenhilfe
- E.1. Das Normalisierungsprinzip in Deutschland
- E.2. Empowerment, Independent Living, Self-Advocacy
- 5.5. Die rechtlichen Grundlagen für einen Ruhestand im Wohnheim
- 6. Die Anforderungen an das normale Altern
- 6.1. Die Anforderungen an die Wohneinrichtungsträger
- 6.1.1. Bauliche Voraussetzungen
- 6.1.2. Personelle Ressourcen
- 6.1.3. Angebotsstruktur
- 6.2. Anforderungen an Mitarbeiter, Teams und Betreuungsinhalte
- 6.2.1. Die Anforderungen an die Mitarbeiter und Teams
- 6.2.2. Die Anforderungen an die Betreuungsinhalte
- 6.3. Die Anforderungen an Kostenträger und Politik
- 7. Fazit und Ausblick
- Demographischer Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf die Behindertenhilfe
- Spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen im Alter von Menschen mit geistiger Behinderung
- Analyse der Altersstruktur in stationären Einrichtungen in Berlin
- Entwicklung eines Konzeptes für ein "normales" Altern im Wohnheim
- Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema des Alterns von Menschen mit geistiger Behinderung in stationären Einrichtungen in Berlin. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die aktuelle Situation der Altersstruktur in den Einrichtungen zu analysieren, die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für ein gelingendes Altern im Wohnheim zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Relevanz des Forschungsprojekts erläutert. Im zweiten Kapitel wird die demographische Entwicklung in Deutschland mit den Ursachen und Folgen des Alterns der Gesellschaft beschrieben. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage des Alterns von Menschen mit geistiger Behinderung. Es beleuchtet die Begrifflichkeiten von Behinderung und geistiger Behinderung im historischen und gesellschaftlichen Kontext, definiert das „alte“ Menschen mit geistiger Behinderung und geht auf die Auswirkungen des Dritten Reichs und der Euthanasie ein.
Im vierten Kapitel wird die empirische Erhebung beschrieben, die die Altersstruktur in stationären Einrichtungen in Berlin untersucht. Hier werden die Methodenauswahl, die Durchführung der Datensammlungen und die Auswertung der empirischen Erhebungen erläutert.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Ruhestand im Behindertenheim. Es analysiert die Herausforderungen, die sich aus dem Übergang vom Arbeitsleben in die stationäre Betreuung ergeben, und untersucht die Besonderheiten des Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Es werden die Grundbedürfnisse und die rechtlichen Grundlagen für einen Ruhestand im Wohnheim beleuchtet.
Im sechsten Kapitel werden die Anforderungen an das normale Altern von Menschen mit geistiger Behinderung beschrieben. Es werden die Anforderungen an die Wohneinrichtungsträger, an Mitarbeiter und Teams sowie an Kostenträger und Politik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Alterungsprozess, stationäre Behindertenhilfe, Demographischer Wandel, Normalisierungsprinzip, Empowerment, Altersstruktur, Ruhestand, Wohnheim, Betreuungsqualität, rechtliche Rahmenbedingungen
- Quote paper
- Jochen Hermann (Author), 2004, Normales Altern unnormal? Menschen mit geistiger Behinderung im Ruhestand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36016