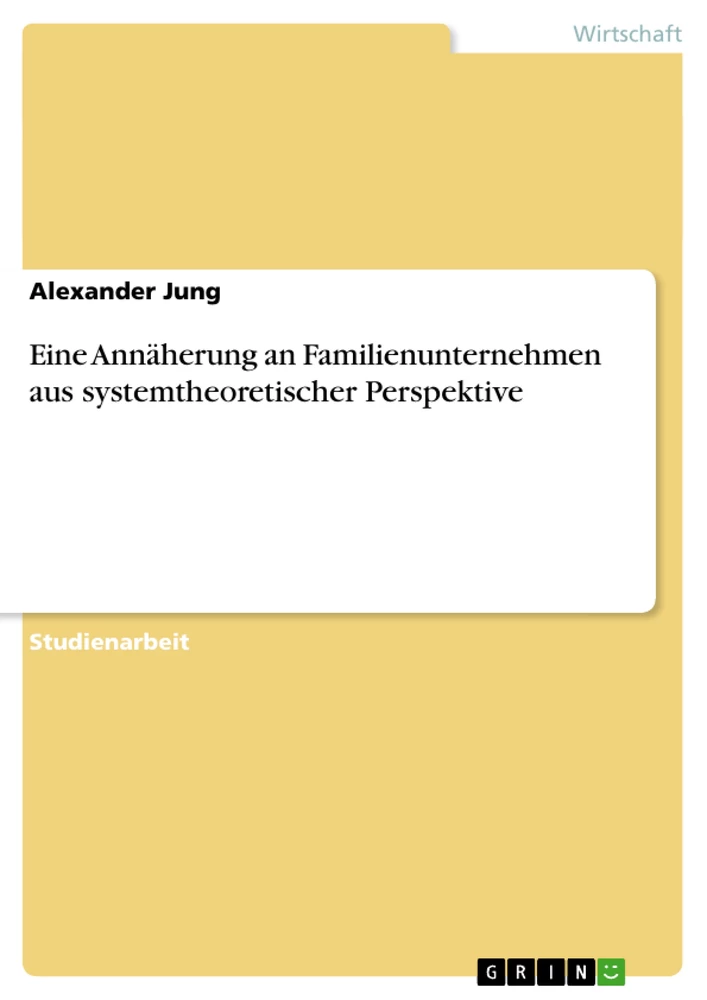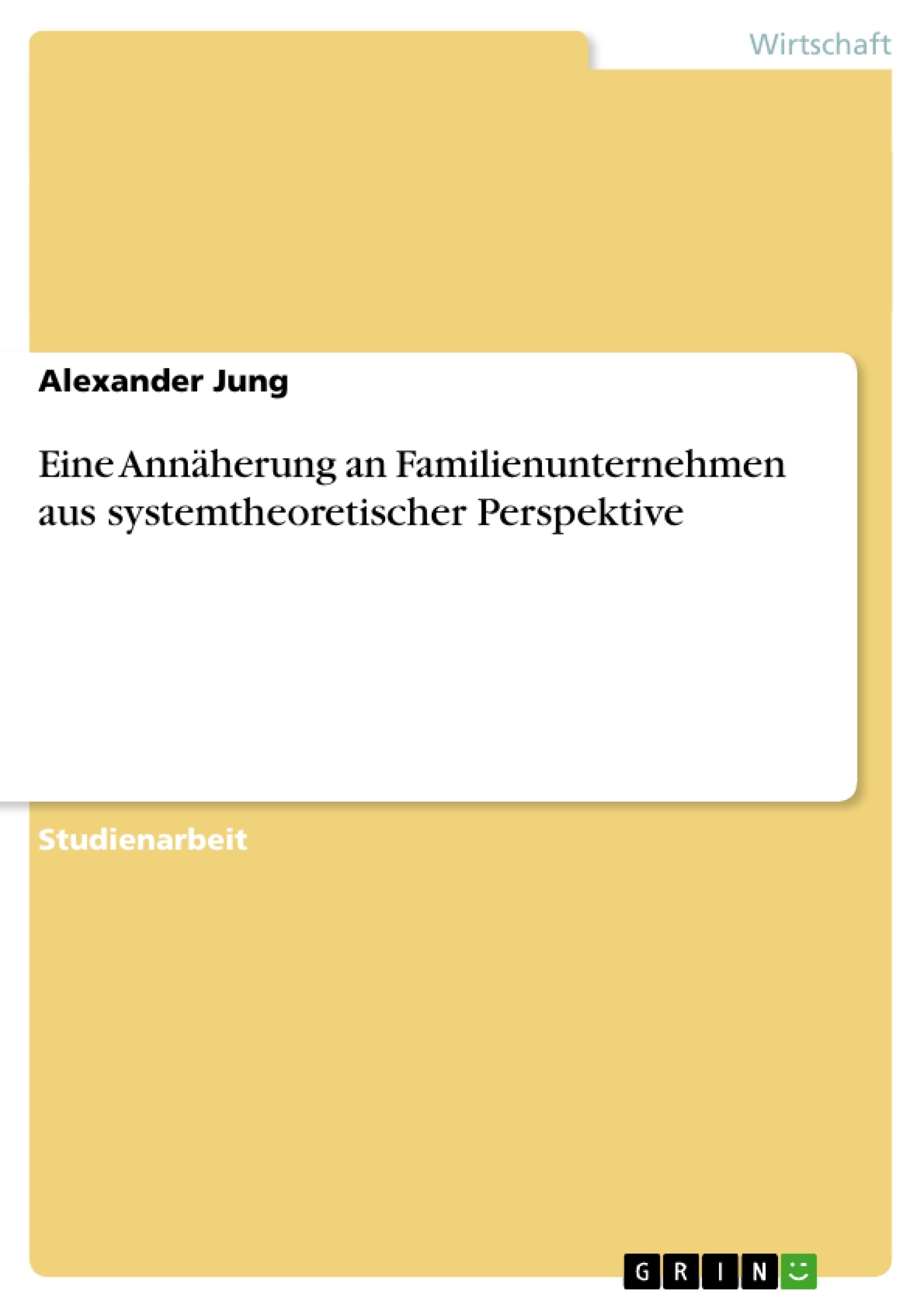In den vergangenen Jahren gewannen Themen wie Internationalisierung und Globalisierung, zunehmende Wettbewerbsdynamik und -intensität, steigender Innovationsdruck, etc. gewichtige Prominenz bei all denjenigen, die sich in Theorie und Praxis mit Organisationen und Unternehmen beschäftigten. Es scheint so, als wandle sich das Beständige und als sei das einzig Beständige der Wandel. In diesem Zusammenhang fallen vielfach auch die Schlagwörter des Strukturwandels und der (Umwelt-)Komplexität, denen Unternehmen und Organisationen vermehrt ausgesetzt seien. Der inflationäre Gebrauch der Begriffe des Strukturwandels und der Komplexität darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese weder auf einer klaren Definition, noch auf einem einheitlichen Begriffsverständnis beruhen. Interessanterweise scheint es aber gerade der Beratungsbranche an einem professionellen Selbstverständnis zu mangeln. So finden sich zwar zahlreiche Bücher über Berater und Beratung, „wo zwar Verfahren dargestellt werden, ohne dass aber der Begriff ‚Beratung’ überhaupt näher bestimmt wird.“
Nähert man sich Organisationen und Unternehmen hingegen aus der Perspektive der neueren Systemtheorie und interessiert sich dafür, wie Veränderungen durch Berater vonstatten gehen (können), erlangen die Begriffe der Komplexität und des Strukturwandels grundlegende Bedeutung. Darüber hinaus werden sie auch vom Nominalismusverdacht befreit, indem ihnen die Systemtheorie einen umfassenden theoretischen Nährboden liefert.
Setzt man die allgemeine systemtheoretische Brille auf und interessiert sich für Unternehmen und Organisationen aus diesem Blickwinkel, ergeben sich interessante, für manche möglicherweise überraschende und ungewöhnliche Implikationen für die Theorie und Praxis der Beratung von Organisationen. Der Blick mag am Anfang unscharf und undeutlich sein, gewöhnt man sich allerdings an das Gestell und die Gläser, dann sieht man die Welt vielleicht mit anderen Augen.
Im Sinne der systemtheoretischen Terminologie wird im Folgenden also eine Beobachterposition dritter Ordnung eingenommen, um den systemtheoretischen Ansatz der Organisationsberatung darzustellen und im Hinblick auf seine blinden Flecken zu untersuchen, ohne jedoch aus den Augen zu verlieren, dass man selber nicht sehen kann, dass man nicht sehen kann.
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG4EINE ANNÄHERUNG AN DIE SYSTEMTHEORIE
2. EINE ANNÄHERUNG AN DIE SYSTEMTHEORIE
2.1 Entwicklungsphasen der Systemtheorie
2.1.1 Geschlossene Systeme
2.1.2 Offene Systeme
2.1.3 Die neuere Systemtheorie/ Die Theorie selbstreferentieller Systeme
2.2 Organisationen als soziale Systeme
2.2.1 Soziale Systeme
2.2.2 Entscheidungskommunikationen als Besonderheit von Organisationen
2.3 Das Sozialsystem Familie
2.3.1 Die Familie in der modernen Gesellschaft
2.3.2 Die Inklusion der ganzen Person als spezifische Funktion der Familie
3. FAMILIENUNTERNEHMEN
3.1 Unterschiede von Familien und Unternehmen aus systemtheoretischer Perspektive
3.2 Besonderheiten von Familienunternehmen
4. SCHLUSSBETRACHTUNG:
Chancen und Risiken von Familienunternehmen
LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Eine mögliche Einteilung von Systemen
1. EINLEITUNG
Im Rahmen der Diplomandenarbeitsgemeinschaft „Familienunternehmen und Corporate Governance“ (WS 01/02) am Lehrstuhl für strategische Unternehmensführung wurde sich u.a. auch mit Ansätzen der neueren Systemtheorie beschäftigt. Um eine Annäherung an Familienunternehmen aus der Perspektive dieser Theorie etwas eingehender darzustellen, zieht diese Arbeit ihre Motivation und soll gleichzeitig als Vorstufe zu einer Diplomarbeit dienen.
„Es gibt Systeme“ sagt Niklas Luhmann[1]. Es handelt sich also keineswegs um die konstruktivistische Auffassung, Systeme seien ein reines gedankliches Konstrukt unseres Verstandes. Mit diesem Ausgangspunkt soll im Folgenden zunächst ein – dem Rahmen dieser Arbeit entsprechender - kurzer Überblick über die historische und inhaltliche Entwicklung der Systemtheorie gegeben werde (Kapitel 2), wobei auch im Besonderen die Systemtypen Organisation und Familie herausgegriffen und vertieft werden sollen. Kapitel 3 stellt im Anschluss den Versuch einer Brücke zwischen diesen beiden Teilsystemen dar, zeigt deren Unterschiede auf und beschreibt die durch die Kopplung der beiden Systeme entstehenden Besonderheiten von Familienunternehmen. Es geht also um die Frage, was Familienunternehmen aus systemtheoretischer Perspektive sein könn(t)en. Der sicherlich nicht einfache Zugang zum Werk von Niklas Luhmann, das hier als Grundlage dienen und in besonderer Weise Berücksichtigung finden soll, setzt vom Leser jedoch gewisse Vorkenntnisse der systemtheoretischen Begrifflichkeiten voraus, da eine ausführliche und tiefgehende Darstellung sicherlich den hier gestellten Rahmen sprengen würde. Die Schlussbetrachtung lenkt schließlich den Blick auf die spezifischen Chancen und Probleme von Familienunternehmen. Letztlich soll diese Arbeit Familienunternehmen von einer etwas anderen Perspektive anleuchten, und eine systemperspektivische „Beobachtung 2. Ordnung“ als mögliche Betrachtungsebene von Familienunternehmen darstellen, die nicht nur akademischen Gewinn verspricht.
2. EINE ANNÄHERUNG AN DIE SYSTEMTHEORIE
2.1 Entwicklungsphasen der Systemtheorie
Trotz des knappen Rahmens dieser Arbeit erscheint es v.a. im Hinblick auf das Verständnis angebracht, zumindest einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Systemtheorie zu geben, zumal sie keine ursprünglich soziologische Theorie darstellt und ihre Wurzeln in unterschiedlichen Disziplinen hat.[2] Besonders einflussreich für die sog. „neuere Systemtheorie“ – also die Theorie selbstreferentieller Systeme - und Niklas Luhmann waren hierbei u.a. die Arbeiten der beiden chilenischen Biologen und Neurophysiologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela mit ihrem Konzept der Autopoiese, Talcott Parsons struktur- funktionale Systemtheorie, Spencer Browns „laws of form“ und von Foersters Kybernetik 2. Ordnung.
Luhmanns erhebt einen Universalitätsanspruch an seine Theorie (keinen Absolutheitsanspruch), sie soll also multidisziplinär auf andere Wissenschaftsbereiche übertragbar sein, womit das erhebliche Abstraktionsniveau seines Hauptwerkes „Soziale Systeme- Grundzüge einer allgemeinen Theorie“ von 1984 deutlich werden dürfte.
2.1.1 Geschlossene Systeme
Der klassische Systembegriff definiert System als etwas „Zusammengesetztes“ gegenüber dem Elementaren.[3] K. Boulding definiert den Systembegriff demnach auch durch negative Abgrenzung, wenn er meint : „Whatever is not chaos, is system“[4] [5] Was also als System angesehen wird hängt von den Definitionsgrenzen ab. In diesem Sinne ist die Summe der Elemente des Systems gleichbedeutend mit dem Ganzen.
Die Vorstellung von geschlossenen Systemen zeichnet sich nun dadurch aus, dass die Elemente des Systems nicht mehr isoliert betrachtet werden, sondern die Relationen dieser Elemente untereinander in den Blick rücken[6]. Die innere Ordnung eines Systems konstituiert sich demnach durch die Beziehung der Elemente zueinander, wobei die Teile zudem in einem strukturell- hierarchischen Abhängigkeitsverhältnis unter den Zweck des Ganzen gedacht werden.[7] Das Ganze ist durch seinen Zweck definiert und die Teile, die lediglich als Mittel zum Zweck dienen, sorgen für die Produktion der systemerhaltenden Leistungen. Wichtig ist vor allem, dass sich ein geschlossenes System dadurch auszeichnet,
„daß es sich homöostatisch, also binnenstabil erhält und nach Erreichen eines gleichgewichtigen Zustandes nicht verändert. Ein solches System unterhält keine Austauschbeziehungen mit seiner Umwelt (...)“. (Kneer/ Nassehi 2000: 21)
Charakteristisch für geschlossene Systeme ist also, dass die Beziehungen zur Umwelt bei der Betrachtung vernachlässigt werden. Es interessiert nur das Zusammenwirken der Teile und des Ganzen und die Funktion des Teils für das Ganze. Dies ist der zentrale Unterschied zu dem Gedanken offener Systeme.
2.1.2 Offene Systeme
Der Biologe Ludwig von Bertalanffy beschreibt den Unterschied von geschlossenen und offenen Systemen folgendermaßen:
„Ein System ist dann geschlossen, wenn keinerlei stofflicher Träger von außen eingeht oder es verlässt; es ist offen, wenn es zwischen ihm selbst und der Umwelt einen stofflichen Austausch gibt (...)“ (zitiert aus Kiss 1990: 82)
Typisch für offene Systeme ist somit der Gedanke des Umwelteinflusses bzw. der Dynamik des Systems mit der Umwelt. Ausgangspunkt dieser Überlegungen waren die Erkenntnisse des sog. 2. Gesetzes der Thermodynamik, was besagt, das in geschlossenen Systemen (also ohne Umweltkontakt) die Entropie stetig ansteigt – was letztlich zum Tod des Systems führt, da kein Unterschied zwischen System und Umwelt mehr vorliegt.[8] Die Umwelt wirkt beim Gedanken offener Systeme zwar nun auf das System ein, es lässt sich aber keine lineare Kausalität zwischen Input in das System aus der Umwelt, und Output aus dem System in die Umwelt feststellen. Insofern wird das offene System wie eine „black box“ gedacht, eine unbekannte Maschine also,
„von der man annimmt, dass sie determinierbar ist, in der der determinierbare Mechanismus jedoch dem Blick entzogen ist.“ (Glanville 1988: 100f.)
Offene Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre interne Organisation bei Umweltänderungen selbst verändern und diese nicht von der Umwelt determiniert wird. Es geht also um Selbstorganisation. Damit ergibt sich aber eine - gegenüber geschlossenen Systemen - völlig veränderte Betrachtungsperspektive: Während in der Theorie geschlossener Systeme die Umwelt noch vernachlässigt wurde, ist für die Theorie offener Systeme die System- Umwelt Relation von konstitutiver Bedeutung. Allerdings wird die Unterscheidung von System und Umwelt fremdreferentiell bestimmt.[9]
Dies ändert sich beim Übergang zur neueren Systemtheorie bzw. zur Theorie selbstreferentieller Systeme: Hier trifft das System selbst die Unterscheidung – im Falle von Funktionssystemen durch sog. binäre Codes - zwischen System und Umwelt.
2.1.3 Die neuere Systemtheorie/ Die Theorie selbstreferentieller Systeme
Die sog. „neuere Systemtheorie“ integriert[10] nun beide Ansätze. Unter das Etikett „neuere Systemtheorie“ fallen eine Reihe von Ansätzen aus unterschiedlichen Disziplinen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei v.a. das Autopoiese- Konzept von Maturana und Varela, die Arbeiten von Heinz von Foerster zur Kybernetik 2. Ordnung[11], natürlich Niklas Luhmann mit seiner Theorie sozialer Systeme u.a..
Nach Luhmann zeichnet sich ein System ausschließlich durch die Abgrenzung von seiner Umwelt aus.
„Konstitutiv für diesen Systembegriff ist somit die Vorstellung einer Grenze, die eine Differenzierung von Innen und Außen ermöglicht. Etwas ist entweder System (bzw. gehört zum System) oder Umwelt (bzw. gehört zur Umwelt).“ (Kneer/ Nassehi 2000: 38)[12]
Nach Luhmann ist der Unterschied – also die Grenze- zwischen System und Umwelt durch ein Komplexitätsgefälle (bzw. Sinn[13]) „markiert“[14]. Das System generiert und bestimmt die Grenze allerdings selbst (deswegen Selbstreferenz). Da die Umwelt stets komplexer als das System ist (also über mehr Verweisungen und Relationen verfügt), besteht die Funktion des Systems in der Reduktion der Umweltkomplexität,[15] was durch die Selektion von Möglichkeiten bzw. die Reduktion von Relationen geschieht.
„Systembildung erfolgt durch Stabilisierung einer Grenze zwischen System und Umwelt, innerhalb derer eine höherwertige Ordnung mit weniger Möglichkeiten (also mit reduzierter Komplexität) invariant gehalten werden kann.“ (Luhmann 1970: 76)
Es gilt somit dasselbe wie im Falle der Entropie: ohne ein Komplexitätsgefälle gäbe es keinen Unterschied zwischen Umwelt und System (insofern also auch keine „Identität“[16]), was gleichbedeutend mit der Beendigung der Autopoiese und somit der Existenz des Systems ist.
Ein System besteht nun auch in der Theorie selbstreferentieller Systeme aus Elementen. Unter einem Element versteht Luhmann folgendes:
„Ein Element ist für das System jeweils das, was für ein System als nicht weiter auflösbare Einheit fungiert.“ (Luhmann 1984: S. 43)
Damit ist eine Deontologisierung des Elementbegriffs verbunden, denn dadurch ist gesagt, dass ein Element erst ein Element durch die Integration (und die Relation zu anderen Elementen) in das System wird. Es ist also nicht schon ein Element an sich.
Aber was sind nun eigentlich „konkrete“ Systeme?
Man kann die verschiedenen Systemtypen folgendermaßen einteilen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: eine mögliche Einteilung von Systemen[17]
Psychische und soziale Systeme sind sinnhaft operierende Systeme. Sinn kommt dadurch zustande – genauer: das ist Sinn -, dass den Elementen des Systems Anschlussmöglichkeiten für weitere Elemente gegeben ist. „Sinn hat demzufolge Verweisungscharakter“[18] Luhmann schreibt demnach auch:
„Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses von Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns.“ (Luhmann 1984: 93)
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden von sozialen Systemen und Organisationen als autopoietischen und sinnhaft operierenden Systemen die Rede sein.
2.2 Organisationen als soziale Systeme
2.2.1 Soziale Systeme
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Ebene der sozialen Systeme, die Luhmann – neben lebenden und psychischen Systemen[19] - als autopoietisch und selbstreferentiell kennzeichnet, und die er auf einer zweiten Untergliederungsebene nochmals in Gesellschafts-, Interaktions- und Organisationssysteme einteilt. Soziale Systeme sind also autopoietische Systeme, insofern reproduzieren sie sich anhand ihrer Elemente selbst. Die Elemente sozialer Systeme sind nun – im Gegensatz zum alltäglichen Verständnis – nicht Menschen[20], sondern Kommunikationen. Das bedarf sicherlich einer kurzen Erläuterung.
Luhmanns These lautet, dass soziale Systeme aus Kommunikationen bestehen[21], weil nur diese – im Sinne der Autopoiese – aneinander anschlussfähig sind, also weitere Kommunikation hervorbringen können.[22] Der Begriff der Autopoiese stammt - wie schon erwähnt von Maturana und Varela - und meint soviel wie „Selbsterzeugung“. Maturana und Varela definieren autopoietische Systeme (bzw. Maschinen) folgendermaßen:
[...]
[1] Vgl. Luhmann (1984), S. 30
[2] Kybernetik, Physik (Thermodynamik), Kommunikationstheorie, Biologie u.a.
[3] der Begriff System stammt aus dem Griechischen in wird im Brockhaus als „Ganzheitlicher Zusammenhang von Dingen, Vorgängen, Teilen der entweder in der Natur gegeben (...) oder von Menschen hergestellt ist (...)“ beschrieben. Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 18. Band, F.A. Brockhaus Wiesbaden 1973, S. 406.
[4] zitiert aus Gründer/ Ritter (1998), S. 863
[5] Im Gegensatz zum umgangssprachlichen Begriff ist Chaos ein Zustand, in dem alle folgenden Zustände bzw. Ereignisse gleichwahrscheinlich sind.
[6] Hier liegt der Gedanke zugrunde, das das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist.
[7] Vgl. Kiss (1989), S. 90 ff.
[8] was gleichbedeutend damit ist, dass das System keine „Identität“ mehr besitzt
[9] der Beobachter trifft also die Unterscheidung
[10] vgl. Luhmann (1984), S. 25
[11] wichtig bei von Foerster ist u.a. die Unterscheidung zwischen trivialen und nicht- trivialen Maschinen, die aufgrund ihrer Undeterminiertheit und doppelten Schließung eine „Geschichte“ haben (also historische Systeme sind).
[12] Luhmann selbst schreibt hierzu: „Elemente müssen (...) entweder dem System oder dessen Umwelt zugerechnet werden. Relationen können dagegen auch zwischen System und Umwelt bestehen. Eine Grenze trennt also Elemente, nicht notwendigerweise auch Relationen.“ (Luhmann 1984: 52)
[13] vgl. Luhmann (1971), S. 73ff.
[14] vgl. Luhmann (1984), S. 249ff., also das „cross“ bei Spencer - Brown
[15] dazu benötigt es jedoch den Aufbau einer gewissen Eigenkomplexität, siehe Luhmann (1984), S. 49
[16] die eine Seite ist also jeweils nur im Unterschied (bzw. der Bezeichnung) der anderen Seite existent. Die Farbe „schwarz“ kann es beispielsweise nur dadurch geben, dass es auch noch andere Farben gibt.
[17] in Anlehnung an das Vorlesungsskript „Einführung in die Soziologie für Nebenfachstudierende“ von Dr. Frank Hillebrandt, Institut für Soziologie der Universität Hamburg, im WS 01/ 02 http://www.tu-harburg.de/tbg/Deutsch/Mitarbeiterinnen/Frank/Vorlesung9.pdf
[18] vgl. Schmidt (1997) S. 173
[19] Maschinen sind laut Maturana und Varela „allopoietische“ Systeme, vgl. Kiss (1990) S. 92
[20] „Der Mensch (...) ist kein System.“ Luhmann (1984) S. 67f., der Mensch besteht im Gegensatz dazu aus mehreren autopoietischen Systemen, z.B. das psychische System oder Zellen.
[21] Das Problem der doppelten Kontingenz (d.h., der Unbestimmbarkeit zweier operational geschlossener psychischer Systeme) ist somit der Auslöser von Kommunikationen, vgl. Luhmann (1984), S. 148ff.
[22] „Der Mensch kann nicht kommunizieren; nur die Kommunikation kann kommunizieren.“ (Luhmann 1990a: 31)
- Quote paper
- Alexander Jung (Author), 2002, Eine Annäherung an Familienunternehmen aus systemtheoretischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36011