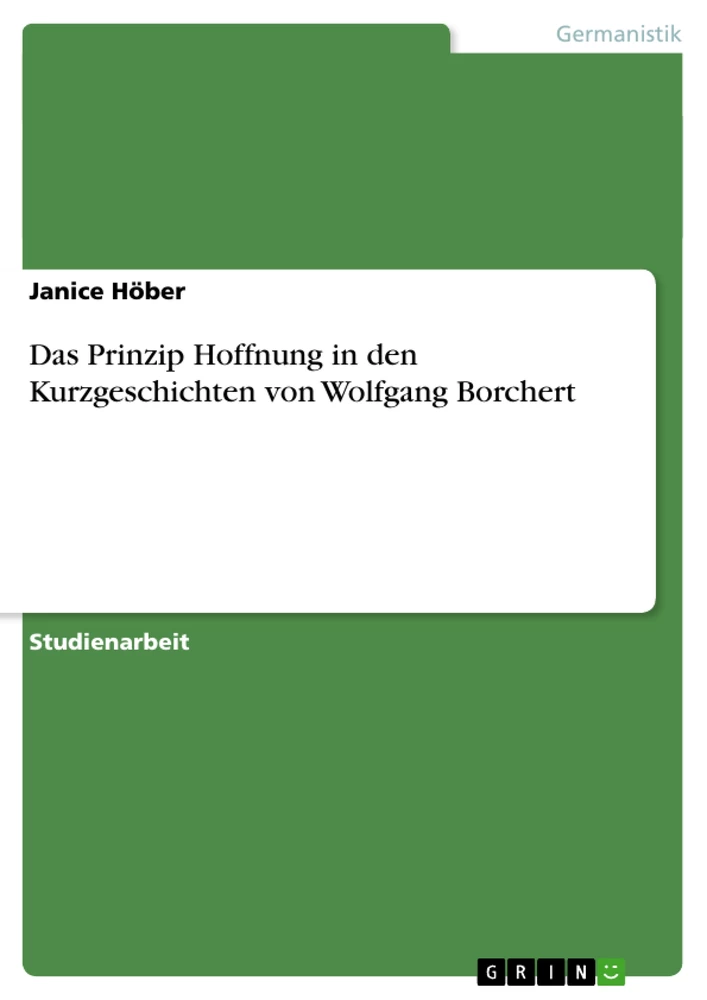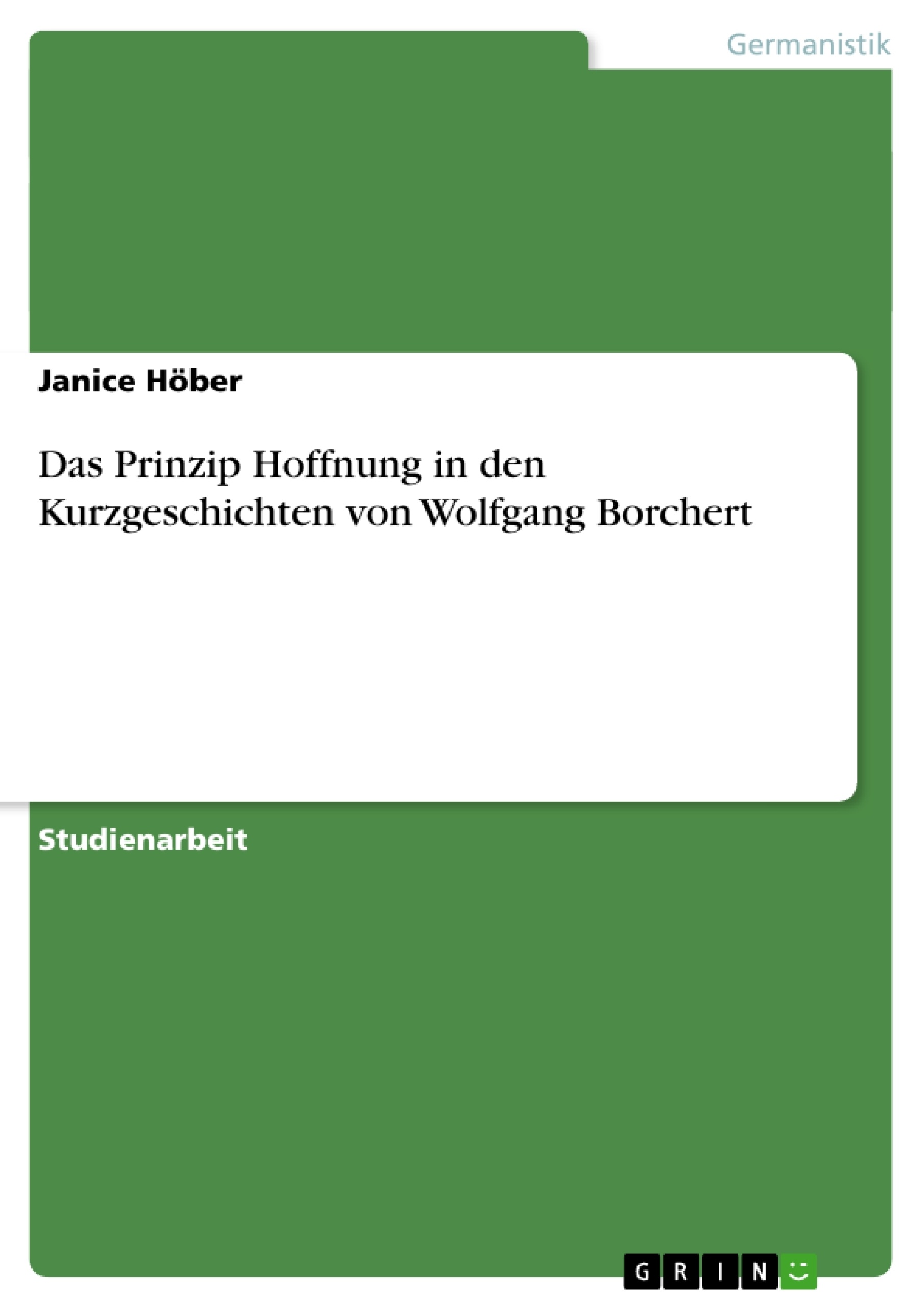Für die deutschsprachige Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit haben sich Bezeichnungen wie Trümmerliteratur, Heimkehrerliteratur oder Literatur des Kahlschlags eingebürgert, die in jedem Fall das Programm einer realistischen, auf die Probleme der unmittelbaren Gegenwart bezogenen Literatur meinen. Ihre Entwicklung muss unter Berücksichtigung der territorialen Bedingungen gesehen werden. Demnach unterscheidet man zwischen der westdeutschen Literatur und der Literatur der sowjetischen Besatzungszone (SBZ).
Johannes R. Becher gehörte neben Bertolt Brecht, Friedrich Wolf, Arnold Zweig, Stefan Heym, Bruno Apitz et al. zu jenen Autoren, die nach 1945 aus dem Exil nach Deutschland und hier nahezu ausnahmslos in die damalige sowjetische Besatzungszone zurückkehrten und einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der ostdeutschen Literatur nahmen.
Die deutsche Literatur der westlichen Zonen wurde überwiegend von den Autoren der so genannten Inneren Emigration bestimmt, von Schriftstellern also, die Deutschland während des NS-Regimes nicht verlassen hatten. Die in dieser Zeit entstandene Literatur, wie zum Beispiel die Naturlyrik von Gottfried Benn oder Werke von Oskar Loerke und Elisabeth Langgässer, war in der Regel „apolitisch und bar jeglicher Kritik". Neben den inneren Emigranten bestimmten auch Autoren der Jungen Generation das literarische Leben in den westlichen Besatzungszonen. Zu ihnen zählen nicht nur die Anhänger der Gruppe 47 und Wolfgang Borchert, sondern auch der Einzelgänger Arno Schmidt sowie Ilse Aichinger und Peter Weiss, um nur einige weitere Namen zu nennen. Zu ihren zentralen Themen gehörte unter anderem die Problematik des Kriegsheimkehrers. Das Drama Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert gilt hier als repräsentatives Beispiel.
Wolfgang Borchert gehörte zu denjenigen, die das Inferno des Krieges hautnah miterlebt hatten. Als er nach kurzer Kriegsgefangenschaft 1945 in seine Heimatstadt Hamburg zurückkehrte, blieben ihm nur noch zwei Jahre, um all das hervorzubringen, was in ihm „glühte und gesagt zu werden verlangte". Der Schauspieler und Schriftsteller verfasste nicht nur das bereits erwähnte Drama, sondern schrieb auch zahlreiche Erzählungen, Gedichte sowie Kurzgeschichten, von denen in dieser Arbeit zwei genauer untersucht werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hinführung zum Thema
- 1.2. Abgrenzung des Themas
- 2. Das Prinzip Hoffnung
- 2.1. Begriffsdefinition
- 2.2. Hoffnung nach der „Stunde Null”
- 2.3. Hoffnung im Leben Wolfgang Borcherts
- 3. Die Gattung der Kurzgeschichte
- 3.1. Eine kurze Begriffsbestimmung
- 3.2. Die wesentlichsten Kennzeichen einer Kurzgeschichte
- 3.3. Die deutsche Kurzgeschichte in der Zeit von 1945-1950
- 4. Die Kurzgeschichte bei Wolfgang Borchert
- 4.1. Die drei dunklen Könige
- 4.1.1. Inhaltsangabe
- 4.1.2. Analyse und Interpretation unter Berücksichtigung der Schwerpunktsetzung
- 4.2. Nachts schlafen die Ratten doch
- 4.2.1. Inhaltsangabe
- 4.2.2. Analyse und Interpretation unter Berücksichtigung der Schwerpunktsetzung
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Prinzip Hoffnung in den Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland. Ziel ist es, die Darstellung von Hoffnung in Borcherts Werken zu analysieren und die literarischen Mittel zu identifizieren, die er zur Vermittlung dieses Themas verwendet. Der Fokus liegt auf zwei ausgewählten Kurzgeschichten.
- Hoffnung und ihre Definition im Kontext des Zweiten Weltkriegs
- Die Darstellung von Hoffnung in der unmittelbaren Nachkriegszeit Westdeutschlands
- Die literarischen Mittel der Hoffnungsschilderung bei Borchert
- Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten "Die drei dunklen Könige" und "Nachts schlafen die Ratten doch"
- Die Gattung der Kurzgeschichte im Kontext der Nachkriegsliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und grenzt es ab. Sie beschreibt den Kontext des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland, mit Fokus auf die Hoffnungslosigkeit und den Wiederaufbau. Es wird die spezifische Fragestellung der Arbeit vorgestellt, nämlich die Analyse des Prinzips Hoffnung in den Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert. Der methodische Ansatz – die Unterteilung in einen theoretischen und einen praktischen Teil – wird skizziert. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende Analyse, indem sie den historischen und literaturwissenschaftlichen Rahmen etabliert.
2. Das Prinzip Hoffnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Hoffnung" und seiner Bedeutung im Kontext der Nachkriegszeit. Es analysiert die Erfahrungen der Menschen nach dem Krieg und untersucht, wie sich der Begriff "Hoffnung" in diesem Kontext manifestiert. Besondere Bedeutung erhält die persönliche Geschichte Wolfgang Borcherts und dessen eigene Erfahrungen mit Hoffnung. Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage für die Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten im darauf folgenden Kapitel.
3. Die Gattung der Kurzgeschichte: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Gattung der Kurzgeschichte, einschließlich einer Begriffsbestimmung und einer Erläuterung der wesentlichen Merkmale. Es beleuchtet die historische Entwicklung der deutschen Kurzgeschichte zwischen 1945 und 1950, um den Kontext der Werke Borcherts zu verdeutlichen. Die Auseinandersetzung mit der Gattungsgeschichte ist essentiell für das Verständnis der spezifischen Form und Aussagekraft der von Borchert gewählten literarischen Form.
4. Die Kurzgeschichte bei Wolfgang Borchert: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse von zwei ausgewählten Kurzgeschichten Borcherts. Es wird jeweils eine Inhaltsangabe und eine Interpretation unter Berücksichtigung der Schwerpunktsetzung der Arbeit gegeben. Die Analyse untersucht, wie Borchert das Prinzip Hoffnung in seinen Werken darstellt und welche literarischen Mittel er dafür verwendet. Die beiden Kurzgeschichten werden im Kontext der gesamten Arbeit als Fallstudien zur Erforschung des Themas "Hoffnung" dienen.
Schlüsselwörter
Wolfgang Borchert, Kurzgeschichte, Nachkriegsliteratur, Hoffnung, Trümmerliteratur, Westdeutschland, Analyse, Interpretation, "Die drei dunklen Könige", "Nachts schlafen die Ratten doch".
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Prinzips Hoffnung in den Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Prinzip Hoffnung in den Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland. Der Fokus liegt dabei auf zwei ausgewählten Kurzgeschichten: "Die drei dunklen Könige" und "Nachts schlafen die Ratten doch".
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Darstellung von Hoffnung in Borcherts Werken zu analysieren und die literarischen Mittel zu identifizieren, die er zur Vermittlung dieses Themas einsetzt. Es soll untersucht werden, wie Hoffnung im Kontext des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in Westdeutschland dargestellt wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Definition von Hoffnung im Kontext des Zweiten Weltkriegs, die Darstellung von Hoffnung in der unmittelbaren Nachkriegszeit Westdeutschlands, die literarischen Mittel der Hoffnungsschilderung bei Borchert, eine detaillierte Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten und die Gattung der Kurzgeschichte im Kontext der Nachkriegsliteratur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema einführt und abgrenzt; ein Kapitel zur Definition des Prinzips Hoffnung im Kontext des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit; ein Kapitel zur Gattung der Kurzgeschichte mit besonderem Fokus auf die deutsche Kurzgeschichte von 1945-1950; ein Kapitel zur Analyse der beiden ausgewählten Kurzgeschichten Borcherts ("Die drei dunklen Könige" und "Nachts schlafen die Ratten doch") mit Inhaltsangaben und Interpretationen; und schließlich eine Schlussbetrachtung.
Wie werden die ausgewählten Kurzgeschichten analysiert?
Für jede der beiden ausgewählten Kurzgeschichten ("Die drei dunklen Könige" und "Nachts schlafen die Ratten doch") wird eine Inhaltsangabe und eine detaillierte Interpretation geliefert. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Prinzips Hoffnung und die verwendeten literarischen Mittel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wolfgang Borchert, Kurzgeschichte, Nachkriegsliteratur, Hoffnung, Trümmerliteratur, Westdeutschland, Analyse, Interpretation, "Die drei dunklen Könige", "Nachts schlafen die Ratten doch".
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode. Sie kombiniert einen theoretischen Teil (Definition von Hoffnung und Kurzgeschichte) mit einem praktischen Teil (Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten). Der methodische Ansatz wird in der Einleitung skizziert.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit in Westdeutschland, mit Fokus auf die Hoffnungslosigkeit und den Wiederaufbau. Dieser Kontext ist essentiell für das Verständnis der Darstellung von Hoffnung in Borcherts Werken.
Welche Rolle spielt die persönliche Geschichte Wolfgang Borcherts?
Die persönliche Geschichte Wolfgang Borcherts und dessen eigene Erfahrungen mit Hoffnung spielen eine wichtige Rolle im Kapitel über das Prinzip Hoffnung. Diese persönlichen Erfahrungen werden mit der Analyse seiner literarischen Werke verknüpft.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die Nachkriegsliteratur, die Werke Wolfgang Borcherts und die Thematik Hoffnung im Kontext des Zweiten Weltkriegs interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke konzipiert.
- Quote paper
- Janice Höber (Author), 2004, Das Prinzip Hoffnung in den Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35975