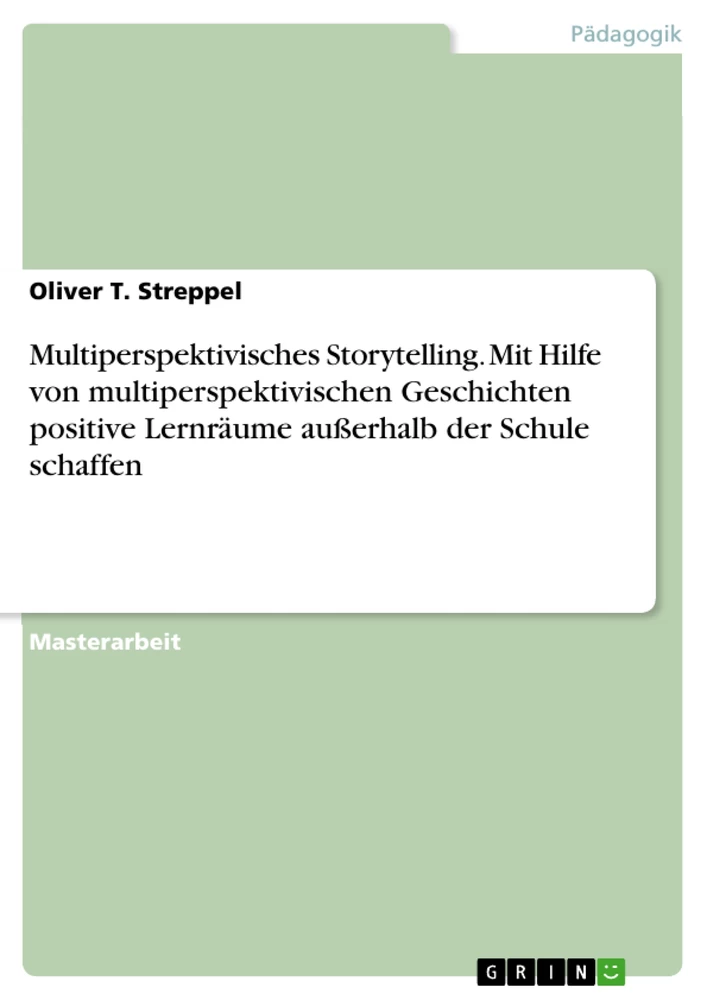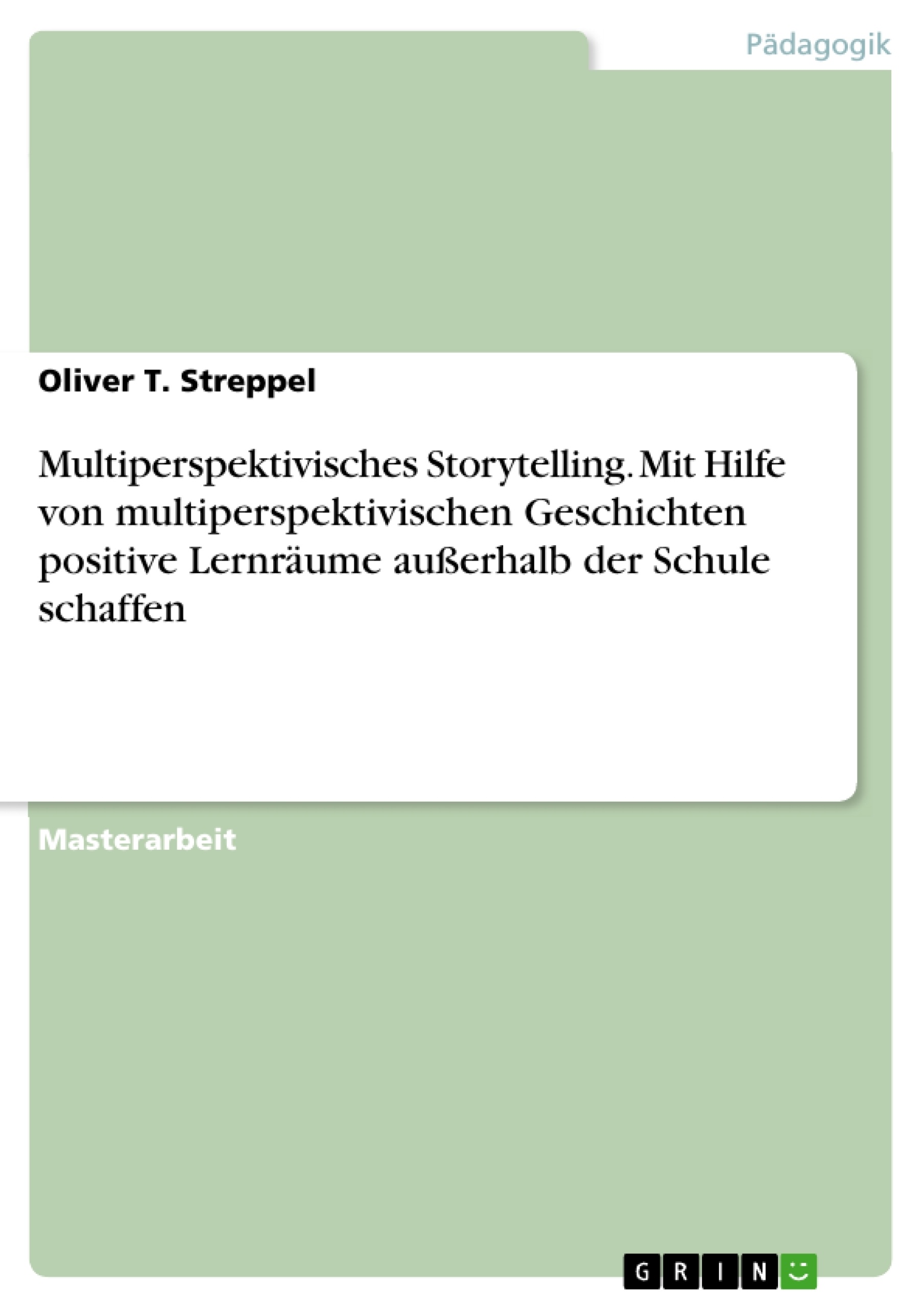Das Thema Storytelling im Unterricht ist nicht neu. So beschreibt Giessen in seinem Buch „Emotionale Intelligenz in der Schule“, dass es schon lange narrative Elemente in der Pädagogik gibt. Doch scheint die Wissensvermittlung mit Hilfe der sozialen Intelligenz in Form von narrativen Elementen in Deutschland eine kleine Renaissance zu erleben. So haben Blum & Heering ein Forschungsergebnis auf der Frühjahrstagung der Didaktik der Physik vorgestellt, bei dem es um ihren Erfolg der Storytelling-Methode bei naturwissenschaftlichen Fächern ging.
Das Thema „Multiperspektive“ in der Lehre kennt man unter anderem aus dem Geschichtsunterricht. Die Theorie hierzu besagt, dass man ein geschichtliches Ereignis immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten sollte, um die sozialen, kulturellen oder anderen Einflüssen der Quellen zu berücksichtigen. Dramaturgisch gesehen besaß die Multiperspektive immer ein Schattendasein. Obwohl man doch mit Beginn der DVD über die Funktion des „Multiangel“, also der Möglichkeit zwischen verschiedenen Kameras oder eben verschiedenen Geschichten hin und her schalten zu können, multiperspektivisch erzählen hätte können. Dies ist kaum umgesetzt worden, wenn man sich die Filme einer Videothek genauer diesbezüglich ansieht. Leider gibt es hierzu keine wissenschaftlichen Daten.
Führt man nun die beiden oben genannten Methoden zusammen, erhält man „multiperspektivisches Storytelling“. Dies ist eine spannende Methode Lernthemen aus verschiedenen Perspektiven zu bearbeiten. In dieser Thesis wurde diese Methode nicht Formal in einer Intervention bei einer Pfadfindergruppe ausprobiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort / Danksagungen
- Abstract Deutsch
- Abstract English
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Bedeutung der Arbeit für die Medienpädagogikforschung
- 1.2 Forschungsfrage
- 1.3 Methodik und Vorgehensweise
- 1.4 Aufbau der Thesis
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Multiperspektive
- 2.1.1 Begriffsklärung
- 2.1.2 Multiperspektive in der Dramaturgie
- 2.1.3 Multiperspektive im Film und in Serien
- 2.1.4 Multiperspektive in der Pädagogik
- 2.1.4.1 Multiperspektive in der Theaterpädagogik im Vergleich zu „LARPS“ (LIVE ACTION ROLE PLAYS)
- 2.1.4.2 Multiperspektive in der Spielpädagogik
- 2.2 Storytelling: Geschichtenerzählen in der Pädagogik
- 2.2.1 Storytelling: Begriffserklärung
- 2.2.2 Storytelling als Lernmethode
- 2.2.3 Wirkung einer Geschichte
- 2.3 Dramaturgie
- 2.3.1 Dramaturgie Element: Erzählperspektiven / Erzähler/in
- 2.3.2 Dramaturgie Element: Figuren
- 2.3.3 Dramaturgie Element: Handlung / Aufbau / Heldenreise
- 2.3.4 Dramaturgie Element: Zeit
- 2.3.5 Vielschichtige Plots
- 2.4 Digitale Medien in der Didaktik
- 2.4.1 Einfluss von digitalen Medien auf das Lernen
- 2.4.2 Einfluss von Digitalen Medien auf das Lehren
- 2.5 Medienkompetenz & Cybermobbing
- 2.5.1 Begriffserklärung: „Cybermobbing “ inkl. „Sexting“, „Cheating“, „Trollen“
- 2.5.2 „Medienkompetenz“ - Begriffserklärung nach Baacke
- 2.5.3 Medienkompetenz laut Medienpass Nordrhein-Westfalens
- 2.5.4 Medienkompetenz laut Lehrplan Baden-Württemberg
- 2.5.5 Medienkompetenz laut Lehrplan Waldorf
- 2.5.6 Medienkompetenz bei nicht-formalem Lernen: Bsp. Pfadfinder
- 2.6 Nicht-formales Lernen
- 2.6.1 Unterschiede zum formalen Lernen
- Multiperspektivisches Storytelling als Lernmethode
- Medienkompetenz und Cybermobbing in der Jugendarbeit
- Nicht-formales Lernen als Ergänzung zur Schulbildung
- Dramaturgische Elemente in der Medienpädagogik
- Einsatz digitaler Medien im pädagogischen Kontext
- Kapitel 1: Einleitung: In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Arbeit für die Medienpädagogikforschung dargelegt, die Forschungsfrage formuliert und die Methodik sowie der Aufbau der Thesis vorgestellt.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit, darunter Multiperspektive in der Dramaturgie und Pädagogik, Storytelling als Lernmethode, Dramaturgieelemente, digitale Medien in der Didaktik und der Medienkompetenzbegriff.
- Kapitel 3: Zusammenfassung des Theorieteiles und Verknüpfung mit der Intervention: Hier werden die wichtigsten Erkenntnisse des Theorieteiles zusammengefasst und in Bezug zur Intervention gesetzt.
- Kapitel 4: Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign, den Erhebungszeitraum, die Teilnehmergruppe, den Interventionsaufbau, die Instrumente des Fragebogens und die Datenauswertung.
- Kapitel 5: Forschungsergebnisse: In diesem Kapitel werden die quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse der Intervention vorgestellt und diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, ob die multiperspektivische Storytelling-Methode im nicht-formalen Lernkontext, speziell in der Jugendarbeit, positive Effekte auf das Lernen hat. Dabei wird ein Interventionsprojekt in einer Pfadfindersippe untersucht, in dem die Methode in Bezug auf Medienkompetenz und Cybermobbing eingesetzt wird.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Multiperspektivisches Storytelling, Medienkompetenz, Cybermobbing, Nicht-formales Lernen, Dramaturgie, Digitale Medien, Jugendarbeit, Pfadfinder, Intervention, Evaluation.
- Arbeit zitieren
- Oliver T. Streppel (Autor:in), 2017, Multiperspektivisches Storytelling. Mit Hilfe von multiperspektivischen Geschichten positive Lernräume außerhalb der Schule schaffen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359047