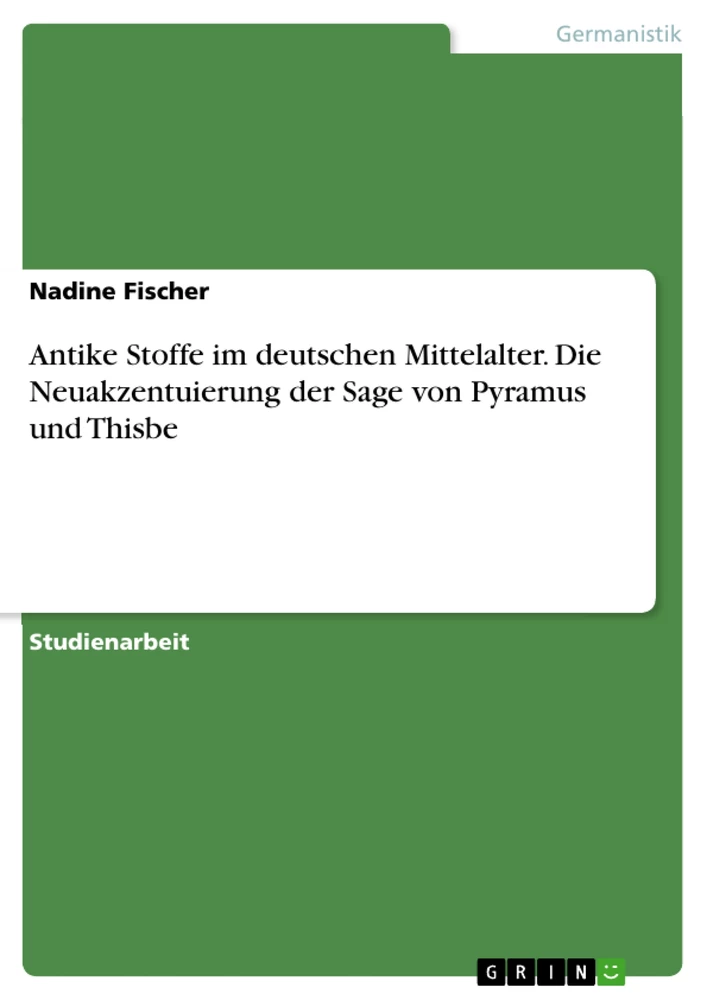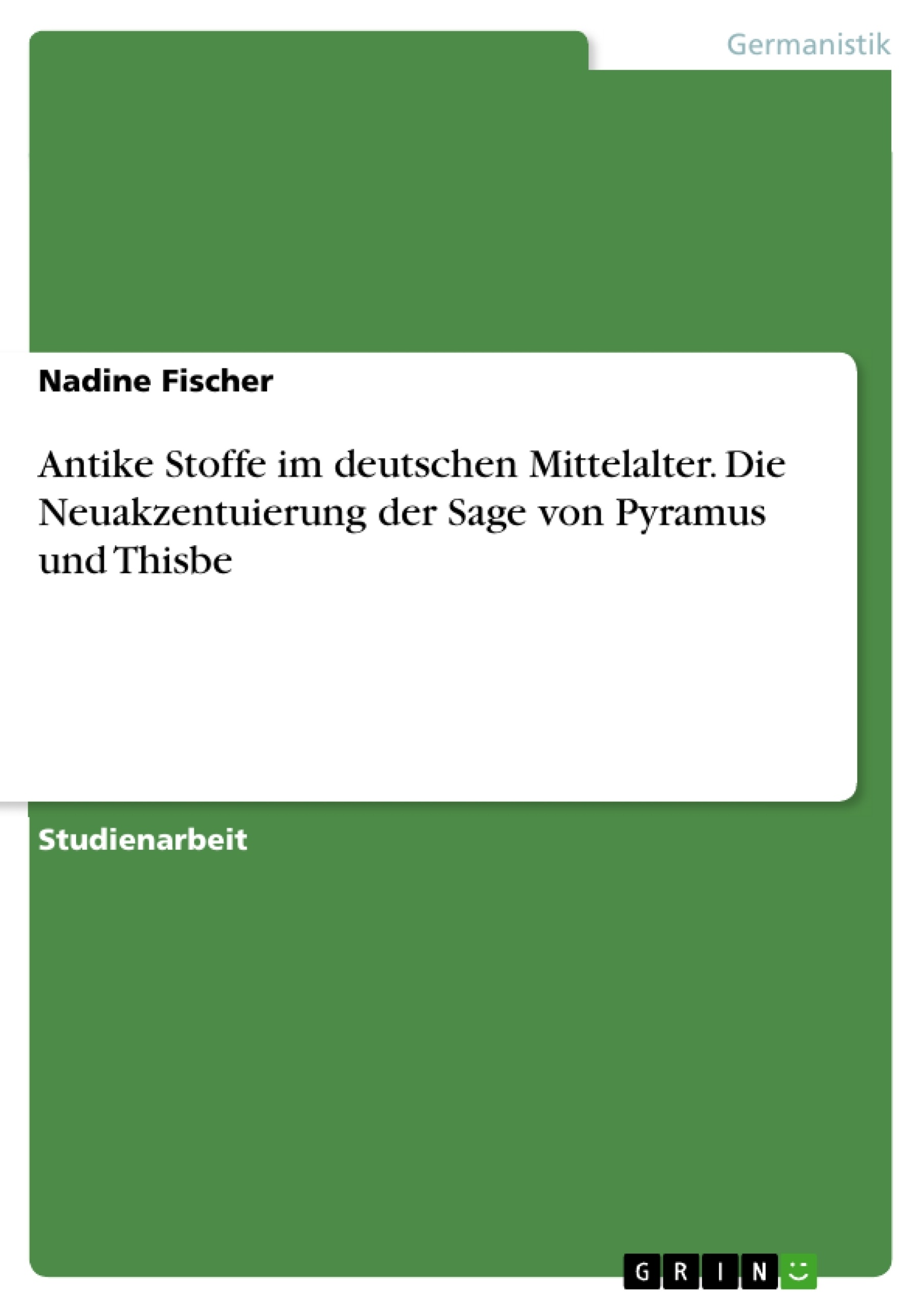Die tragische Liebe von Pyramus und Thisbe gehört zu den beliebtesten Stoffen im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Mehr noch als Übersetzungen finden sich zahlreiche Anspielungen und Motiventlehnungen aus der ovidischen Sage. Doch wie lässt sich der antike heidnische Stoff, insbesondere mit Blick auf den zweifachen Selbstmord am Ende der Geschichte, in das christliche Mittelalter überführen? Es ist davon auszugehen, dass die Überführung in einen so andersartigen kulturellen Kontext nicht gänzlich ohne Probleme vorgenommen werden kann. Die Verfasser werden den antiken Stoff vermutlich völlig neu akzentuieren und auslegen müssen, um den Bruch des Fünften Gebotes zu legitimieren.
Um diese Hypothese zu überprüfen, soll im Folgenden zunächst einmal die deutsche Übersetzung des Ausgangstextes von Ovid analysiert und anschließend komparatistisch mit einer mittelalterlichen Adaptation verglichen werden. Hierfür wird stellvertretend für die Abwandlungen im christlichen Mittelalter das Märe eines unbekannten Verfassers herangezogen, das deutliche Ähnlichkeiten mit dem zugrundeliegenden Text von Ovid aufweist, weshalb Unterschiede mehr ins Auge fallen und somit für eine vergleichende Interpretation fruchtbarer gemacht werden können, als bei einer bloßen Anspielung auf die Sage. Innerhalb eines knappen Exkurses soll anschließend noch die Verwendung des Stoffes in der Frühen Neuzeit beleuchtet werden, da sich der Fokus auf die Sage von Pyramus und Thisbe in dieser Periode erneut deutlich verschoben hat.
Aufgrund der interessanten Auslegung wurde für die kurze Analyse die Bearbeitung durch Johannes Spreng ausgewählt. Im Fazit sollen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit schließlich noch einmal zusammengefasst und überprüft werden, inwiefern sich die Ausgangshypothese bewahrheitet hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Antiker Stoff: Die Sage bei Ovid
- 3. Abwandlung der Sage im Spätmittelalter: Das Märe
- 4. Exkurs in die Frühe Neuzeit: Adaptation der Sage durch Johannes Spreng
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Adaption der Sage von Pyramus und Thisbe im deutschen Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Ziel ist es, die Neuakzentuierung des antiken Stoffes im christlichen Kontext zu analysieren und zu beleuchten, wie der zweifache Selbstmord im ursprünglichen Text in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erzählungen umgedeutet wird. Die Arbeit vergleicht Ovids Darstellung mit einer mittelalterlichen Version, um die Veränderungen aufzuzeigen.
- Die Überführung des heidnischen Stoffes in den christlichen Kontext
- Vergleichende Analyse von Ovids Version und einer mittelalterlichen Adaption
- Die Rolle der Liebe und Leidenschaft in den verschiedenen Versionen
- Die Veränderung der Deutung des Selbstmordes im Laufe der Zeit
- Die Adaption des Stoffes in der Frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Adaption der Sage von Pyramus und Thisbe im Kontext des christlichen Mittelalters. Sie begründet die Wahl des Märchens als Vergleichstext und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit der Neuinterpretation des antiken Stoffes, um den Bruch des fünften Gebotes im Kontext des christlichen Glaubens zu rechtfertigen. Die Einleitung formuliert die Hypothese, dass die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Versionen des Stoffes eine veränderte Akzentuierung aufweisen werden.
2. Antiker Stoff: Die Sage bei Ovid: Dieses Kapitel analysiert Ovids Version der Sage von Pyramus und Thisbe. Es beschreibt die Einbettung der Geschichte in eine Rahmenerzählung und hebt die Betonung der Metamorphose des Maulbeerbaumes hervor. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Liebe zwischen Pyramus und Thisbe, die durch die Metaphorik des Feuers und die Personifikation der Liebe verdeutlicht wird. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der erzwungenen Trennung der Liebenden und ihrer Reaktion darauf. Die Analyse beleuchtet die sprachlichen Mittel, die Ovid einsetzt, um die Intensität der Liebe und die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung zu verdeutlichen. Der Text untersucht die rhetorischen Stilmittel und die Verwendung der dritten Person Plural, um die Einheit der Liebenden zu betonen.
3. Abwandlung der Sage im Spätmittelalter: Das Märe: Dieses Kapitel (leider fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels).
4. Exkurs in die Frühe Neuzeit: Adaptation der Sage durch Johannes Spreng: Dieses Kapitel (leider fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels).
Schlüsselwörter
Pyramus und Thisbe, Ovid, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Märe, Adaptation, Liebesgeschichte, Selbstmord, christlicher Kontext, Neuakzentuierung, Vergleichende Analyse, Metamorphose.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Adaption der Sage von Pyramus und Thisbe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Adaption der antiken Sage von Pyramus und Thisbe im deutschen Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen und Neuinterpretationen des antiken Stoffes im christlichen Kontext, insbesondere der Umdeutung des Selbstmordes der Liebenden.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Arbeit vergleicht Ovids Version der Sage mit einer mittelalterlichen Adaption (ein Märe) und einer frühneuzeitlichen Version von Johannes Spreng. Die genaue Quelle des Märchens wird leider im vorliegenden Auszug nicht genannt.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie die Sage von Pyramus und Thisbe in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erzählungen umgedeutet wird, um den Bruch des fünften Gebotes (Du sollst nicht töten) im christlichen Kontext zu rechtfertigen. Die Arbeit untersucht die Überführung des heidnischen Stoffes in den christlichen Kontext, vergleicht die verschiedenen Versionen und analysiert die Veränderungen in der Darstellung der Liebe, der Leidenschaft und der Deutung des Selbstmordes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Ovids Version, ein Kapitel zur mittelalterlichen Adaption (Märe), ein Kapitel zur frühneuzeitlichen Adaption durch Johannes Spreng und ein Fazit. Leider fehlen im vorliegenden Auszug die Zusammenfassungen der Kapitel 3 und 4 zum Märe und zur Adaption durch Spreng.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Überführung des heidnischen Stoffes in den christlichen Kontext, den Vergleich von Ovids Version mit einer mittelalterlichen Adaption, die Rolle der Liebe und Leidenschaft in den verschiedenen Versionen, die Veränderung der Deutung des Selbstmordes und die Adaption des Stoffes in der Frühen Neuzeit.
Wie wird Ovids Version analysiert?
Die Analyse von Ovids Version umfasst die Einbettung der Geschichte in eine Rahmenerzählung, die Betonung der Metamorphose des Maulbeerbaumes, die Darstellung der Liebe (durch Metaphorik des Feuers und Personifikation), die erzwungene Trennung der Liebenden und ihre Reaktion darauf, sowie die sprachlichen Mittel (rhetorische Stilmittel, Verwendung der dritten Person Plural).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pyramus und Thisbe, Ovid, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Märe, Adaptation, Liebesgeschichte, Selbstmord, christlicher Kontext, Neuakzentuierung, Vergleichende Analyse, Metamorphose.
Was ist die Hypothese der Arbeit?
Die Arbeit geht von der Hypothese aus, dass die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Versionen des Stoffes von Pyramus und Thisbe eine veränderte Akzentuierung im Vergleich zu Ovids Version aufweisen werden, um den christlichen Kontext zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Nadine Fischer (Author), 2017, Antike Stoffe im deutschen Mittelalter. Die Neuakzentuierung der Sage von Pyramus und Thisbe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358948