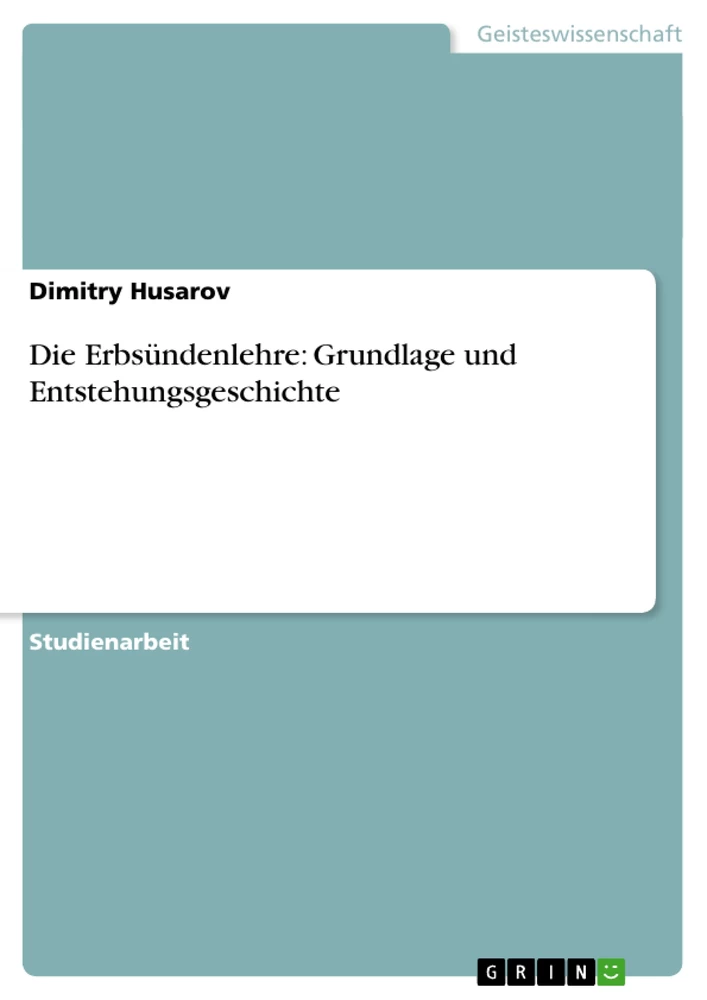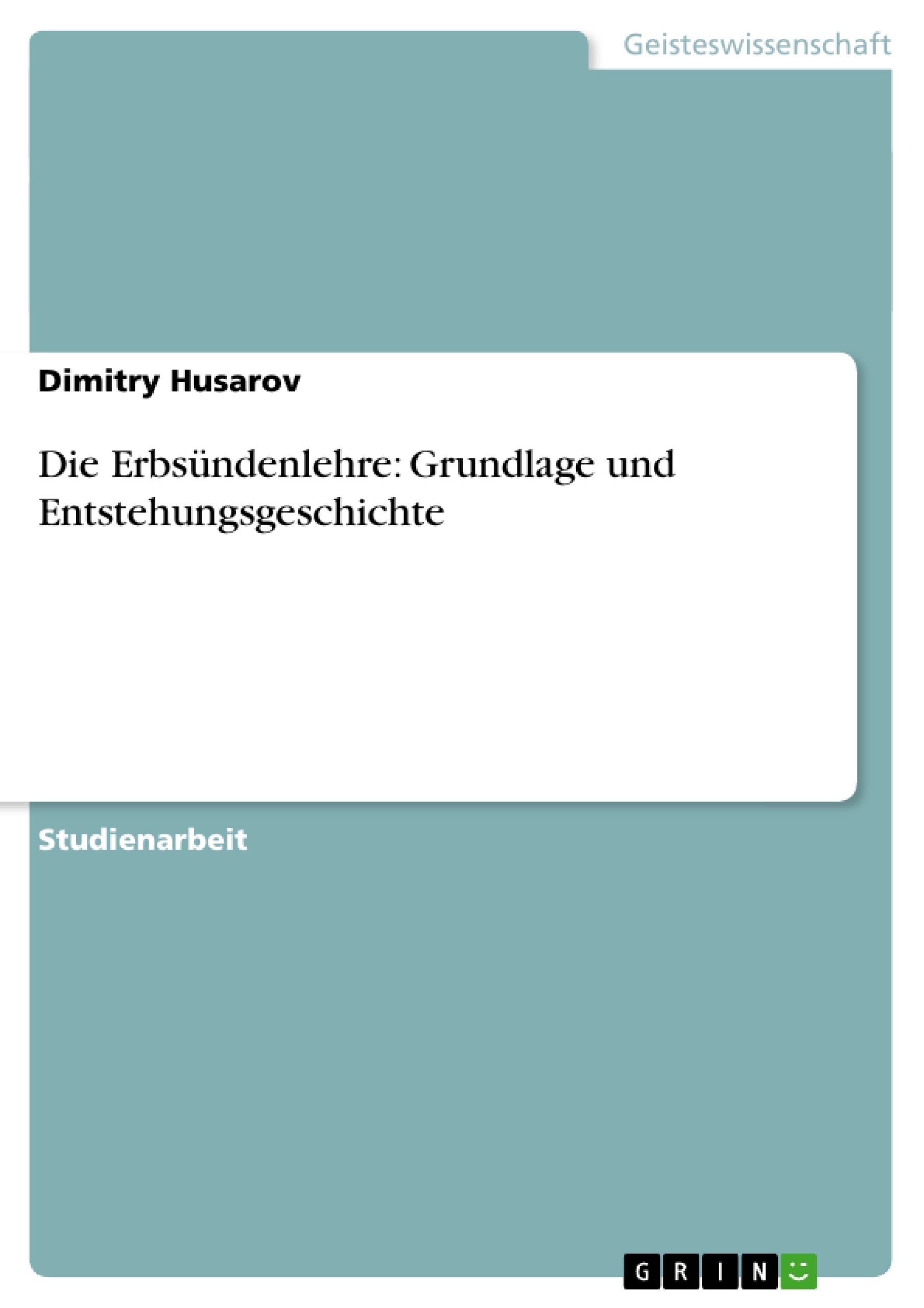Der erste Mensch gab dem Bösen die Möglichkeit in seine Welt zu kommen. Ursprünglich hatte der Mensch die Neigung zur Erkenntnis Gottes und zur Liebe zu ihm gehabt. Das Böse wählte der Mensch nur, weil es ihm von der Schlange zugeflüstert worden war. Das Böse im Menschen, und durch ihn auch im Universum, ist daher mit einer ansteckenden Krankheit vergleichbar, die sich auf keinen Fall automatisch verbreitet. Nur durch seine freie Entscheidung ließ der Mensch sich damit anstecken. Der Mensch lieferte sich selbst dieser Pest aus. Die Frucht wurde aufgegessen, die Sünde entwickelte sich weiter. Adam schob seine Schuld auf Eva. Kain tötete Abel. Die Geschichte der Menschheit beschleunigte sich. Der Mensch aber ist von nun an unter der Macht des Bösen. Durch die Trennung des Menschen von Gott wird sein Wesen widernatürlich, verzerrt. Der entstellte Verstand spiegelt nicht mehr das Himmlische, sondern nur das Irdische und primitive Materielle wieder. Der Geist fing an der Seele zu nagen an. Er stellte die göttliche Nahrung zur Seite. Sie, die Seele wurde durch die Begierde zum Parasiten des Fle isches. Der Leib wurde zum Schmarotzer des Erdkreises. Der Mensch tötet, um weiter zu leben und sichert damit den Tod auch für sich. 3
Gott aber vernichtet den Menschen nicht. Die Erde existiert bis heute. Die Welt, in der der Tod seinen Platz fand, ist eher eine Katastrophe, als eine ursprünglich geschaffene Ordnung. Verflucht ist die Erde um des Menschen willen. Und das alles geschieht nur wegen einer einzigen falschen Entscheidung des Urvaters? Gründet die Sünde immer noch in der persönlichen Entscheidung eines einzelnen Menschen? Wird ein Mensch bereits vor seiner eigenen Willensentscheidung in eine umfassende Unheilssituation, die das Resultat menschlicher Geschichte darstellt, hineingeboren? Vererbt der Mensch nur eine durch die Sünde negativ geprägte Situation oder sitzt die Krankheit Adams tief in den Genen des Menschen? Gibt es ein Heilsmittel?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Problemstellung
- 2 Die Definition
- 3 Geschichtliche Entwicklung
- 4 Die Vorgehensweise und das Ziel dieser Arbeit
- I. Die Erbsünde bei Paulus
- A. Die Aussagen zur sündhaften Natur des Menschen im Römerbrief
- 1. Röm 1,24-31
- 2. Röm 3,10-17. 23
- 3. Röm 5,12-19
- 4. Röm 6,17-23
- 5. Röm 7,5-25
- 6. Röm 8, 3-10
- B. Die menschliche Natur in den anderen paulinischen Schriften
- 1. 1. Kor 2,14
- 2. 1. Kor 15,20-22
- 3. Gal 5,17-19.24
- 4. Eph 2,3
- 5. Eph 4,22
- A. Die Aussagen zur sündhaften Natur des Menschen im Römerbrief
- II. Augustinus - Der Vater der Erbsündentheologie
- A. Der Hintergrund
- B. Der Paradigmenwechsel
- C. Die Entstehung der Lehre – die ersten Gedanken
- D. Die Ausformung der Lehre – der pelagianische Streit
- E. Von der Konkupiszenz gefangen
- F. Röm 5,12 – der Ausgangspunkt der Lehre
- G. Die Randerscheinung – die juristische Erbschuld
- Ergebnis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt die Entwicklung der Erbsündenlehre, beginnend mit ihren neutestamentlichen Ursprüngen in der paulinischen Theologie und ihrer Ausformung als theologische Disziplin durch Augustinus. Das Ziel ist nicht die Präsentation einer eigenen Antwort auf das Problem der Erbsünde, sondern die Bereitstellung grundlegender Informationen für zukünftige Forschung.
- Die neutestamentlichen Grundlagen der Erbsündenlehre (insbesondere bei Paulus).
- Die Entwicklung der Erbsündenlehre durch Augustinus und den pelagianischen Streit.
- Die historische Entwicklung der Erbsündenlehre von der Antike bis zur Reformation.
- Unterschiedliche theologische Positionen zur Erbsünde.
- Das Verständnis der menschlichen Natur im Kontext der Erbsünde.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Erbsünde und ihrer Bedeutung für das christliche Verständnis des Menschen. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die Problemstellung: Ist die Sünde eine persönliche Entscheidung des Einzelnen oder eine vererbte Bedingung der menschlichen Existenz? Die Einleitung benennt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden sollen.
1 Die Problemstellung: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des Sündenfalls Adams auf die Menschheit. Es beschreibt den Zustand des Menschen nach dem Sündenfall als von Bösem geprägt und vergleicht ihn mit einer ansteckenden Krankheit. Die Frage, ob die Sünde auf der persönlichen Entscheidung des Einzelnen beruht oder ob der Mensch in eine durch die Geschichte der Menschheit vorgeprägte Situation hineingeboren wird, wird thematisiert.
2 Die Definition: Dieses Kapitel definiert die Erbsündenlehre als einen zentralen Bestandteil des Christentums. Es erläutert die christliche Vorstellung vom Zustand der Menschheit als Folge des Sündenfalls Adams. Die Bedeutung der Erlösung aus diesem Zustand im Zentrum christlicher Theologie wird hervorgehoben. Der Sündenfall Adams im Alten Testament und die Interpretation dieses Berichtes durch Paulus werden als Grundlage des Konzepts vorgestellt.
3 Geschichtliche Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Erbsündenlehre. Es beginnt mit den ersten nachapostolischen Ausarbeitungen durch Augustinus und seinem Konflikt mit Pelagius. Die Weiterentwicklung der Lehre während der Scholastik und Reformation wird erläutert, wobei die unterschiedlichen Auffassungen von Luther und der römisch-katholischen Kirche im Mittelpunkt stehen. Die verschiedenen theologischen Positionen und die anhaltende Debatte über die Erbsünde bis in die Gegenwart werden angesprochen.
4 Die Vorgehensweise und das Ziel dieser Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen und die Zielsetzung der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der neutestamentlichen Ursprünge der Erbsündenlehre bei Paulus und der Ausgestaltung der Lehre durch Augustinus. Es wird betont, dass die Arbeit keine eigene Antwort auf das Problem der Erbsünde bieten, sondern vielmehr die Grundlage für weitere Forschung legen soll.
Schlüsselwörter
Erbsünde, Sündenfall, Adam, Paulus, Augustinus, Pelagius, Reformation, menschliche Natur, Sündhaftigkeit, Erlösung, Theologie, Anthropologie, neutestamentliche Theologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Entwicklung der Erbsündenlehre
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Erbsündenlehre, beginnend mit ihren neutestamentlichen Ursprüngen bei Paulus und ihrer Ausformung durch Augustinus. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Entwicklung und der verschiedenen theologischen Positionen, nicht auf der Präsentation einer neuen Antwort auf das Problem der Erbsünde.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die neutestamentlichen Grundlagen der Erbsündenlehre (insbesondere bei Paulus), die Entwicklung der Lehre durch Augustinus und den pelagianischen Streit, die historische Entwicklung von der Antike bis zur Reformation, verschiedene theologische Positionen zur Erbsünde und das Verständnis der menschlichen Natur im Kontext der Erbsünde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Kapitel "Die Problemstellung", "Die Definition", "Geschichtliche Entwicklung" und "Die Vorgehensweise und das Ziel dieser Arbeit", sowie zwei größere Abschnitte: I. Die Erbsünde bei Paulus und II. Augustinus - Der Vater der Erbsündentheologie. Die Arbeit schließt mit einem Ergebnis und einer Zusammenfassung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Problemstellung darlegt. Es folgen Kapitel, die die Problemstellung, die Definition der Erbsünde, ihre historische Entwicklung und das methodische Vorgehen der Arbeit erläutern. Die Hauptteile befassen sich detailliert mit der paulinischen Sichtweise der Erbsünde und der Ausgestaltung der Lehre durch Augustinus. Die Arbeit endet mit einem Ergebnis und einer Zusammenfassung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist nicht die Präsentation einer eigenen Position zur Erbsünde, sondern die Bereitstellung grundlegender Informationen und die Erarbeitung einer umfassenden Übersicht über die Entwicklung der Erbsündenlehre für zukünftige Forschung.
Welche neutestamentlichen Quellen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die paulinischen Schriften, insbesondere Römer 1,24-31; Römer 3,10-17. 23; Römer 5,12-19; Römer 6,17-23; Römer 7,5-25; Römer 8, 3-10; 1. Korinther 2,14; 1. Korinther 15,20-22; Galater 5,17-19.24; Epheser 2,3; und Epheser 4,22.
Welche Rolle spielt Augustinus in der Arbeit?
Augustinus wird als zentraler Akteur in der Entwicklung der Erbsündenlehre betrachtet. Die Arbeit untersucht seinen Hintergrund, den Paradigmenwechsel in seinem Denken, die Entstehung und Ausformung seiner Lehre, den pelagianischen Streit und seine Interpretation von Römer 5,12.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erbsünde, Sündenfall, Adam, Paulus, Augustinus, Pelagius, Reformation, menschliche Natur, Sündhaftigkeit, Erlösung, Theologie, Anthropologie, neutestamentliche Theologie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit der Erbsündenlehre auseinandersetzen möchten und eine fundierte Übersicht über die Entwicklung dieser theologischen Disziplin suchen. Sie dient als Grundlage für weitere Forschung.
- Quote paper
- Dimitry Husarov (Author), 2003, Die Erbsündenlehre: Grundlage und Entstehungsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35835