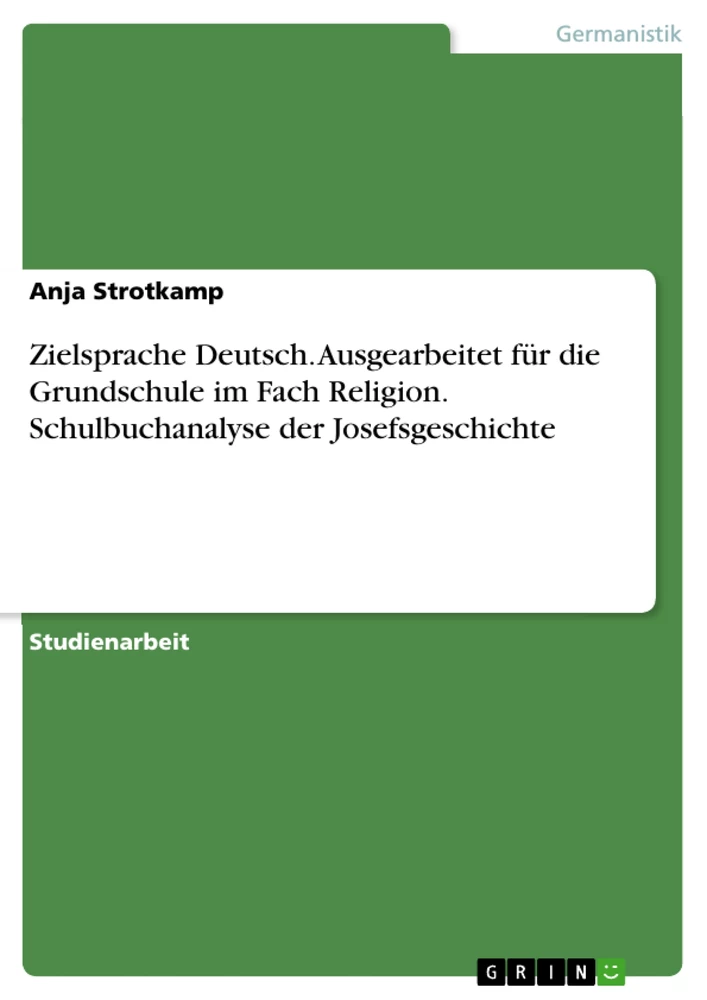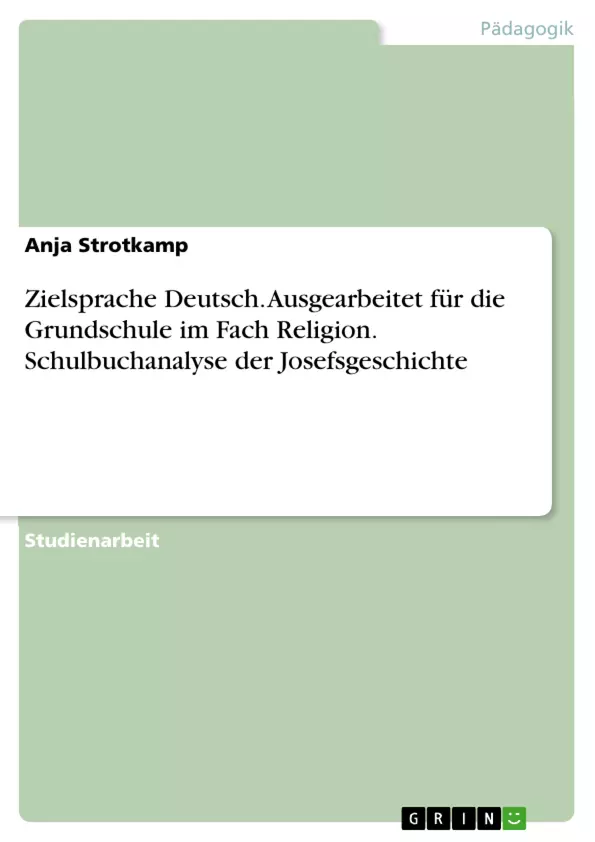Sprache im Fach ist derzeit ein hochbrisantes bildungs- und forschungspolitisches Thema der Fachdidaktik, welches bislang noch nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Förderung von sprachlichen Kompetenzen ist jedoch in jedem Fach erforderlich, um erfolgreiches Lernen für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Die Bildungssprache stellt für die meisten Schülerinnen und Schüler eine besondere Herausforderung dar, da sie im Vergleich zur Alltagssprache abstrakter, präziser und grammatisch komplexer ist. Hinzu kommen die Fachausdrücke der verschiedenen Unterrichtsfächer, die für Schülerinnen und Schüler mit einer Fremdsprache meistens nur sehr schwer zu bewältigen sind. Diesbezüglich ist es wichtig, Verstehens- und Mitteilungsfähigkeiten im Mündlichen wie auch im Schriftlichen in den Unterricht zu integrieren, da diese Problematik fächerübergreifend ist.
Feilke (2012) stellt in seinem Text die Sprachregister Bildungssprache, Schulsprache, Fachsprache, Wissenschaftssprache und Alltagssprache grafisch dar, um aufzuzeigen, wie die Register miteinander verzahnt sind.
Die Register Bildungs- und Schulsprache beziehen sich beide auf das Lernen und Lehren während sich die Bildungssprache vorwiegend auf schriftliche Situationen bezieht, auch wenn es mehr medial mündlich gebraucht wird. Im Gegenzug ist die Schulsprache im Bereich der Didaktik wieder zu finden. Als Beispiel nennt Feilke hier die „Erörterung“, die nur im schulischen Kontext angewendet wird und im Alltag nicht zum Einsatz kommt. Die beiden genannten Sprachbegriffe bilden die Kernregister für den Bereich Lernen und Lehren und lassen sich leicht von anderen schultypischen Sprach- und Kommunikationsformen abgrenzen. Dafür zeigt Feilke beispielhaft das Unterregister „classroom language“ auf, die das Basisvokabular zur praktischen Organisation von Unterricht impliziert. Hierbei handelt es sich um alltägliche Rituale und morgendliche Begrüßungen innerhalb des Klassenzimmers.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auswahl der Textgrundlage und Lehrbuchanalyse
- Auswahl der Lehrwerke
- Aufbau der Lehrwerke
- Die Josefsgeschichte im Vergleich der Lehrwerke
- Scaffolding
- Forschungsprojekt DaZ-Net
- Sprache in den Bildungsstandards/Kerncurriculum für das Fach Religion
- Bildungsstandards des Religionsunterrichts
- Sprache im Fach Religion
- Abschließende Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Umgang mit Sprache in zwei Lehrwerken für den Religionsunterricht der Grundschule am Beispiel der Josefsgeschichte. Ziel ist es, die sprachliche Gestaltung der Lehrwerke zu untersuchen und deren Eignung für einen sprachsensiblen Unterricht zu bewerten. Dabei wird auch die Bedeutung von Scaffolding und die Rolle von Projekten wie DaZ-Net im Kontext der sprachlichen Förderung im Religionsunterricht beleuchtet.
- Sprachsensibler Religionsunterricht
- Lehrwerkanalyse im Fach Religion
- Die Josefsgeschichte als Beispieltext
- Scaffolding als Lehrmethode
- Sprachförderung im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachförderung im Religionsunterricht ein und betont die Bedeutung der Bildungssprache. Sie hebt die Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hervor und benennt die Notwendigkeit eines sprachsensiblen Unterrichts. Die Arbeit fokussiert auf die Lehrbuchanalyse, wobei die Lehrwerke „Die Reli-Reise 1/2“ und „Kinder fragen nach dem Leben“ im Vergleich untersucht werden, um zu ermitteln, ob sie den Anforderungen eines sprachsensiblen Unterrichts gerecht werden. Die Methode des Scaffolding und das Projekt DaZ-Net werden als relevante Aspekte der Sprachförderung angekündigt.
Auswahl der Textgrundlage und Lehrbuchanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Auswahl der Lehrwerke „Die Reli-Reise 1/2“ und „Kinder fragen nach dem Leben“ für die Analyse. Die Josefsgeschichte wird als exemplarischer Text für den Vergleich ausgewählt, da sie ein häufiges Thema im Religionsunterricht der Grundschule ist. Das Kapitel legt den Fokus auf die sprachliche Analyse der Lehrwerke anhand eines Kriterienkatalogs, um die Merkmale der fachlichen Sprache und deren Umsetzung zu untersuchen. Die Auswahl der Lehrwerke wird begründet und die Relevanz der Josefsgeschichte im Kontext des Grundschulunterrichts hervorgehoben.
Auswahl der Lehrwerke: Dieses Unterkapitel detailliert die spezifischen Eigenschaften der beiden ausgewählten Lehrwerke: „Die Reli-Reise 1/2“ (Klett-Verlag) und „Kinder fragen nach dem Leben“ (Cornelsen-Verlag). Es werden die Veröffentlichungsjahre und die Zielgruppen der Bücher genannt, um den Kontext der Analyse zu verdeutlichen. Die Auswahl wird im Hinblick auf ihre Relevanz für den Vergleich und die Analyse des Umgangs mit Sprache im Religionsunterricht der Grundschule begründet.
Aufbau der Lehrwerke: Der Aufbau der Lehrwerke „Die Reli-Reise 1/2“ und „Kinder fragen nach dem Leben“ wird verglichen. Die strukturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, wie die Kapitelstruktur, die Verwendung von Überschriften und die Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses, werden analysiert und beschrieben. Der Vergleich zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für den Umgang mit Sprache und die didaktische Gestaltung der jeweiligen Lehrwerke zu schaffen.
Schlüsselwörter
Sprachsensibler Unterricht, Bildungssprache, Lehrwerkanalyse, Religionsunterricht, Grundschule, Josefsgeschichte, Scaffolding, DaZ-Net, Sprachförderung, Lehrbücher, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen zur Lehrwerkanalyse: Sprachförderung im Religionsunterricht
Welche Lehrwerke werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Lehrwerke „Die Reli-Reise 1/2“ (Klett-Verlag) und „Kinder fragen nach dem Leben“ (Cornelsen-Verlag) im Hinblick auf ihren Umgang mit Sprache im Religionsunterricht der Grundschule.
Welcher Text dient als Grundlage der Analyse?
Die Josefsgeschichte wurde als exemplarischer Text ausgewählt, da sie ein häufiges Thema im Religionsunterricht der Grundschule darstellt und somit einen guten Vergleich der Lehrwerke ermöglicht.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sprachliche Gestaltung der beiden Lehrwerke und bewertet deren Eignung für einen sprachsensiblen Unterricht. Ein Fokus liegt auf der Identifizierung von Merkmalen der fachlichen Sprache und deren Umsetzung in den Lehrwerken.
Welche Aspekte der Sprachförderung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Scaffolding und die Rolle von Projekten wie DaZ-Net im Kontext der sprachlichen Förderung im Religionsunterricht. Es geht um die Förderung der Bildungssprache und die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Die Analyse erfolgt anhand eines Kriterienkatalogs, der die Merkmale der fachlichen Sprache und deren Umsetzung in den Lehrwerken untersucht. Der Vergleich umfasst den Aufbau der Lehrwerke (Kapitelstruktur, Überschriften, Inhaltsverzeichnis) und die sprachliche Gestaltung der Josefsgeschichte in beiden Werken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Auswahl der Textgrundlage und Lehrbuchanalyse (inkl. Unterkapiteln zu den einzelnen Lehrwerken und deren Aufbau), ein Kapitel zu Scaffolding, ein Kapitel zum Forschungsprojekt DaZ-Net, ein Kapitel zu Sprache in den Bildungsstandards/Kerncurriculum für das Fach Religion und eine abschließende Reflexion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachsensibler Unterricht, Bildungssprache, Lehrwerkanalyse, Religionsunterricht, Grundschule, Josefsgeschichte, Scaffolding, DaZ-Net, Sprachförderung, Lehrbücher, Kompetenzen.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Das Ergebnis der Arbeit ist eine Bewertung der Eignung der analysierten Lehrwerke für einen sprachsensiblen Religionsunterricht. Die Arbeit zeigt auf, inwiefern die Lehrwerke die Anforderungen an einen sprachsensiblen Unterricht erfüllen und welche Potenziale und Herausforderungen sich in Bezug auf Sprachförderung im Religionsunterricht zeigen.
- Quote paper
- Anja Strotkamp (Author), 2017, Zielsprache Deutsch. Ausgearbeitet für die Grundschule im Fach Religion. Schulbuchanalyse der Josefsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358339