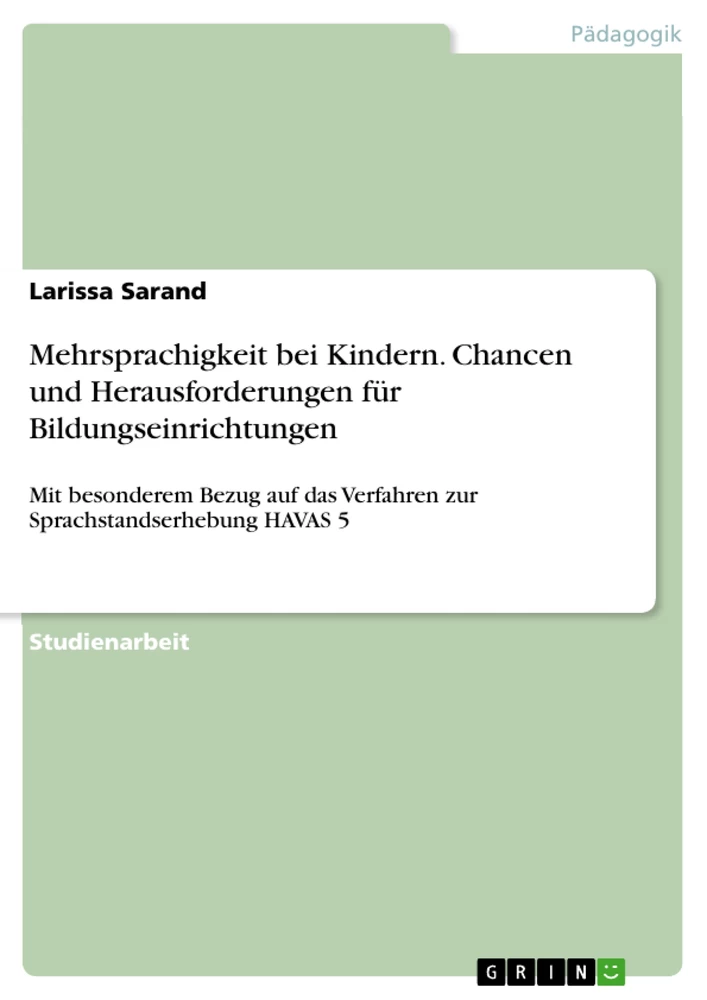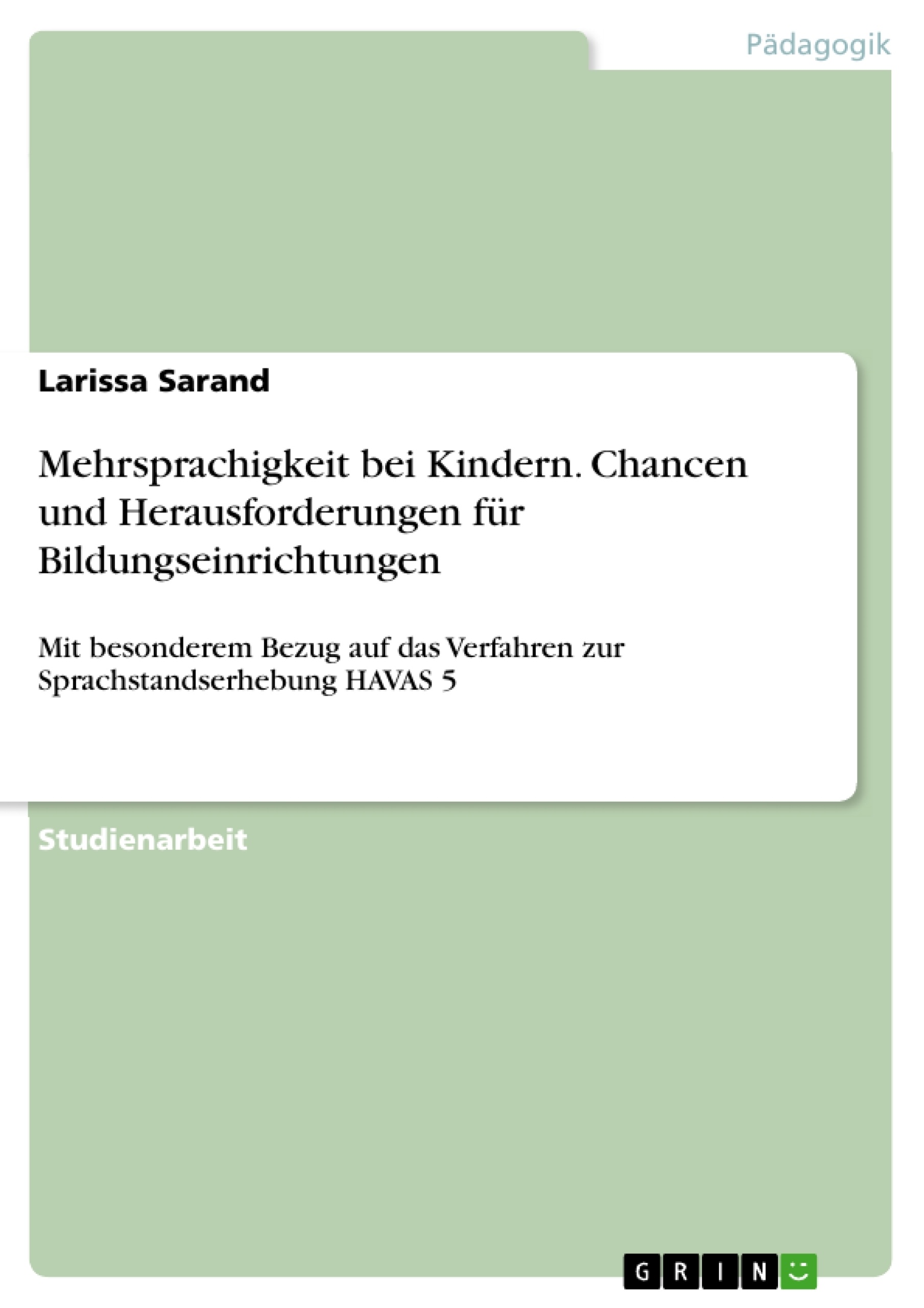Ein nützliches Instrument, um die Sprachwelt von Kindern zu erforschen ist die Sprachstandsdiagnose, mit der sich diese Arbeit auseinandersetzen wird. Die Anforderungen an Diagnoseverfahren sind hoch. Ein besonders wichtiger Aspekt ist hierbei die Berücksichtigung und der Einbezug von Mehrsprachigkeit in den Ergebnissen. Bereits hier aber stellt sich die Frage: Wann kann bei einem Kind von Mehrsprachigkeit gesprochen werden? Und wie kann ermittelt werden, welche Sprache als Erst- und welche als Zweitsprache angesehen werden muss? Mit eben diesen Fragen setzt sich Kapitel 2 dieser Arbeit auseinander.
Sprachförderung wird von Ländern und Kommunen häufig nur dann finanziert, wenn Ergebnisse aus Sprachstandsdiagnosen dies unabdingbar machen. Außerdem beginnt die finanzielle Unterstützung von sprachlichen Fördermaßnahmen oft erst ab dem dritten Lebensjahr und hängt auch von einem Mindestprozentsatz an Kindern nicht-deutscher Herkunft ab. Eine fundierte Diagnose über Entwicklungsrückstände und Fördermaßnahmen obliegt hierbei Ärzt/innen und Logopäd/innen – nichts desto trotz müssen Defizite bereits vorher von Erzieher/innen und Lehrer/innen erkannt werden.
Der Umgang mit sprachlichen Defiziten ist an Schulen in aller Welt heterogen. Kapitel 3 setzt sich mit Forderungen bezüglich des Umgangs mit Mehrsprachigkeit im Unterricht und den aktuellen Problemen mit
Mehrsprachigkeit an deutschen Schulen auseinander. Es zeigt auf, dass in Kanada bereits ein Weg gefunden wurde mit den Herausforderungen, die Mehrsprachigkeit im Unterricht mit sich bringt, für alle Beteiligten
zufriedenstellend umzugehen. Wenn Verfahren zur Sprachstandsdiagnose nachhaltig von Nutzen sein sollen, müssen klare Ansprüche an sie formuliert werden. Darum bemüht sich Kapitel 3. Welche Entscheidungshilfen für oder gegen sprachlichen Förderbedarf es gibt, wird in Kapitel 3.1 dargelegt.
Kapitel 4 widmet sich dem Diagnoseverfahren HAVAS 5. Die besonderen Merkmale und der positive Nutzen, den es mit sich bringt, werden aufgezeigt. Anschließend wird das Verfahren genauer erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache – ein Abgrenzungsproblem
- 3. Der Umgang mit Zwei- und Mehrsprachigkeit im Unterricht
- 4. Leitgedanken der Sprachstandsdiagnostik
- 4.1 Entscheidungshilfen für oder gegen sprachliche Fördermaßnahmen bei Mehrsprachigkeit
- 5. HAVAS 5 – Das Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjährigen
- 5.1 Entstehung
- 5.2 Reich und Roth über Sprachstand
- 5.3 HAVAS 5: Die Durchführung
- 5.4 HAVAS 5: Die Auswertung
- 5.5 HAVAS 5: Perspektiven
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit bei Kindern im Bildungssystem, mit besonderem Fokus auf das HAVAS 5 Verfahren zur Sprachstandserhebung. Die Zielsetzung besteht darin, die Komplexität der Mehrsprachigkeit zu beleuchten und die Bedeutung einer adäquaten Sprachstandsdiagnose herauszustellen.
- Abgrenzung von Erst-, Zweit- und Fremdsprache
- Der Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht
- Leitgedanken der Sprachstandsdiagnostik
- Das HAVAS 5 Verfahren: Durchführung und Auswertung
- Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit für Bildungseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sprachstandsdiagnose bei mehrsprachigen Kindern ein und betont die Bedeutung einer umfassenden Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten für die Gestaltung der kindlichen Sprachwelt. Sie hebt die hohen Anforderungen an Diagnoseverfahren hervor und stellt die zentrale Frage nach der Abgrenzung von Erst-, Zweit- und Fremdsprache, die im folgenden Kapitel vertieft wird. Die Einleitung unterstreicht zudem die Notwendigkeit frühzeitiger Erkennung von sprachlichen Defiziten und die heterogenen Ansätze im Umgang damit in verschiedenen Schulsystemen weltweit.
2. Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache – ein Abgrenzungsproblem: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit der Terminologie rund um den Spracherwerb. Es problematisiert den Begriff "Muttersprache" und bevorzugt "Erstsprache", um die Mehrsprachigkeit besser abzubilden. Es wird darauf eingegangen, dass ein Kind zwei Erstsprachen haben kann und die Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitsprache fließend ist, besonders im Kontext des frühen, simultanen Spracherwerbs. Der Stellenwert der Sprachen kann sich zudem im Laufe des Lebens verändern, je nach Kontext und Lebensumständen. Schließlich wird die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen Zweit- und Fremdsprachenerwerb beleuchtet, da sich die Grenzen zwischen gesteuertem und ungesteuertem Erwerb oft verschwimmen.
3. Der Umgang mit Zwei- und Mehrsprachigkeit im Unterricht: Dieses Kapitel untersucht den Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht und die damit verbundenen Herausforderungen. Es thematisiert vorhandene Vorurteile gegenüber mehrsprachigen Kindern und den Einfluss des sozioökonomischen Status auf den Bildungserfolg. Die Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Stufen des Spracherwerbs in Schulklassen und beleuchtet die Notwendigkeit, auf die individuellen Bedürfnisse mehrsprachiger Kinder einzugehen. Es wird auf positive Beispiele aus anderen Ländern, wie Kanada, verwiesen, wo erfolgreiche Modelle zur Integration von Mehrsprachigkeit im Unterricht implementiert wurden.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Sprachstandsdiagnose, Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache, HAVAS 5, Sprachförderung, Bildungseinrichtungen, Spracherwerb, Integration.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Sprachstandsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit der Sprachstandsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern, insbesondere im Kontext des Hamburger Verfahrens zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjährigen (HAVAS 5). Es beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem und die Bedeutung einer adäquaten Sprachstandsdiagnose.
Welche Themen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Abgrenzung von Erst-, Zweit- und Fremdsprache, den Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht, die Leitgedanken der Sprachstandsdiagnostik, das HAVAS 5 Verfahren (Entstehung, Durchführung, Auswertung, Perspektiven) und die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit für Bildungseinrichtungen.
Was ist das HAVAS 5 Verfahren?
HAVAS 5 ist das Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjährigen. Das Dokument beschreibt ausführlich dessen Entstehung, Durchführung und Auswertung, sowie mögliche zukünftige Perspektiven des Verfahrens.
Wie wird Mehrsprachigkeit im Unterricht behandelt?
Das Dokument untersucht den Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht und die damit verbundenen Herausforderungen, inklusive vorhandener Vorurteile und des Einflusses des sozioökonomischen Status. Es werden Beispiele für erfolgreiche Integrationsmodelle aus anderen Ländern (z.B. Kanada) vorgestellt.
Wie werden Erst-, Zweit- und Fremdsprache abgegrenzt?
Das Dokument hinterfragt kritisch die traditionelle Terminologie und bevorzugt den Begriff "Erstsprache" anstelle von "Muttersprache", um die Mehrsprachigkeit besser abzubilden. Es betont die fließenden Übergänge zwischen Erst- und Zweitsprache, besonders beim simultanen Spracherwerb, und die Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen Zweit- und Fremdsprachenerwerb.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Sprachstandsdiagnose, Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache, HAVAS 5, Sprachförderung, Bildungseinrichtungen, Spracherwerb, Integration.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Komplexität der Mehrsprachigkeit zu beleuchten und die Bedeutung einer adäquaten Sprachstandsdiagnose für die Gestaltung der kindlichen Sprachwelt und den Bildungserfolg hervorzuheben.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Einleitung, der Abgrenzung von Sprachtypen, dem Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht, den Leitgedanken der Sprachstandsdiagnostik, dem HAVAS 5 Verfahren und einem Fazit befassen. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
- Quote paper
- Larissa Sarand (Author), 2013, Mehrsprachigkeit bei Kindern. Chancen und Herausforderungen für Bildungseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357322