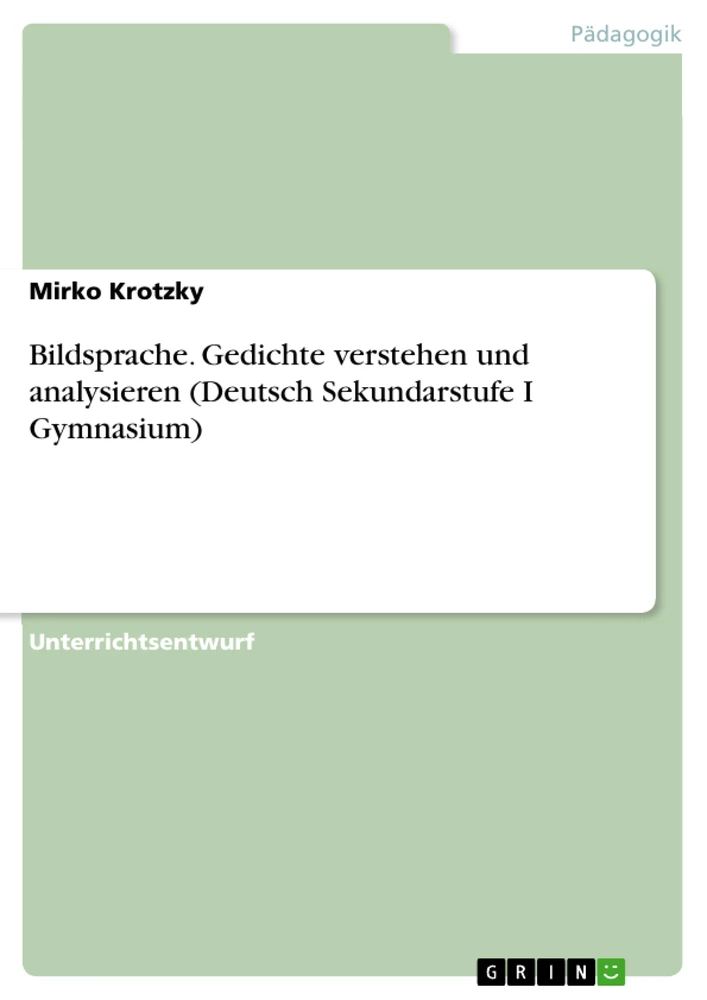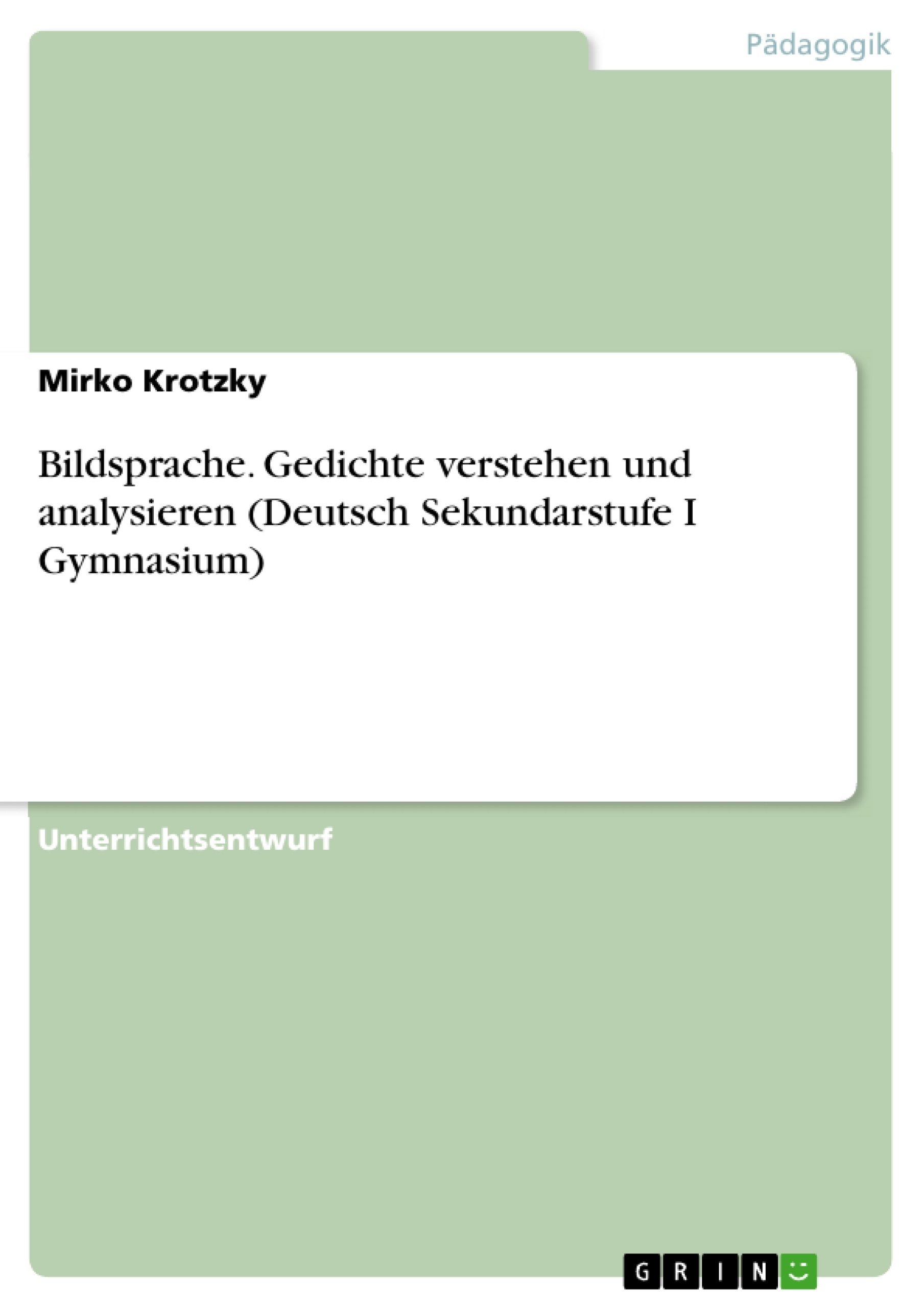Die Unterrichtsreihe "Gedichte verstehen und analysieren" umfasst, ausgehend von individuellen persönlichen Erfahrungen der Lernenden, was eigentlich ein Gedicht zu einem Gedicht macht, welche künstlerische und ästhetische Gestaltung Gedichten in ihren unterschiedlichsten Formen zugrunde liegt, wie sich Gedichte dem "Denken in Bildern" (Metaphern) bedienen, wie diverse rhetorische Stilmittel in Gedichten mit ihren jeweiligen Wirkungsabsichten zum Einsatz gelangen, wie in einer Rhetorikwerkstatt eigene Einfälle und Ideen dichterische Gestaltungsformen annehmen können, was einen Dichter ausmacht und wodurch sich seine Person definiert sowie den gelungenen Aufbau von Gedichtanalysen. Einen sachlogischen Abschluss erfährt die Reihe durch die Korrektur und abschließende kriteriengeleitete Bewertung fremder Gedichtanalysen, wodurch gleichzeitig eine transparente und verlässliche Vorbereitung der vierten Klassenarbeit in der 8. Jahrgangsstufe erreicht wird.
Zum Stundenverlauf:
Nach einem konfrontativen Einstieg durch Lehrervortrag des Gedichts "Bitte an einen Delphin" von Hilde Domin lesen die SuS das Gedicht nochmals auf ihren Arbeitsblättern. Sie markieren dabei alle sprachlichen Bilder, die in diesem Gedicht sehr massiv auftreten und damit auffällig sind, und notieren zu zwei Bildern ihre pers. Assoziationen. Die Ergebnisse werden zunächst im Plenum besprochen, bevor sich eine weitergehende Partnerarbeitsphase zum Begriff "Delfin" anschließt. Dazu entwerfen die SuS Assoziationssterne und notieren, welche persönlichen Gedanken sie mit einem Delfin verbinden, um dessen Bedeutung im Gedicht zu erschließen. Anschließend werden diese über einen Sachtext erweitert, der die Bedeutung des Delfins historisch nachzeichnet. Hierzu eignet sich die Think-Pair-Share-Methode: Die SuS markieren wichtige Informationen zum Thema, die ihr pers. Bild des Delfins bereichern, erst in Einzelarbeit. Anschließend vergleichen sie ihre Ergebnisse, ergänzen ihre Sterne und schreiben das Gedicht in einen pragmatischen Text um. Durch die Umschrift des lyr. Textes wird neben dem notwendigen Erkennen und Auflösen sprachlicher Bilder eine eigene Deutung des Ausgangstextes evoziert, die dem Plenum abschließend präsentiert, durch dieses ergänzt, hinterfragt und/oder korrigiert werden kann. Als Hausaufgabe erfolgt die Anwendung und der Transfer dieser neu erworbenen Techniken, indem die SuS die sprachlichen Bilder eines weiteren Gedichts in differenzierender Form umsetzen sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtseinheit
- Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe
- Thema der Unterrichtsstunde
- Ziele der Unterrichtsstunde
- Kompetenzbezüge der Lernziele
- Bedingungsanalyse
- Hausaufgabe
- Geplanter Unterrichtsverlauf (45 Minuten)
- Didaktisch-methodische Begründungen
- Materialien und antizipierte Schülerleistung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsplanung im Fach Deutsch für die Sekundarstufe I besteht darin, den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes Verständnis für die Analyse und Interpretation von Gedichten zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von analytischen Fähigkeiten und dem Verständnis verschiedener dichterischer Gestaltungsmittel.
- Verständnis und Analyse von Gedichten
- Anwendung rhetorischer Mittel in der Lyrik
- Entwicklung von Sprachgefühl und Sprachbewusstsein
- Erstellung eigener Gedichtanalysen
- Reflexion der eigenen Sichtweise auf Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Thema der Unterrichtseinheit: Diese Einheit zielt darauf ab, die Schüler in die Lage zu versetzen, Gedichte umfassend zu verstehen und zu analysieren. Der Weg führt von persönlichen Erfahrungen mit Gedichten über die Erarbeitung rhetorischer Mittel bis hin zum Verfassen eigener Analysen. Die Einheit legt den Grundstein für ein tieferes Verständnis lyrischer Texte und ihrer Wirkung.
Sachanalyse und Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe: Die Unterrichtsreihe basiert auf dem hessischen Kerncurriculum für Deutsch. Sie beginnt mit der Klärung des Begriffs „Gedicht“ anhand der Schülererfahrungen und entwickelt sich über die Analyse verschiedener dichterischer Mittel hin zur eigenständigen Gedichtanalyse. Die Vorstunde fokussierte auf die Sammlung von Vorwissen und die Reflexion der eigenen Einstellung zu Gedichten. Die beschriebene Stunde baut darauf auf und vertieft die Analyse von sprachlichen Bildern am Beispiel des Gedichts „Bitte an einen Delphin“ von Hilde Domin.
Die eigenen Erfahrungen mit Lyrik verbalisieren und sammeln: Diese erste Stunde dient der Erhebung des Vorwissens der Schüler zum Thema Lyrik. Durch ein gemeinsames Clustering werden die Vorkenntnisse transparent gemacht und als Grundlage für den weiteren Unterricht genutzt. Ziel ist es, den individuellen Lernstand zu erfassen und etwaige Verständnisprobleme frühzeitig zu identifizieren.
Übersetzung der Bildsprache eines Gedichts: In dieser Doppelstunde werden die Schüler mit der Bildlichkeit lyrischer Texte vertraut gemacht. Anhand eines Beispielgedichts wird die besondere Qualität bildhafter Sprache (Anschaulichkeit, Ausdrucksstärke, Mehrdeutigkeit) verdeutlicht. Assoziationssterne und die Erweiterung durch einen Sachtext unterstützen das Verständnis der Bildsprache.
Nachvollziehung poetischer Beschreibungen: Diese Doppelstunde konfrontiert die Schüler mit der Fähigkeit der Lyrik zur Evokation. Am Beispiel eines Rilke-Gedichts lernen sie den Effekt der Evokation kennen und setzen sich mit dem sprachlichen Mittel des Vergleichs auseinander. Die Übersetzung der Farbvorstellungen in ein praktisches Experiment (Mischen von Wasserfarben) vertieft das Verständnis.
Analyse von Metaphern im semantischen Kontext: Diese Doppelstunde vermittelt den Schülern ein Verfahren zur Erschließung von Metaphern. Sie lernen den Semantisierungsvorgang zu verstehen, der durch Metaphern ausgelöst wird, und können so im weiteren Verlauf die Wirkung von Metaphern besser nachvollziehen.
Erstellung von formadäquaten Parallelgedichten: Die Schüler analysieren Gedichte mit besonders ausgeprägten Formelementen und schreiben eigene Parallelgedichte. Ziel ist die Sensibilisierung für die Bedeutung der Form (Komposition und Gestaltung) in der Lyrik.
Grafische Veranschaulichung einer Gedichtstruktur: Am Beispiel des Gedichts „Kulisse“ von Wolfdietrich Schnurre wird der Zusammenhang zwischen Form und inhaltlicher Aussage verdeutlicht. Durch grafische Mittel und „Textdesign“ machen sich die Schüler die Funktion der Gestaltungsmerkmale bewusst und präsentieren ihre Ergebnisse in einem „Museumsgang“.
Durchführung einer formalen und inhaltlichen Analyse: Diese Doppelstunde dient der umfassenden Form-Inhalt-Analyse eines Gedichts, dessen Form die inhaltliche Aussage konsequent repräsentiert (z.B. „In sein“ von Ophelia Scadanelli). Eine einleitende Glosse führt in das Themenfeld ein.
Schlüsselwörter
Gedichtanalyse, Lyrik, Rhetorische Mittel, Bildsprache, Metapher, Vergleich, Evokation, Form-Inhalt-Analyse, Gedichtinterpretation, Sprachbewusstsein, Hessisches Kerncurriculum.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsplanung: Gedichtanalyse in der Sekundarstufe I
Was ist das Thema dieser Unterrichtsplanung?
Diese Unterrichtsplanung im Fach Deutsch für die Sekundarstufe I konzentriert sich auf die vertiefte Analyse und Interpretation von Gedichten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung analytischer Fähigkeiten und dem Verständnis verschiedener dichterischer Gestaltungsmittel.
Welche Themen werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die Unterrichtsreihe umfasst verschiedene Aspekte der Gedichtanalyse, beginnend mit der Sammlung von Vorwissen und der Reflexion der eigenen Einstellung zu Gedichten. Weitere Themen sind die Analyse von Bildsprache, Metaphern, Vergleichen, Evokation, Form-Inhalt-Analyse und die Erstellung eigener Gedichtanalysen. Die Schüler lernen, poetische Beschreibungen nachzuvollziehen und die Bedeutung von Form und Gestaltung in der Lyrik zu verstehen.
Welche Ziele werden mit dieser Unterrichtsplanung verfolgt?
Die Schüler sollen ein vertieftes Verständnis für die Analyse und Interpretation von Gedichten erlangen. Sie sollen analytische Fähigkeiten entwickeln, verschiedene dichterische Gestaltungsmittel verstehen und anwenden lernen, ihr Sprachgefühl und Sprachbewusstsein verbessern und eigene Gedichtanalysen erstellen können. Die Reflexion der eigenen Sichtweise auf Lyrik ist ebenfalls ein wichtiges Ziel.
Wie ist der geplante Unterrichtsverlauf aufgebaut?
Die Unterrichtsreihe ist modular aufgebaut und beinhaltet verschiedene Doppelstunden zu spezifischen Aspekten der Gedichtanalyse. Die einzelnen Module bauen aufeinander auf und führen die Schüler schrittweise an komplexere Analysemethoden heran. Die Stunden beginnen mit der Erhebung des Vorwissens und enden mit der Erstellung eigener Gedichte oder Gedichtanalysen.
Welche Materialien werden verwendet?
Die Materialien umfassen Beispielgedichte verschiedener Autoren (z.B. Hilde Domin, Rilke, Wolfdietrich Schnurre, Ophelia Scadanelli), Sachtexte zur Vertiefung des Verständnisses und verschiedene Arbeitsblätter zur Unterstützung der Analyse. Grafische Mittel und praktische Experimente (z.B. Mischen von Wasserfarben) werden ebenfalls eingesetzt.
Wie werden die Kompetenzen der Schüler überprüft?
Die Überprüfung der Schülerkompetenzen erfolgt durch die aktive Teilnahme am Unterricht, die Erstellung von Gedichtanalysen, die Präsentation der Ergebnisse und die Reflexion des eigenen Lernprozesses. Die Hausaufgabe dient ebenfalls als Möglichkeit, das Gelernte zu festigen und zu vertiefen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben diese Unterrichtsplanung am besten?
Schlüsselwörter sind: Gedichtanalyse, Lyrik, Rhetorische Mittel, Bildsprache, Metapher, Vergleich, Evokation, Form-Inhalt-Analyse, Gedichtinterpretation, Sprachbewusstsein, Hessisches Kerncurriculum.
Wie ist die Unterrichtsreihe in das hessische Kerncurriculum eingeordnet?
Die Unterrichtsreihe basiert auf dem hessischen Kerncurriculum für Deutsch und orientiert sich an den dort festgelegten Kompetenzen und Lernzielen.
Welche konkreten Beispiele für Gedichte werden verwendet?
Es werden Gedichte von verschiedenen Autoren verwendet, darunter "Bitte an einen Delphin" von Hilde Domin, ein Gedicht von Rilke, "Kulisse" von Wolfdietrich Schnurre und "In sein" von Ophelia Scadanelli.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Die Unterrichtsplanung nutzt verschiedene Methoden, darunter Clustering, Assoziationssterne, praktische Experimente (z.B. Mischen von Wasserfarben), grafische Veranschaulichung, Gruppenarbeit und Präsentationen.
- Quote paper
- StR Mirko Krotzky (Author), 2016, Bildsprache. Gedichte verstehen und analysieren (Deutsch Sekundarstufe I Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357255