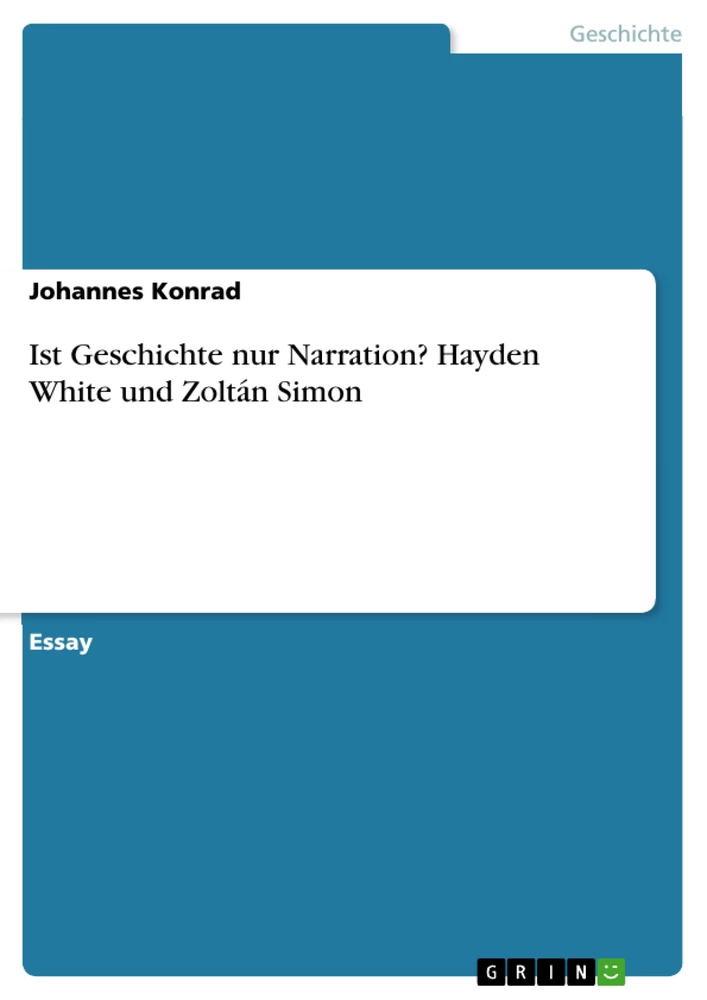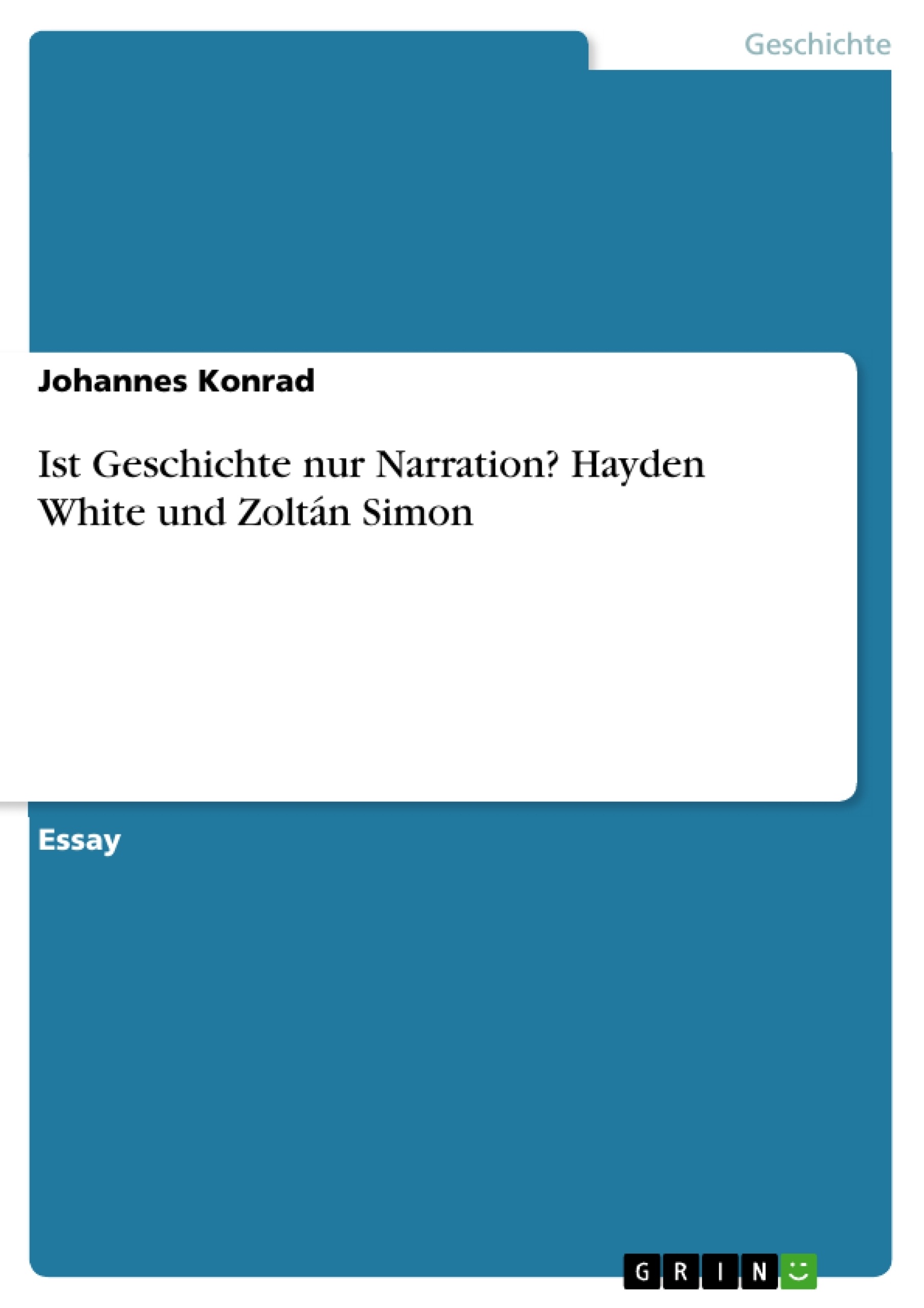"Nein, irgendetwas, sogar deutlich mehr, als wir üblicherweise bereit sind zuzugeben, ist nicht konstruiert, und das ist ein Glück, andernfalls könnten wir zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden."
In dieser Aussage macht Maurizio Ferraris den Grundimpetus der philosophischen Strömung des neuen Realismus aus; einer „Müdigkeit gegenüber dem Postmodernismus“. Dieser hatte mit seinem Fokus auf die Konstruktionsleistungen der Sprache und den verschiedenen Diskurstheorien ab den 1960er Jahren zunehmend Eingang in die Sozial- und Kulturwissenschaften gefunden und spätestens mit Hayden Whites 1973 erschienener „Metahistory“ auch in die Geschichtswissenschaft. Analog zur philosophischen Strömung des neuen Realismus wurden auch hier bald Gegenstimmen laut, die ein neues Verhältnis zum „Faktischen“ bzw. den historischen Ereignissen forderten. Im Folgenden werde ich daher die Theorien von White und Zoltán Simon in Bezug auf dieses Verhältnis vergleichend betrachten.
Exzerpt:
Hier wirkt Whites Theorie jedoch inkonsistent. Denn indem er den eigentlichen Erkenntniswert ausschließlich in der Konstruktionsleistung des Historikers sieht, erscheint seine Theorie konstruktivistische. Um sie gegen relativistische Beliebigkeit abzudichten, postuliert er, dass die Plotstruktur den Ereignissen selbst innewohne. Auch der Erkenntniswert der Erzählung soll sich an der Kohärenz derselben zur Ereignisfolge bemessen. Hier soll also die materielle Basis der Plots gestärkt werden, was jedoch wenig überzeugt, zumal White nicht näher darauf eingeht wie eine Verankerung der Plots in der Geschichte vorgestellt wird. Die Forderung nach Kohärenz zwischen einer Vergangenheit, die ja nach White nur durch das Konstrukt der Plots entsteht und den Plots selbst wirkt widersprüchlich.
Inhaltsverzeichnis
- Ist Geschichte nur Narration? Hayden White und Zoltán Simon
- Hayden White
- Metahistory
- Narration und Plot
- Kritik an Whites Theorie
- Zoltán Simon
- Dissruptive Experience
- Integration von Erfahrung und Narration
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Theorien von Hayden White und Zoltán Simon im Kontext der Debatte über die Rolle der Narration in der Geschichtswissenschaft. Dabei wird untersucht, wie beide Autoren das Verhältnis von historischen Fakten und narrativen Strukturen verstehen und welche Implikationen ihre Ansätze für die Geschichtswissenschaft und die Geschichtsdidaktik haben.
- Die Rolle der Narration in der Geschichtswissenschaft
- Das Verhältnis von Fakten und Fiktion in historischen Erzählungen
- Der Einfluss von Sprache und Erkenntnis auf die Konstruktion historischer Narrative
- Die Bedeutung von Erfahrung für die historische Erkenntnis
- Die Auswirkungen der „narrative turn“ für die Geschichtsdidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den „narrative turn“ in der Geschichtswissenschaft und die Bedeutung von Sprache und Narration für die historische Erkenntnis beleuchtet. Anschließend werden die Theorien von Hayden White und Zoltán Simon im Detail vorgestellt und analysiert. White betrachtet die Historiographie als fiktionale Literatur und betont die Bedeutung von narrativen Strukturen für die Sinnstiftung in historischen Werken. Simon hingegen plädiert für eine Integration von Erfahrung und Narration, die zu qualitativ neuen Erkenntnissen führen soll. Der Text endet mit einer Schlussfolgerung, die die zentralen Argumente der beiden Autoren zusammenfasst und die Implikationen ihrer Ansätze für die Geschichtswissenschaft und die Geschichtsdidaktik diskutiert.
Schlüsselwörter
Narration, Geschichtswissenschaft, Geschichtsdidaktik, Hayden White, Zoltán Simon, Metahistory, „narrative turn“, historische Fakten, Erfahrung, Sprache, Erkenntnis, historische Erfahrung, ästhetische Erfahrung, Plot, emplotment, Fakten und Fiktion.
- Quote paper
- Johannes Konrad (Author), 2016, Ist Geschichte nur Narration? Hayden White und Zoltán Simon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357235