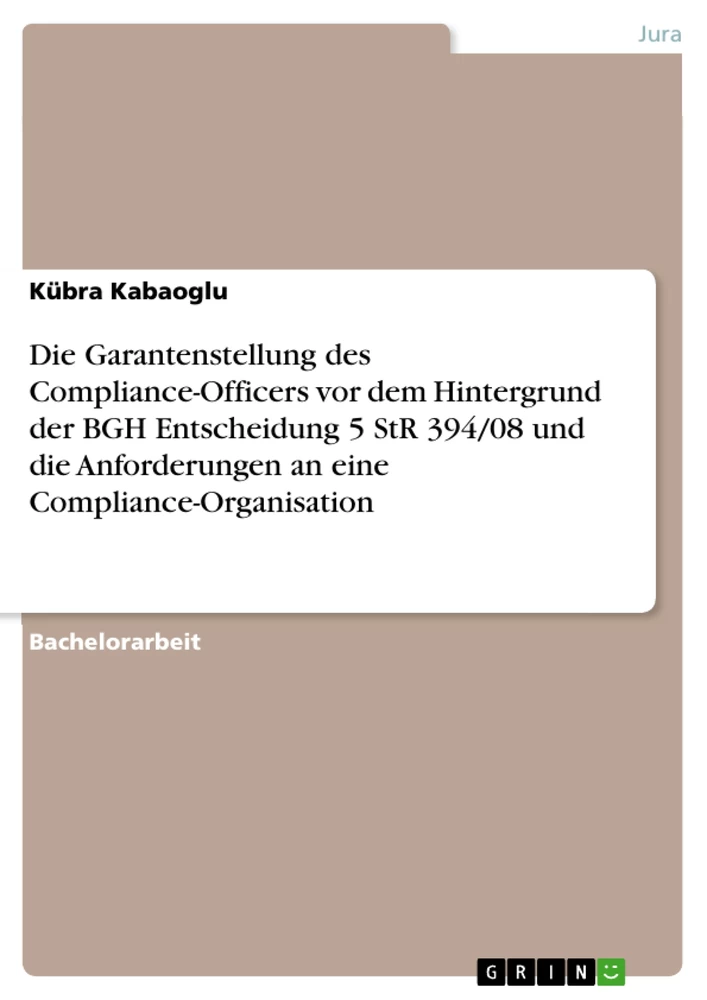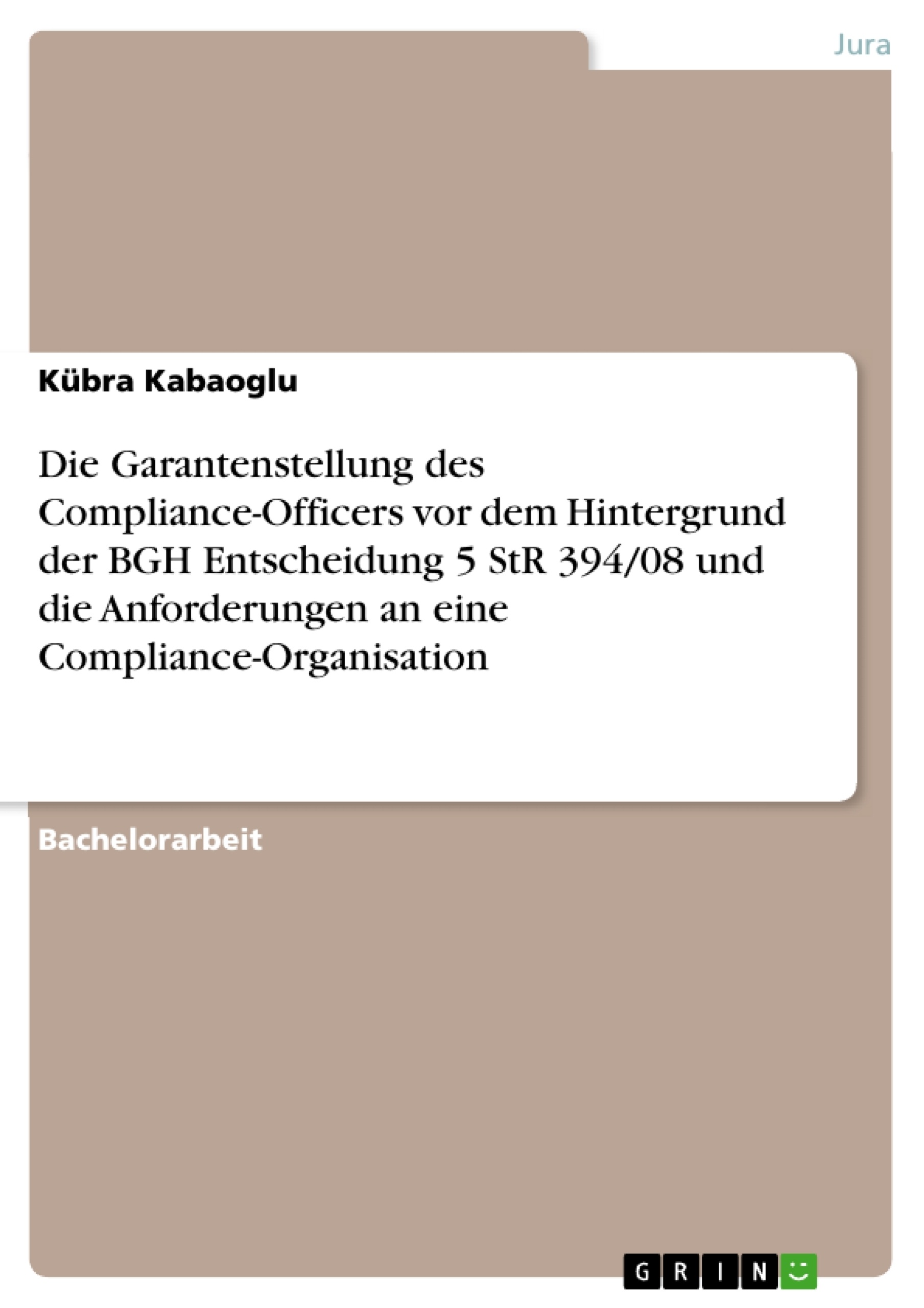Weltweit finden Rechtsverstöße von Wirtschaftsunternehmen immer größere Aufmerksamkeit. Immer wieder wird in den Medien über Wirtschaftsskandale berichtet, insbesondere über die Thematik der Wirtschaftskriminalität. Trotz eines gewissen Gestaltungsfreiraums innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen müssen Unternehmen sich im Einklang mit gesetzlichen Regelungen verhalten. In den letzten Jahren rücken die Anforderungen an eine rechtskonforme Unternehmensführung stärker in das öffentliche Bewusstsein. Sowohl national als auch international sind Wirtschaftsunternehmen Ge- und Verboten ausgesetzt, welche viele Pflichten begründen. Für die Gewährleistung einer rechtskonformen sowie sachgerechten Unternehmensführung wird von den Lenkungs- und Aufsichtsorganen eines Unternehmens die Etablierung einer „Corporate Compliance“ – Organisation verlangt, in der ein Compliance-Officer (CO) als Kontrollorgan agiert. Der Ausdruck „Corporate Compliance“ wird meistens in unternehmensbezogenen Zusammenhängen verwendet, da hier nur von solchen Sachverhalten die Rede ist, wird auf diese Bezeichnung verzichtet.
In erster Linie dient Compliance der Haftungs- und Strafvermeidung für das Unternehmen und seiner Organe. In Deutschland sind entsprechende Regelungen u.a. in § 33 WpHG und § 25a KWG verankert. Die Grundsätze im deutschen Corporate Governance Codex sind hingegen keine rechtsverbindlichen Handlungsanweisungen, sie haben lediglich nur einen Empfehlungscharakter. Um den Rechtsverstößen bzw. auch dem Potenzial einer Strafbarkeit im Unternehmen entgegenzuwirken, hat die Europäische Union (EU) mit der Finanzmarktrichtlinie MiFID eine gesetzliche Anforderung für eine Compliance Organisation aufgestellt. Im Laufe der Untersuchung erfolgt eine genauere Aufführung der spezifischen Rechtsgrundlagen für die Implementierung von Compliance-Systemen im Unternehmen und über die Position des Compliance-Officers.
Die besondere Eigenschaft eines Compliance-Systems ist das Aufgabenspektrum des COs, dieses umfasst „die Verhinderung von Rechtsverstößen, insbesondere von Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus begangenen werden und diesem erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken oder Ansehensverlust bringen können.“ Nach deutscher Rechtswissenschaft kann der CO aufgrund seines Fehlverhaltens im Unternehmen, als Täter oder Teilnehmer für strafrechtliche Folgen verantwortlich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Zielsetzung der Untersuchung
- II. Gang und Aufbau der Untersuchung
- B. Der Compliance-Officer
- I. Compliance im Allgemeinen
- 1. Historische Entwicklung in den USA und in Deutschland
- 2. Der Compliance-Begriff
- 3. Compliance-Funktionen
- 4. Rechtliche Grundlagen der Compliance
- II. Die Compliance-Organisationspflicht und ihre Rahmenbedingungen
- 1. Geschäftsverteilung
- 2. Delegationsmöglichkeiten
- 3. Stellung des COs im Unternehmen
- 4. Funktion und Aufgaben eines CO
- 5. Abgrenzung zum Unternehmensbeauftragten
- I. Compliance im Allgemeinen
- C. Die Garantenstellung des Compliance-Officers
- I. Unterlassensstrafbarkeit des COs
- II. Voraussetzungen der Unterlassensstrafbarkeit gem. § 13 StGB
- 1. Regelungsbereich
- 2. Die Begehungsform - Tun oder Unterlassen?
- 3. Strafbarkeit des Unterlassens
- 4. Möglichkeit und Zumutbarkeit der Erfolgsverhinderung
- 5. Entsprechungsklausel
- III. Die Garantenstellung des CO
- 1. Kritik und Meinungsstand in der Literatur
- 2. Garantenstellung aus Gesetz
- 3. Garantenstellung des COs aus Ingerenz
- 4. Garantenstellung des COs aus Herrschaft für Untergebene
- 5. Garantenstellung des COs aus Herrschaft über bestimmte Gefahrenquellen
- 6. Aufsichtsgarantenstellung des CO
- 7. Garantenstellung des COs aus Geschäftsherrenhaftung
- 8. Garantenstellung des COs aus freiwilliger Pflichtenübernahme
- a) Reichweite der Garantenstellung
- b) Vorrangige Haftung der Unternehmensleitung
- c) Restriktive Auslegung des § 13 StGB
- d) Umfang und Grenzen der Erfolgsabwendungspflicht
- IV. Wegfall der Garantenstellung des COs
- 1. Hinzutreten der Geschäftsleitung
- 2. Informationsmangel/Defizite beim CO
- V. Kausalität und Zurechnung
- 1. Kausalität
- 2. Zurechnung
- VI. Vorsätzliches und fahrlässiges Unterlassen
- D. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der strafrechtlichen Garantenstellung des Compliance-Officers. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Compliance-Organisationspflicht sowie die daraus resultierenden Haftungsrisiken für den CO.
- Rechtliche Grundlagen der Compliance
- Die Compliance-Organisationspflicht und ihre Rahmenbedingungen
- Die strafrechtliche Garantenstellung des Compliance-Officers
- Haftungsrisiken des COs im Strafrecht
- Abgrenzung der Garantenstellung des COs von anderen Akteuren im Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Untersuchung dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Compliance-Officer und seinen Aufgaben, einschließlich der rechtlichen Grundlagen der Compliance. Kapitel C analysiert die strafrechtliche Garantenstellung des Compliance-Officers, wobei insbesondere die Unterlassensstrafbarkeit und die verschiedenen Garantenstellungen im Strafrecht untersucht werden. Die Arbeit endet mit einem Schlusswort, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Compliance, Compliance-Officer, Garantenstellung, Unterlassensstrafbarkeit, Strafrecht, Unternehmen, Organisationspflicht, Haftung, Risikomanagement, Rechtsgrundlagen.
- Quote paper
- Kübra Kabaoglu (Author), 2017, Die Garantenstellung des Compliance-Officers vor dem Hintergrund der BGH Entscheidung 5 StR 394/08 und die Anforderungen an eine Compliance-Organisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356881