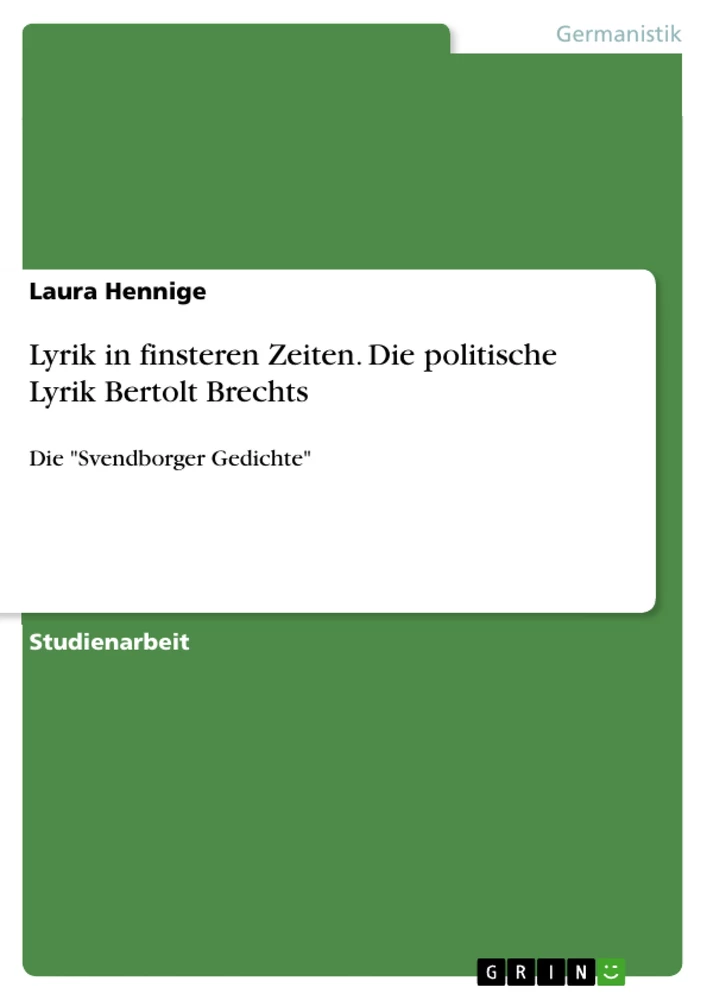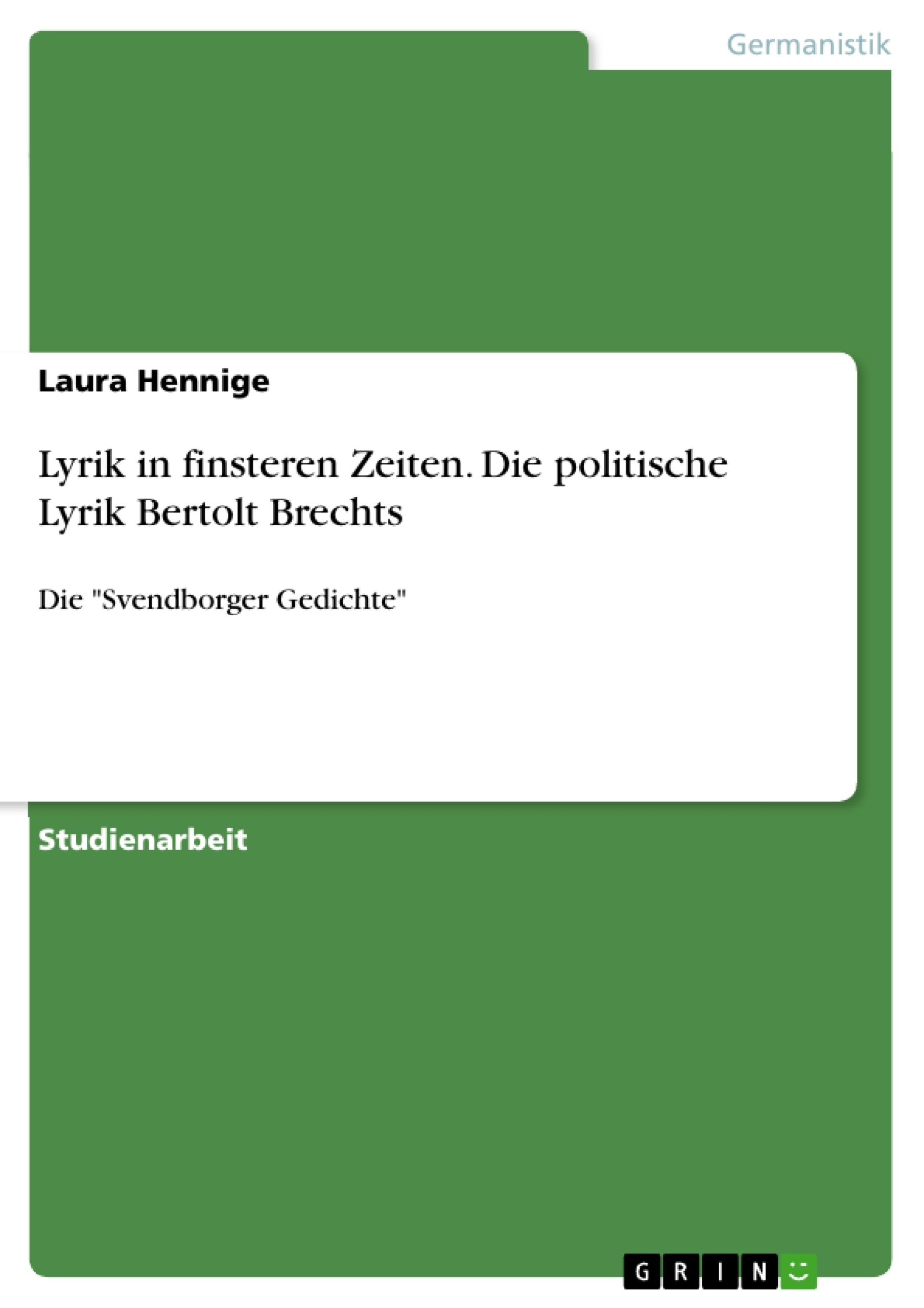Bertolt Brecht nimmt im Zuge des Zweiten Weltkrieges eine ganz besondere Rolle als Autor ein. Er stellt sich auf die Bedürfnisse der Zeit ein und passt seine Lyrik den Gegebenheiten an. Er wird in diesem Zusammenhang zum Vertreter der Bürgerlichen und hat deshalb eine wichtige Rolle und große Verantwortung. Schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges befindet Brecht sich im Exil in Dänemark und deutet bereits im eingehenden Motto der Svendborger Gedichte an, dass er nicht vor hat, schweigend auszuharren, sondern den Menschen, so gut er kann und mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, beistehen wird.
Die Zeit im Exil war für viele Schriftsteller eine sehr produktive, aber auch ernüchternde Zeit, da sie nicht wussten, ob ihre Werke jemals veröffentlicht werden. Das ist für Autoren, die ihre Verantwortung in der Gesellschaft ernst nehmen und eine Botschaft vermitteln möchten, sehr
schwierig. Brecht verwendet deshalb eine ganz besondere Art von Lyrik, die nicht nur schön sein soll, sondern auch realistisch. Es geht um politische Lyrik, die eine Botschaft an die Menschen sendet und die Welt so darstellt, wie sie ist.
Autoren, die nicht in Deutschland geblieben sind, wie beispielsweise auch Thomas Mann, hatten die Möglichkeit, freier zu schreiben und verarbeiten oft die unterschiedlichsten Gefühle in ihren Werken. Zum einen das schlechte Gewissen, die Heimat verlassen zu haben, zum anderen das Bedürfnis, eben diese Rolle zu nutzen und die Menschen über die politische Situation aufzuklären. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Brechts politische Lyrik
- Die Svendborger Gedichte
- Der Aufbau der Svendborger Gedichte
- Die Mottos der Gedichte
- Form, Symboliken und Wirkungsweise
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Bertolt Brechts politischer Lyrik im Exil, insbesondere mit den „Svendborger Gedichten“. Ziel ist es, die Besonderheiten von Brechts Lyrik in dieser Zeit zu untersuchen und aufzuzeigen, wie er sich den politischen Gegebenheiten anpasst. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Lyrik im Exil, die Themen, die Brecht beschäftigen, und die Botschaft, die er nach Deutschland vermitteln möchte.
- Die Entwicklung von Brechts politischer Lyrik im Exil
- Die Rolle der Lyrik als Mittel des Widerstands und der Aufklärung
- Die Themen und Motive in den „Svendborger Gedichten“
- Die Verwendung von Form und Symbolen in Brechts Lyrik
- Die Wirkung von Brechts Lyrik auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Bertolt Brecht als Autor im Kontext des Zweiten Weltkriegs vor und beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die sich für Schriftsteller im Exil stellten. Die Einleitung führt in die „Svendborger Gedichte“ ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit.
Das zweite Kapitel analysiert die Besonderheiten von Brechts politischer Lyrik. Es wird untersucht, wie Brecht die Lyrik als Mittel des politischen Engagements und der gesellschaftlichen Kritik nutzt. Die Kapitel beleuchtet Brechts Intention, das Klassenbewusstsein zu stärken und die Menschen zu einem aktiven Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse zu motivieren.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den „Svendborger Gedichten“. Es wird der Aufbau der Gedichte, die Verwendung von Mottos und die unterschiedlichen Formen und Symboliken untersucht. Die Kapitel beleuchtet die Wirkung der Gedichte auf die damalige und die heutige Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, politische Lyrik, Exil, Svendborger Gedichte, Widerstand, Klassenbewusstsein, Symbolismus, Wirkung, Gesellschaft.
- Quote paper
- Laura Hennige (Author), 2014, Lyrik in finsteren Zeiten. Die politische Lyrik Bertolt Brechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356450