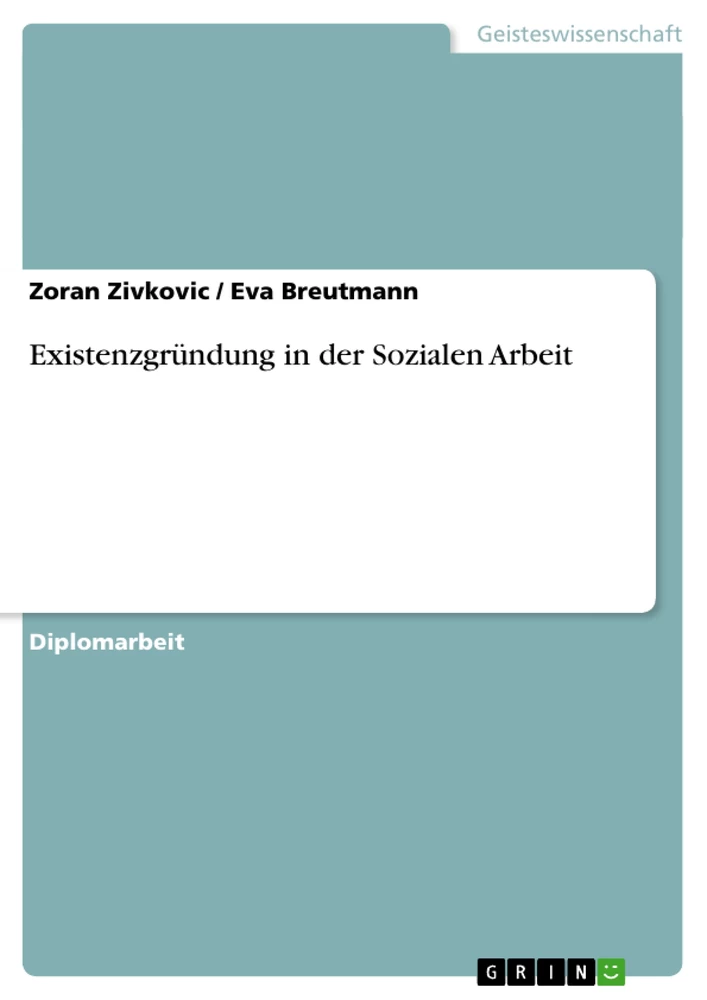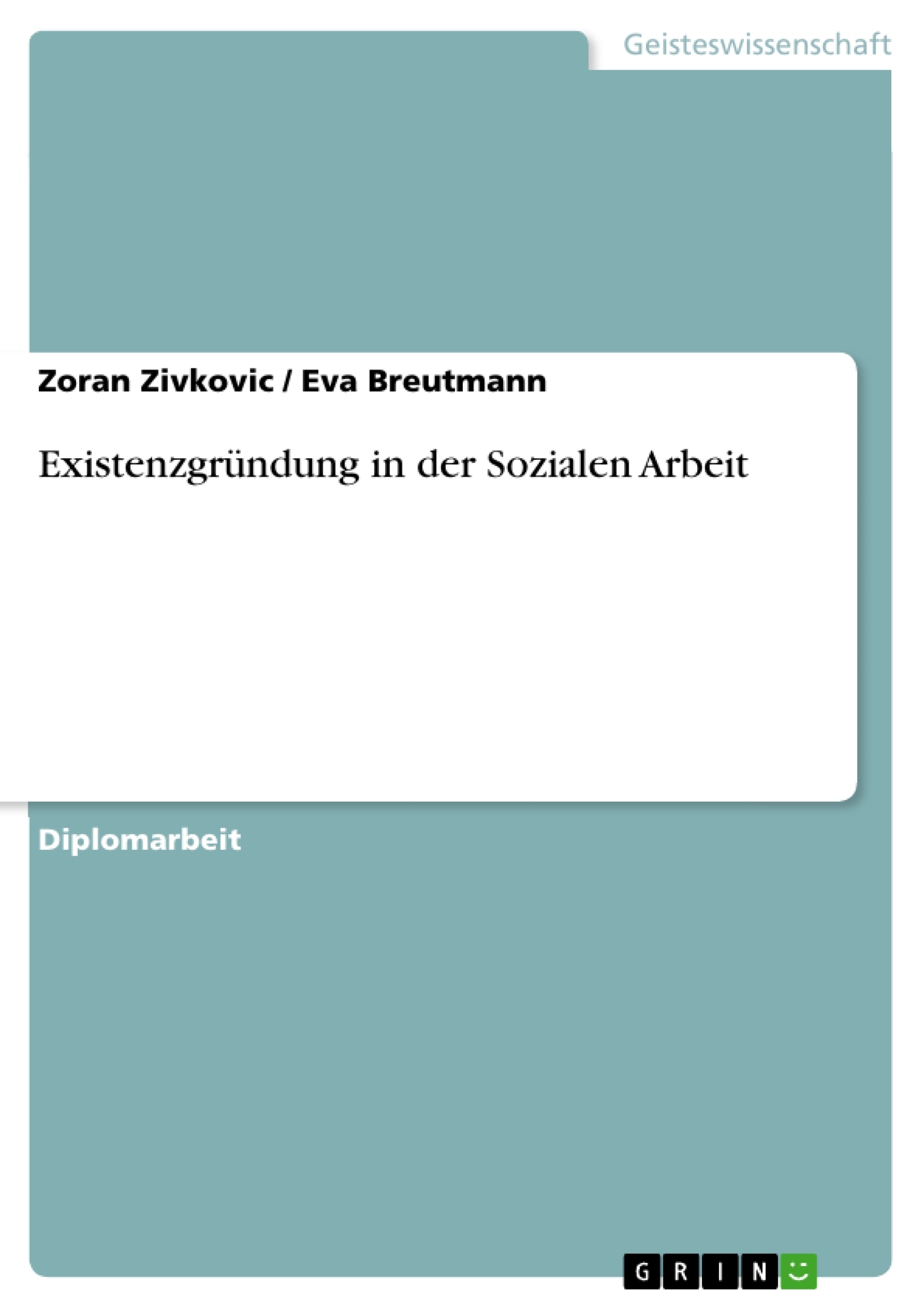1. Einleitung
Der Abschluß eines Hochschulstudiums ist in der Regel nicht mit einer Ausbildung für einen konkreten Beruf zu vergleichen. Allein durch das erfolgreiche Beschließen des Studiums ist für einen Akademiker die Frage nach dem Beruf noch nicht zwingend beantwortet. Je nach Fachrichtung ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, beruflich tätig zu werden. So auch in der Sozialen Arbeit. Sicherlich gibt es typische Berufsbilder. Studenten der Sozialen Arbeit absolvieren im allgemeinen ihr Studium mit der Vorstellung, später bei staatlichen oder kirchlichen Trägern tätig zu werden, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Allerdings ergaben sich diesbezüglich aufgrund politischer und wirtschaftlicher Hintergründe, in den letzten Jahren Veränderungen. Durch Kürzungen von öffentlichen Budgets sind die Beschäftigungszahlen im öffentlichen Dienst gesunken. Darüber hinaus sind demographische und soziokulturelle Veränderungen maßgebliche Gründe für das Entstehen von neuen Problemfeldern. Somit ist die Soziale Arbeit mit einer steigenden Arbeitslosenquote konfrontiert. Andererseits haben sich durch strukturelle Veränderungen neue Arbeitsfelder ergeben. Unter den aufgeführten Umständen ist die in der sozialpolitischen Disskussion erhobene Forderung nach einer Privatisierung der sozialen Dienste durchaus nachvollziehbar.
Selbständigkeit wird heute mehr denn je als eine berufliche Alternative angesehen. Trotzdem liegt der Anteil der Selbständigen in Deutschland - im internationalen Vergleich – in der unteren Hälfte. Doch der Trend zur beruflichen Selbständigkeit nimmt deutlich zu. „Allein 1997 entstanden in Deutschland rund 670 000 neue Unternehmungen.“1
Diese steigende Attraktivität ist unter anderem auf wirtschaftliche Fördermittel, von Seiten des Staates zurückzuführen, die in Form von steuerlichen Hilfen, öffentlichen Bürgschaften, zinsgünstigen Dahrlehen etc. gewährleistet werden.
Daneben wird durch Fortbildungen und einer steigenden Anzahl von Projekten zur Förderung der Existenzgründung2 die Selbständigkeit in der Öffentlichkeit thematisiert.
Auch in der Sozialen Arbeit hat sich die Zahl der Selbständigen erhöht. Obwohl diese Möglichkeit vor wenigen Jahren noch nicht zur Disskussion stand, wird der Anteil der Selbständigen unter Sozialpädagogen mittlerweile auf 6% geschätzt. Ca. 10 000 Sozialarbeiter sind zumindest nebenberuflich selbständig.3 An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob die Soziale Arbeit den freien Berufen zugeordnet werden [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Demographische Analyse und die daraus resultierenden Möglichkeiten für die berufliche Selbständigkeit in der Sozialen Arbeit
- 2.1. Demographische Entwicklung in Deutschland
- 2.1.1. Altersstruktur
- 2.1.2. Zuwanderung
- 2.2. Haushalts- und Familienstruktur
- 2.3. Entwicklung der Problembereiche
- 2.3.1. Pflegebedürftigkeit
- 2.3.2. Senioren als neue Zielgruppe
- 2.3.3. Alleinerziehende als Bedarfsgruppe
- 2.3.4. Integration ethnischer Gruppen
- 2.3.5. Betriebliche Sozialarbeit
- 2.1. Demographische Entwicklung in Deutschland
- 3. Politisch-rechtliche Grundlagen und Zukunftsperspektiven
- 3.1. Politisch-rechtliche Grundlagen
- 3.1.1. Unterstützung durch den Staat
- 3.1.1.1. Finanzielle Hilfen
- 3.1.1.2. Projekte
- 3.1.2. Rechtliche Grundlagen
- 3.1.2.1. Freie Berufe
- 3.1.2.2. Gewerbe
- 3.1.2.3. Buchführungspflicht
- 3.1.2.4. Exkurs: Buchführung
- 3.1.2.5. Steuern
- 3.1.2.6. Scheinselbständigkeit
- 3.1.1. Unterstützung durch den Staat
- 3.2. Politisch-rechtliche Zukunftsperspektiven
- 3.1. Politisch-rechtliche Grundlagen
- 4. Sozialpädagogisches Denken und unternehmerisches Handeln
- 5. Besonderheiten bei der Existenzgründung in der sozialen Dienstleistungslandschaft
- 5.1. Schwierigkeiten bei der „sozialpädagogischen Gründung“
- 5.2. Frauen als Existenzgründerinnen
- 6. Persönlichkeits- und Qualifikationsprofil des Gründers
- 6.1. Das Qualifikationsprofil von Diplomsozialpädagogen
- 6.1.1. Qualifikation aufgrund des Studiengangs
- 6.1.2. Branchenexterne Qualifikation
- 6.2. Das Persönlichkeitsprofil des Existenzgründers
- 6.2.1. Persönliche Motive für eine Existenzgründung
- 6.2.1.1. Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
- 6.2.1.2. Wirtschaftliche Unabhängigkeit
- 6.2.2. Persönliche Eignung
- 6.2.3. Persönlichkeitstest
- 6.2.1. Persönliche Motive für eine Existenzgründung
- 6.1. Das Qualifikationsprofil von Diplomsozialpädagogen
- 7. Planungsüberlegung
- 7.1. Die Idee
- 7.1.1. Ideenfindung durch Brainstorming
- 7.1.2. Profitieren aus bereits vorhandenen Geschäftsideen
- 7.1.3. Beobachtung des Marktes
- 7.1.4. Selbständige Marktforschung
- 7.2. Die Positionierung im Marktsegment
- 7.2.1. Einschätzung des Absatzmarkts
- 7.2.1.1. Bestimmung der Zielgruppe
- 7.2.1.2. Bedürfnisse der Zielgruppe
- 7.2.2. Die Analyse des Wettbewerbs unter den sozialen Anbietern
- 7.2.2.1. Anbieter sozialer Dienstleistungen
- 7.2.2.2. Quellen für die Konkurrenzanalyse
- 7.2.1. Einschätzung des Absatzmarkts
- 7.3. Zukunftsperspektiven: Die Aussichten des Marktes erkunden
- 7.3.1. Markttrends beobachten
- 7.3.2. Visionen entwickeln
- 7.3.3. Kulturveränderung
- 7.4. Kostenrechung und Finanzierung
- 7.4.1. Wirtschaftlichkeit definieren: Erfolgsrechnung
- 7.4.2. Kapitalbedarf berechnen: Investitions- und Kostenplanung
- 7.4.2.1. Der Investitionsplan
- 7.4.2.2. Fehler bei der Finanzierung
- 7.4.3. Finanzierung sichern: Finanzierungsplanung
- 7.4.3.1. Das Eigenkapital
- 7.4.3.2. Das Fremdkapital
- 7.4.3.2.1. Finanzierungshilfen
- 7.4.3.2.2. Das Bankgespräch
- 7.4.3.3. Förderprogramme und Fördermittel
- 7.1. Die Idee
- 8. Risikovorsorge
- 8.1. Betriebliche Risikovorsorge
- 8.2. Private Risikovorsorge
- 8.2.1. Krankenversicherung
- 8.2.2. Rentenversicherung
- 8.2.3. Unfallversicherung
- 8.2.4. Lebensversicherung
- 8.2.4. Arbeitslosenversicherung
- 8.2.5. Pflegeversicherung
- 9. Die Entwicklung eines Unternehmenskonzeptes
- 9.1. Der Sinn eines Unternehmenskonzeptes
- 9.2. Die Merkmale eines erfolgreichen Unternehmenskonzeptes
- 9.3. Betrachtungsweise der Investoren
- 9.4. Tips zur Erstellung eines Unternehmenskonzeptes
- 10. Die Struktur und Hauptelemente eines Unternehmenskonzeptes
- 10.1. Beschreibung der Gründungsidee
- 10.2. Besonderheit des geplanten Unternehmensinhalts
- 10.3. Angaben zur Gründerperson
- 10.4. Das Marketingkonzept
- 10.4.1. Marketing - eine kurze Einführung
- 10.4.2. Der Wandel vom Marketing zum Social Marketing
- 10.4.3. Begriffsdefinition: Social Marketing
- 10.4.4. Die Bedeutung des Marketing im unternehmerischen Entscheidungsprozeß
- 10.4.5. Die Marketingplanung
- 10.4.5.1. Begriffsabgrenzung von Marketingplanung und Marketingplan
- 10.4.5.2. Die Marketingplanung, Prozesse und Ziele
- 10.4.5.3. Die Inhalte eines Marketingplanes
- 10.4.5.3.1. Die Stärken-Schwäche-Analyse
- 10.4.5.3.2. Die Umweltanalyse
- 10.4.5.3.3. Die Marktanalyse
- 10.4.5.3.4. Die Branchenanalyse
- 10.4.5.3.5. Die Konkurrenzanalyse
- 10.4.5.3.6. Strategische Schlüsselfaktoren
- 10.4.5.3.7. Strategieentwicklung und Strategieumsetzung
- 10.4.5.3.8. Der Marketingmix
- 10.4.5.3.8.1. Die Produktpolitik
- 10.4.5.3.8.2. Die Distributionspolitik
- 10.4.5.3.8.3. Die Kommunikationspolitik
- 10.4.5.3.8.3.1. Werbung
- 10.4.5.3.8.3.2. Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit)
- 10.4.5.3.8.3.3. Sales Promotion (Absatz- oder Verkaufsförderung)
- 10.4.5.3.8.3.4. Persönlicher Verkauf
- 10.4.5.3.8.3.5. Sponsoring
- 10.4.5.3.8.3.6. Direct Marketing (Direktmarketing)
- 10.4.5.3.8.3.7. Eventmarketing
- 10.4.5.3.8.3.8. Kommunikationsmix (integrierte Kommunikation)
- 10.4.5.3.8.4. Die Preispolitik
- 10.5. Das Finanzierungskonzept
- 11. Rechtsformen
- 11.1. Entscheidungshilfen
- 11.2. Das Einzelunternehmen und die stille Gesellschaft
- 11.3. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
- 11.4. Die Offene Handelsgesellschaft (OHG)
- 11.5. Die Partnergesellschaft (PartnG)
- 11.6. Die Kommanditgesellschaft (KG)
- 11.7. Die GmbH (AG) & Co. KG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten der Existenzgründung im Bereich der Sozialen Arbeit. Sie analysiert demografische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Dienstleistungen. Darüber hinaus werden die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet und die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung im sozialen Sektor betrachtet.
- Demografischer Wandel und Bedarf an sozialen Dienstleistungen
- Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der Existenzgründung in der Sozialen Arbeit
- Persönlichkeits- und Qualifikationsprofil erfolgreicher Gründer
- Entwicklung eines tragfähigen Unternehmenskonzeptes
- Finanzierung und Risikovorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Existenzgründung in der Sozialen Arbeit ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Demographische Analyse und die daraus resultierenden Möglichkeiten für die berufliche Selbständigkeit in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die demografische Entwicklung in Deutschland, insbesondere die Alterung der Bevölkerung, Zuwanderung und Veränderungen der Haushaltsstrukturen. Es zeigt auf, wie diese Entwicklungen zu neuen Herausforderungen und gleichzeitig zu neuen Chancen für die Soziale Arbeit und die Existenzgründung führen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung neuer Zielgruppen (Senioren, Alleinerziehende, Migranten) und den damit verbundenen Bedarfen an sozialen Dienstleistungen, sowie auf dem Potenzial für die Gründung von Unternehmen in diesem Bereich. Beispiele für neue Dienstleistungen werden angedeutet, ohne konkret zu werden.
3. Politisch-rechtliche Grundlagen und Zukunftsperspektiven: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für Existenzgründungen in der Sozialen Arbeit in Deutschland. Es untersucht die staatliche Unterstützung durch finanzielle Hilfen und Förderprogramme sowie die rechtlichen Grundlagen für verschiedene Unternehmensformen (freiberufliche Tätigkeit, Gewerbe), Buchführungspflichten, Steuern und das Problem der Scheinselbständigkeit. Die Analyse schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Perspektiven ab.
4. Sozialpädagogisches Denken und unternehmerisches Handeln: Dieses Kapitel behandelt die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Verbindung von sozialpädagogischem Denken und unternehmerischem Handeln ergeben. Es diskutiert die Sonderstellung sozialer Dienstleistungen im Markt und die damit verbundenen ethischen Fragen. Es wird dargestellt, wie sozialpädagogische Kompetenzen mit unternehmerischen Fähigkeiten verbunden werden können, um eine erfolgreiche und verantwortungsvolle Existenzgründung zu gewährleisten.
5. Besonderheiten bei der Existenzgründung in der sozialen Dienstleistungslandschaft: Dieses Kapitel beschreibt die besonderen Schwierigkeiten bei der Gründung von sozialpädagogischen Unternehmen. Es werden typische Hürden beleuchtet, beispielsweise Schwierigkeiten bei der Akquise von Aufträgen, der Preisfindung und des Umgangs mit komplexen bürokratischen Verfahren. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der Rolle von Frauen als Existenzgründerinnen in diesem Bereich, einschliesslich der Herausforderungen und Chancen. Es werden Beispiele für erfolgreiche und weniger erfolgreiche Gründungen, sowie Strategien zum Umgang mit Schwierigkeiten erläutert.
6. Persönlichkeits- und Qualifikationsprofil des Gründers: Dieses Kapitel untersucht die notwendigen persönlichen und fachlichen Qualifikationen für eine erfolgreiche Existenzgründung in der Sozialen Arbeit. Es wird das Qualifikationsprofil von Diplomsozialpädagogen analysiert, sowohl hinsichtlich der im Studium erworbenen Kompetenzen als auch zusätzlicher, branchenexterner Qualifikationen. Weiterhin werden relevante Persönlichkeitseigenschaften und Motivationsfaktoren beleuchtet, die zum Erfolg beitragen. Es wird ein Zusammenhang zwischen persönlichen Eigenschaften und Gründungserfolg hergestellt.
7. Planungsüberlegung: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten Planung einer Existenzgründung. Es werden Methoden zur Ideenfindung und Marktforschung vorgestellt, die Analyse des Absatzmarktes und des Wettbewerbs beschrieben und Strategien zur Positionierung im Marktsegment erläutert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kosten- und Finanzierungsplanung, inklusive der Berechnung des Kapitalbedarfs, der Sicherung der Finanzierung und des Umgangs mit möglichen Fehlern. Es werden Beispiele für Finanzierungsmodelle, Förderprogramme und die Bedeutung von Bankgesprächen diskutiert.
8. Risikovorsorge: Dieses Kapitel widmet sich der wichtigen Thematik der Risikovorsorge sowohl für den Betrieb als auch für die Gründerpersönlichkeit. Es werden verschiedene Versicherungen (Kranken-, Renten-, Unfall-, Lebens- und Pflegeversicherung) und Strategien zur Absicherung vor betrieblichen Risiken beleuchtet. Der Text zeigt die Notwendigkeit einer umfassenden Risikovorsorge zur langfristigen Sicherung des unternehmerischen Erfolgs auf.
9. Die Entwicklung eines Unternehmenskonzeptes: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung eines umfassenden Unternehmenskonzeptes. Es werden die Bedeutung und die Merkmale eines erfolgreichen Konzepts erläutert, sowie der Blickwinkel potenzieller Investoren auf das Konzept beleuchtet. Es folgen praktische Tipps zur Erstellung eines überzeugenden und tragfähigen Unternehmenskonzeptes.
10. Die Struktur und Hauptelemente eines Unternehmenskonzeptes: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und die wichtigsten Bestandteile eines vollständigen Unternehmenskonzeptes. Es werden die Beschreibung der Gründungsidee, die Angaben zur Gründerperson, das Marketingkonzept (inklusive einer Einführung in Social Marketing und Marketingplanung mit den verschiedenen Analysemethoden und dem Marketing-Mix) und das Finanzierungskonzept detailliert erklärt. Das Kapitel bietet eine umfassende Anleitung zur Erstellung aller relevanten Teile eines solchen Konzeptes.
11. Rechtsformen: Das Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Rechtsformen für Unternehmen, unterstützt die Entscheidungsfindung und erläutert die Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen (Einzelunternehmen, GbR, OHG, PartnG, KG, GmbH & Co. KG).
Schlüsselwörter
Existenzgründung, Soziale Arbeit, Demografie, Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, Unternehmenskonzept, Marketing, Finanzierung, Risikovorsorge, Sozialpädagogik, Qualifikation, Persönlichkeitsprofil, Deutschland.
FAQ: Existenzgründung in der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten der Existenzgründung im Bereich der Sozialen Arbeit. Sie analysiert demografische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Dienstleistungen, beleuchtet die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen und betrachtet die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung im sozialen Sektor. Der Inhalt umfasst eine umfassende Spracheinsicht mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen.
Welche demografischen Entwicklungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die demografische Entwicklung in Deutschland, insbesondere die Alterung der Bevölkerung, Zuwanderung und Veränderungen der Haushaltsstrukturen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung neuer Zielgruppen (Senioren, Alleinerziehende, Migranten) und den damit verbundenen Bedarfen an sozialen Dienstleistungen.
Welche politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für Existenzgründungen in der Sozialen Arbeit. Dies beinhaltet staatliche Unterstützung (finanzielle Hilfen, Förderprogramme), rechtliche Grundlagen für verschiedene Unternehmensformen (freiberufliche Tätigkeit, Gewerbe), Buchführungspflichten, Steuern und das Problem der Scheinselbständigkeit.
Welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das Qualifikationsprofil von Diplomsozialpädagogen (Studium und branchenexterne Qualifikationen) und relevante Persönlichkeitseigenschaften sowie Motivationsfaktoren für eine erfolgreiche Gründung. Es wird ein Zusammenhang zwischen persönlichen Eigenschaften und Gründungserfolg hergestellt.
Wie wird die Planung einer Existenzgründung behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Planung einer Existenzgründung: Methoden zur Ideenfindung und Marktforschung, Analyse des Absatzmarktes und des Wettbewerbs, Strategien zur Marktpositionierung, Kosten- und Finanzierungsplanung (Kapitalbedarf, Finanzierungssicherung, Umgang mit Fehlern), Beispiele für Finanzierungsmodelle und Förderprogramme.
Wie wird die Risikovorsorge behandelt?
Die Arbeit widmet sich der Risikovorsorge für den Betrieb und die Gründerpersönlichkeit. Es werden verschiedene Versicherungen (Kranken-, Renten-, Unfall-, Lebens- und Pflegeversicherung) und Strategien zur Absicherung vor betrieblichen Risiken beleuchtet.
Wie wird die Entwicklung eines Unternehmenskonzeptes behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung eines umfassenden Unternehmenskonzeptes: Bedeutung und Merkmale eines erfolgreichen Konzepts, Blickwinkel potenzieller Investoren, praktische Tipps zur Erstellung eines tragfähigen Konzepts, Struktur und Bestandteile eines vollständigen Unternehmenskonzeptes (Gründungsidee, Gründerperson, Marketingkonzept inklusive Social Marketing und Marketingplanung, Finanzierungskonzept).
Welche Rechtsformen werden behandelt?
Die Arbeit bietet einen Überblick über verschiedene Rechtsformen für Unternehmen (Einzelunternehmen, GbR, OHG, PartnG, KG, GmbH & Co. KG), unterstützt die Entscheidungsfindung und erläutert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rechtsformen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für jedes Kapitel (1-11), die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfassen.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Schlüsselwörter sind: Existenzgründung, Soziale Arbeit, Demografie, Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, Unternehmenskonzept, Marketing, Finanzierung, Risikovorsorge, Sozialpädagogik, Qualifikation, Persönlichkeitsprofil, Deutschland.
- Quote paper
- Zoran Zivkovic (Author), Eva Breutmann (Author), 2000, Existenzgründung in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35643