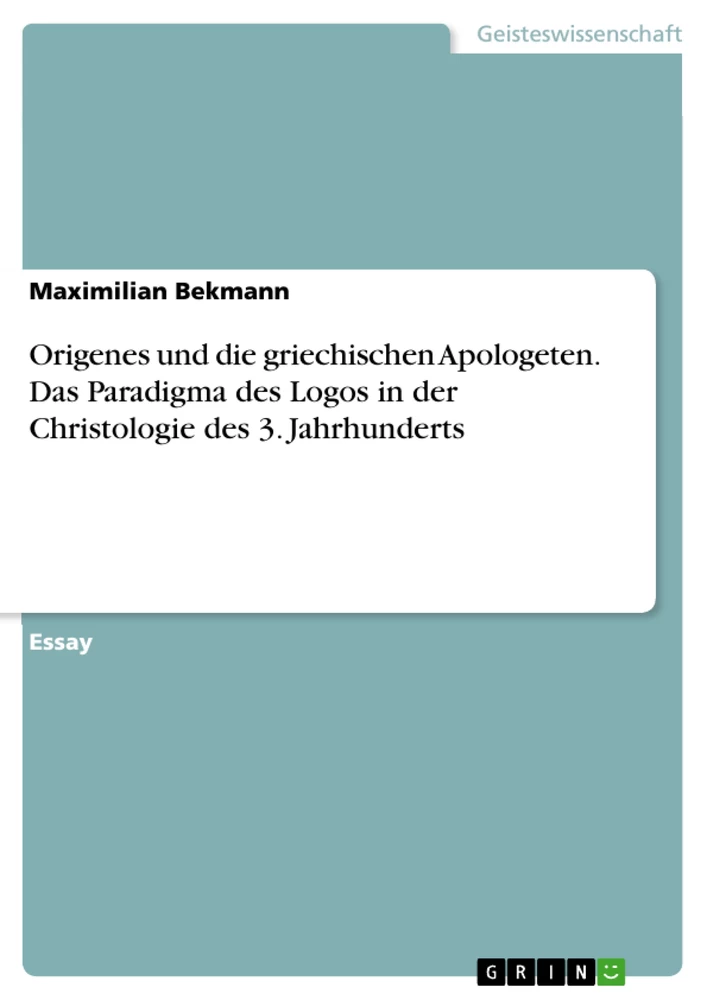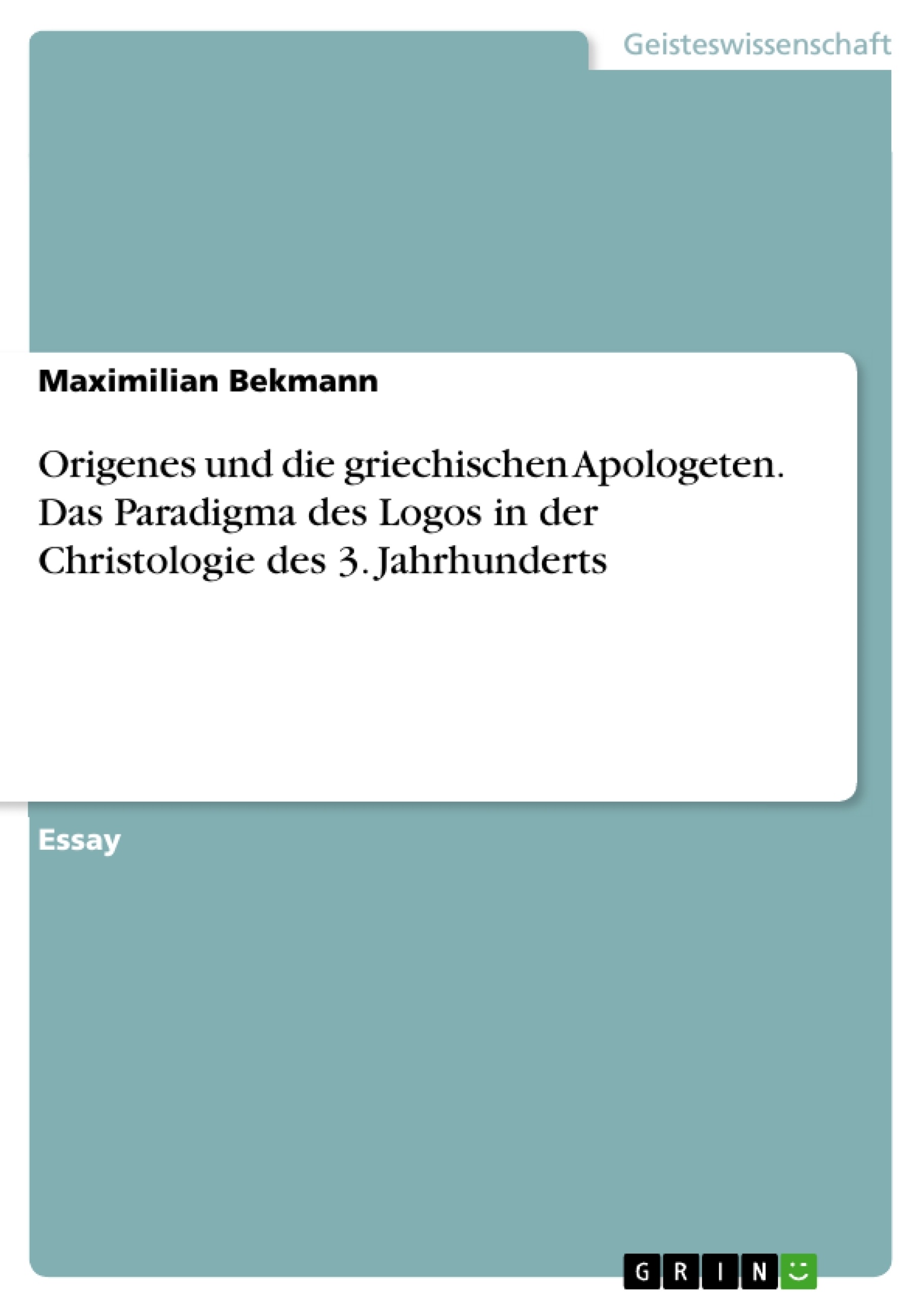Der Essay handelt über die Begriffsentfaltung des aus der griechischen Philosophie stammenden Logos-Gedanken in die frühe christliche Theologie.
Die Geschichte des frühen Christentums zeigt auf, dass für die Verbreitung des Glaubens in die ganze Welt hinein die Heidenmission des Paulus von entscheidender Bedeutung war. Erst über diesen Weg konnte sich das Christentum aus einer innerjüdischen Gruppierung heraus zu einer selbstständigen Glaubensrichtung emanzipieren. Diese Entwicklung musste folglich mit einer Inkulturation des christlichen Kerygmas in das Denken der antiken, hellenistischen Umwelt einhergehen. Obwohl die frühe Kirche immer wieder Abgrenzungen, Ausgrenzungen und Verfolgungen unterlag, bemisst sich der Erfolg dieser Lehre wohl vor allem darin, dass es sich bei ihr um einen die Menschen liebenden und ihnen verzeihenden Vater-Gott handelt. Die Forderung der Nächstenliebe war nicht auf bestimmte Angehörige eines bestimmten Volksstammes oder einer Klasse gerichtet, sondern bezog sich allgemein auf alle Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Logos als Bindeglied von hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben
- Das erste systematische Modell einer wissenschaftlichen Theologie bei Origenes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Paradigma des Logos in der Christologie des dritten Jahrhunderts, insbesondere bei Origenes und den griechischen Apologeten. Sie analysiert die Synthese hellenistischer Philosophie und christlicher Glaubenslehre im Kontext der Heidenmission und der Entwicklung der christlichen Theologie.
- Die Rolle des Logos in der frühchristlichen Apologetik
- Die Synthese von griechischer Philosophie und christlicher Theologie
- Die Christologie des Origenes und ihre neuplatonischen Einflüsse
- Die Inkarnation des Logos und die Heilslehre
- Der Leib-Seele-Dualismus bei Origenes
Zusammenfassung der Kapitel
Der Logos als Bindeglied von hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Logos als Brücke zwischen hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben. Es analysiert die Verwendung des Begriffs in der Philosophie Platons und Aristoteles und im Johannesevangelium, wobei die Präexistenz und Mittlerrolle des Logos hervorgehoben werden. Die unterschiedlichen Interpretationen der Logostheologie und deren Bedeutung für die Abgrenzung von gegensätzlichen Glaubensrichtungen werden diskutiert. Justin der Märtyrer wird als erster vorgestellt, der versucht, die johanneische Logostheologie mit dem hellenistisch-philosophischen Terminus zu synthetisieren, indem er von "logoi spermatikoi" spricht, die Keime des Heils in der Welt. Die Frage nach der Wesensgleichheit des Logos mit Gott wird angeschnitten, wobei Justins funktionale Unterordnung des Logos unter den Vater erläutert wird. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere, umfassendere Auseinandersetzung mit der Logostheologie bei Origenes.
Das erste systematische Modell einer wissenschaftlichen Theologie bei Origenes: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Origenes' systematischen Ansatz in der Theologie, der eine Synthese von griechischer Philosophie und Christentum anstrebt. Die Diskussion umfasst die Frage nach einer Versöhnung oder Aufhebung des Hellenismus im Christentum und hebt die Notwendigkeit hervor, das Christentum dem Heidentum als ebenbürtig, ja überlegen darzustellen. Origenes' kritische und konstruktive Verarbeitung bisheriger theologischer Ansätze zur Entwicklung eines wissenschaftlichen Modells der Theologie wird detailliert dargestellt. Sein soteriologischer Ansatz, der die Notwendigkeit betont, dass Christus sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott sein muss, um als Heilsmittler zu fungieren, wird beleuchtet. Die neuplatonische Prägung von Origenes' Denken, insbesondere das exitus-reditus-Schema, wird in Bezug auf seine Christologie erklärt. Das Kapitel analysiert Origenes' berühmten Vergleich von Feuer und Eisen zur Veranschaulichung der Vergöttlichung des Menschen und diskutiert die Frage nach dem Verhältnis von menschlicher und göttlicher Natur in Christus und die Rolle der menschlichen Seele als Bindeglied. Die potenziellen Probleme seiner Theorie, besonders bezüglich der Präexistenz der menschlichen Seele Christi und des Leib-Seele-Dualismus, werden kritisch betrachtet und deren Auswirkungen auf die reale Menschwerdung Gottes und die Bedeutung der Leiblichkeit im Heilsprozess diskutiert.
Schlüsselwörter
Logos, Christologie, Origenes, griechische Apologeten, Hellenismus, Synthese, Inkarnation, Heilslehre, Neuplatonismus, Leib-Seele-Dualismus, soteriologische Grundlegung.
Häufig gestellte Fragen zu: Der Logos als Bindeglied von hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Paradigma des Logos in der Christologie des dritten Jahrhunderts, insbesondere bei Origenes und den griechischen Apologeten. Sie analysiert die Synthese hellenistischer Philosophie und christlicher Glaubenslehre im Kontext der Heidenmission und der Entwicklung der christlichen Theologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des Logos in der frühchristlichen Apologetik, die Synthese von griechischer Philosophie und christlicher Theologie, die Christologie des Origenes und ihre neuplatonischen Einflüsse, die Inkarnation des Logos und die Heilslehre sowie den Leib-Seele-Dualismus bei Origenes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Sie konzentriert sich auf zwei Hauptkapitel: "Der Logos als Bindeglied von hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben" und "Das erste systematische Modell einer wissenschaftlichen Theologie bei Origenes".
Was ist der Inhalt des Kapitels "Der Logos als Bindeglied von hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Logos als Brücke zwischen hellenistischer Philosophie und christlichem Glauben. Es analysiert die Verwendung des Begriffs bei Platon, Aristoteles und im Johannesevangelium, diskutiert unterschiedliche Interpretationen der Logostheologie und deren Bedeutung für die Abgrenzung von Glaubensrichtungen. Justin der Märtyrer und seine Synthese der johanneischen Logostheologie mit dem hellenistisch-philosophischen Terminus ("logoi spermatikoi") werden vorgestellt. Die Frage nach der Wesensgleichheit des Logos mit Gott und Justins funktionale Unterordnung des Logos unter den Vater werden erläutert. Das Kapitel bildet die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit Origenes.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Das erste systematische Modell einer wissenschaftlichen Theologie bei Origenes"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf Origenes' systematischen Ansatz in der Theologie, der eine Synthese von griechischer Philosophie und Christentum anstrebt. Es diskutiert die Versöhnung von Hellenismus und Christentum und Origenes' kritische und konstruktive Verarbeitung theologischer Ansätze. Origenes' soteriologischer Ansatz, die neuplatonische Prägung seines Denkens (exitus-reditus-Schema) und der Vergleich von Feuer und Eisen zur Veranschaulichung der Vergöttlichung des Menschen werden erklärt. Das Kapitel analysiert das Verhältnis von menschlicher und göttlicher Natur in Christus, die Rolle der menschlichen Seele und kritisch die potenziellen Probleme seiner Theorie bezüglich der Präexistenz der menschlichen Seele Christi und des Leib-Seele-Dualismus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Logos, Christologie, Origenes, griechische Apologeten, Hellenismus, Synthese, Inkarnation, Heilslehre, Neuplatonismus, Leib-Seele-Dualismus, soteriologische Grundlegung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit frühchristlicher Theologie, hellenistischer Philosophie und der Entwicklung der christlichen Dogmatik auseinandersetzt. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Theologie, Philosophie und Religionswissenschaften.
- Quote paper
- Maximilian Bekmann (Author), 2016, Origenes und die griechischen Apologeten. Das Paradigma des Logos in der Christologie des 3. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356369