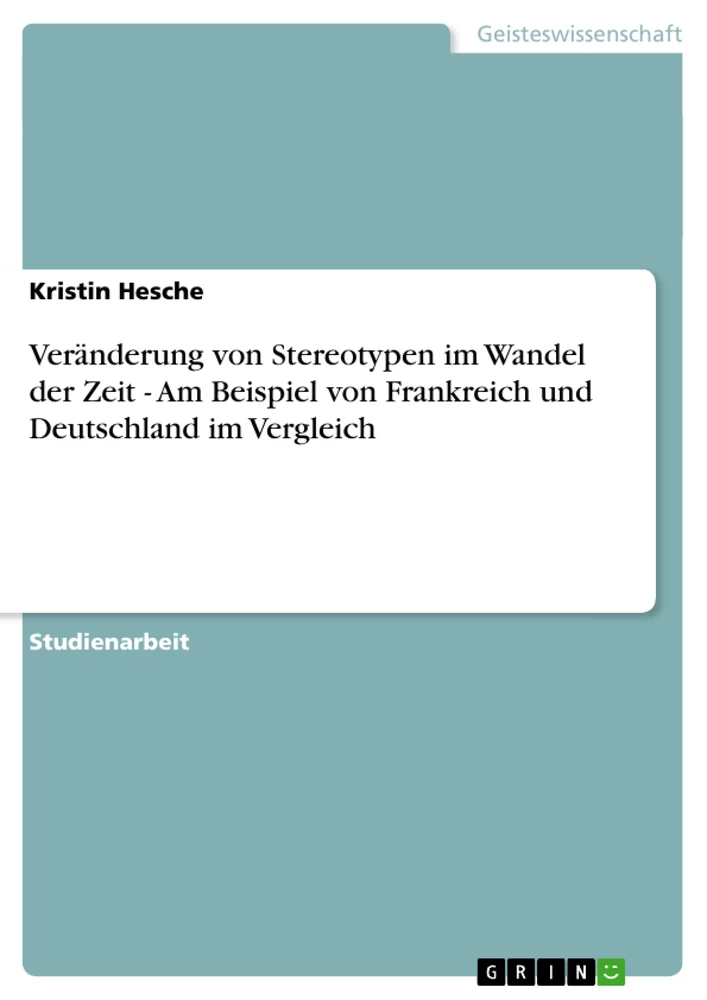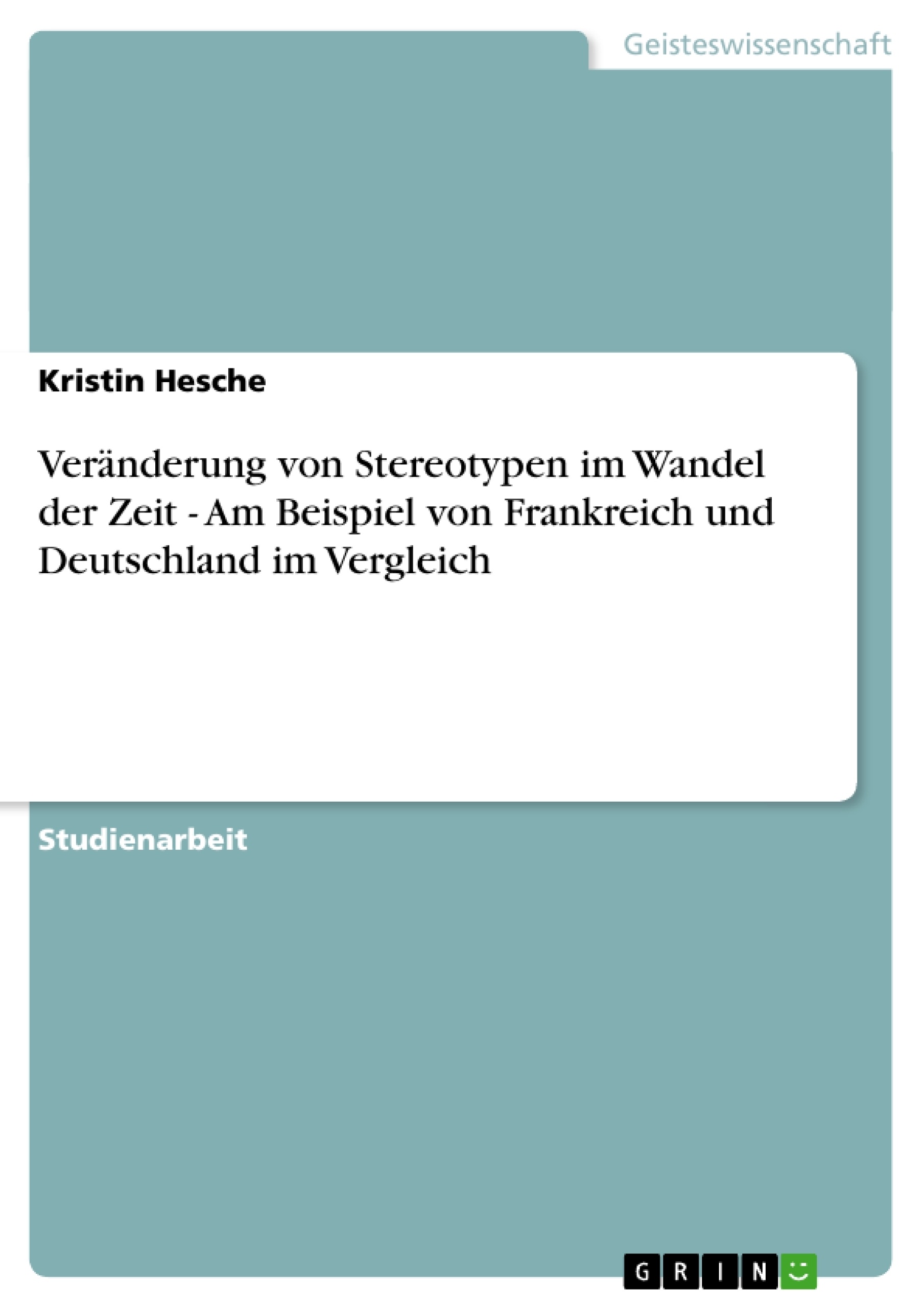Das deutsch-französische Verhältnis hat seit dem Krieg verschiedene Phasen durchlebt, welche maßgeblich durch die internationalen Rahmenbedingungen determiniert wurden. „[I]n der Erkenntnis, daß die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern einen unerläßlichen Schritt auf dem Wege zum vereinigten Europa [.] [darstellt], welches [darüber hinaus] das Ziel beider Völker ist.“ 1 , liegt auch das Bewußtsein, wonach die deutsch-französischen Beziehungen nicht von der Europapolitik zu trennen sind. Obgleich beide Länder in der Verteidigungs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik höchst unterschiedliche Wege gingen, bildeten sie vermittels einer erfolgeichen Gemeinsamkeit den Motor der europäischen Einigung. 2
Waren die deutsch-französischen Beziehungen in den 80er Jahren noch durch ruhende Kontinuität gekennzeichnet, änderte sich die französische Haltung mit den Ereignissen, die zur deutschen Einheit führten, vielfach grundlegend. 3 Eine Vielzahl von Beiträgen, welche, verfaßt kurz nach dem Fall der Mauer, Reaktionen der französischen Regierung auf die deutschen Vorgänge beinhalteten, bilanzieren die Skepsis und die Befürchtungen, mit denen sowohl französische Politiker als auch die Medien der deutschen Wiedervereinigung begegneten. 4 Da ist von der französischen Angst eines erneuten Großdeutschlands ebenso die Rede wie von der übermächtigen Sorge, daß das Wirtschaftsimperium Deutschland nun überdies zu einem politischen Riesen avancieren könne. 5 Die Ängste dokumentieren es: Es scheint, als regierten „im deutsch-französischen Informationsaustausch immer noch die Klischees, das Halbvergorene und scheinbar Einleuchtende [dergestalt], als handele es sich um solide völkerpsychologische Erkenntnisse. Was wirklichem Verständnis im Wege steht, sind [offenbar immer noch] jene unausrottbaren Vorurteile, [.] Klischees [...]“ 6 und Stereotype, welche trotz sich wandelnder Ausprägungen je nach politischer Lage immer noch einen markanten Effekt verzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- Stereotyp, Vorurteil und Image
- Zeiten des Wandels oder zur Konjunktur des Stereotyps?
- Der Stereotypbegriff
- Images: Begriff und Abgrenzung
- Historie und das Bild vom Anderen
- Ein historischer Exkurs
- Französische Deutschlandbilder
- Deutsche Frankreichbilder
- Frankreich und die Deutsche Einheit
- Die deutsche Wiedervereinigung - französische Reaktionen
- Ein verändertes Deutschlandbild? - Ein Querschnitt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die französische Wahrnehmung und Kommentierung der deutschen Wiedervereinigung und deren Einfluss auf die deutsch-französischen Beziehungen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Frage, ob dieses Ereignis zu einer Wiederbelebung alter Selbst- und Fremdbilder in Frankreich und Deutschland geführt hat. Die Arbeit analysiert dabei die Rolle von Stereotypen, Vorurteilen und Images.
- Die französische Reaktion auf die deutsche Wiedervereinigung
- Die Rolle von Stereotypen, Vorurteilen und Images im deutsch-französischen Verhältnis
- Historische Entwicklung des französischen Deutschlandbildes
- Analyse der Stereotypenentwicklung im deutsch-französischen Verhältnis
- Der Einfluss der deutschen Einheit auf das Selbst- und Fremdbild beider Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das deutsch-französische Verhältnis seit dem Krieg als von internationalen Rahmenbedingungen geprägt und untrennbar mit der europäischen Einigung verbunden. Sie hebt die veränderte französische Haltung nach der deutschen Wiedervereinigung hervor, die von Skepsis und Befürchtungen gegenüber einem möglicherweise übermächtigen Deutschland geprägt war. Die Arbeit untersucht, ob diese Ängste auf alten Stereotypen, Vorurteilen und Images beruhen.
Stereotyp, Vorurteil und Image: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe Stereotyp, Vorurteil und Image. Es analysiert die Entstehung von Stereotypen im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen und untersucht deren Funktion als Orientierungs- und Entlastungshilfe. Es wird auf verschiedene Theorien und Ansätze zur Erläuterung des Stereotypenbegriffs eingegangen, unter anderem die Theorien von Manz und Hofstätter.
Historie und das Bild vom Anderen: Dieses Kapitel bietet einen historischen Exkurs, der sich auf das französische Deutschlandbild konzentriert. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Selbst- und Fremdbildern beider Länder im Laufe der Geschichte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Wahrnehmung Deutschlands in Frankreich im historischen Kontext.
Frankreich und die Deutsche Einheit: Dieses Kapitel analysiert die französischen Reaktionen auf die deutsche Wiedervereinigung. Es untersucht, ob und wie sich das französische Deutschlandbild im Zuge der Wiedervereinigung verändert hat. Die Analyse berücksichtigt die Rolle der Medien und der Politik in der Konstruktion des Bildes vom vereinten Deutschland.
Schlüsselwörter
Deutsch-französische Beziehungen, Deutsche Wiedervereinigung, Stereotypen, Vorurteile, Images, Selbstbild, Fremdbild, historische Entwicklung, Medien, Politik, Frankreichbild, Deutschlandbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Französische Wahrnehmung der Deutschen Wiedervereinigung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die französische Wahrnehmung und Kommentierung der deutschen Wiedervereinigung und deren Einfluss auf die deutsch-französischen Beziehungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob dieses Ereignis zu einer Wiederbelebung alter Selbst- und Fremdbilder in Frankreich und Deutschland geführt hat. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die Rolle von Stereotypen, Vorurteilen und Images.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die französische Reaktion auf die deutsche Wiedervereinigung; die Rolle von Stereotypen, Vorurteilen und Images im deutsch-französischen Verhältnis; die historische Entwicklung des französischen Deutschlandbildes; die Analyse der Stereotypenentwicklung im deutsch-französischen Verhältnis; und der Einfluss der deutschen Einheit auf das Selbst- und Fremdbild beider Länder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Kontext des deutsch-französischen Verhältnisses und die Forschungsfrage beschreibt. Kapitel zwei definiert und grenzt die Begriffe Stereotyp, Vorurteil und Image ab. Kapitel drei bietet einen historischen Exkurs zum französischen Deutschlandbild. Kapitel vier analysiert die französischen Reaktionen auf die deutsche Wiedervereinigung und deren Einfluss auf das wechselseitige Bild beider Länder. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.
Wie werden Stereotypen, Vorurteile und Images in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Entstehung und Funktion von Stereotypen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze zur Erläuterung des Stereotypenbegriffs herangezogen (z.B. Manz und Hofstätter). Die Arbeit untersucht, ob die französischen Reaktionen auf die Wiedervereinigung auf alten Stereotypen, Vorurteilen und Images beruhen.
Welche Rolle spielen Geschichte und das historische Bild vom Anderen?
Die Arbeit enthält einen historischen Exkurs, der sich auf das französische Deutschlandbild konzentriert und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Selbst- und Fremdbildern beider Länder im Laufe der Geschichte analysiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Wahrnehmung Deutschlands in Frankreich im historischen Kontext.
Wie wird die deutsche Wiedervereinigung und die französische Reaktion darauf analysiert?
Die Arbeit analysiert die französischen Reaktionen auf die deutsche Wiedervereinigung, untersucht ob und wie sich das französische Deutschlandbild im Zuge der Wiedervereinigung verändert hat und berücksichtigt dabei die Rolle der Medien und der Politik in der Konstruktion des Bildes vom vereinten Deutschland.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-französische Beziehungen, Deutsche Wiedervereinigung, Stereotypen, Vorurteile, Images, Selbstbild, Fremdbild, historische Entwicklung, Medien, Politik, Frankreichbild, Deutschlandbild.
- Quote paper
- Kristin Hesche (Author), 2000, Veränderung von Stereotypen im Wandel der Zeit - Am Beispiel von Frankreich und Deutschland im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35612