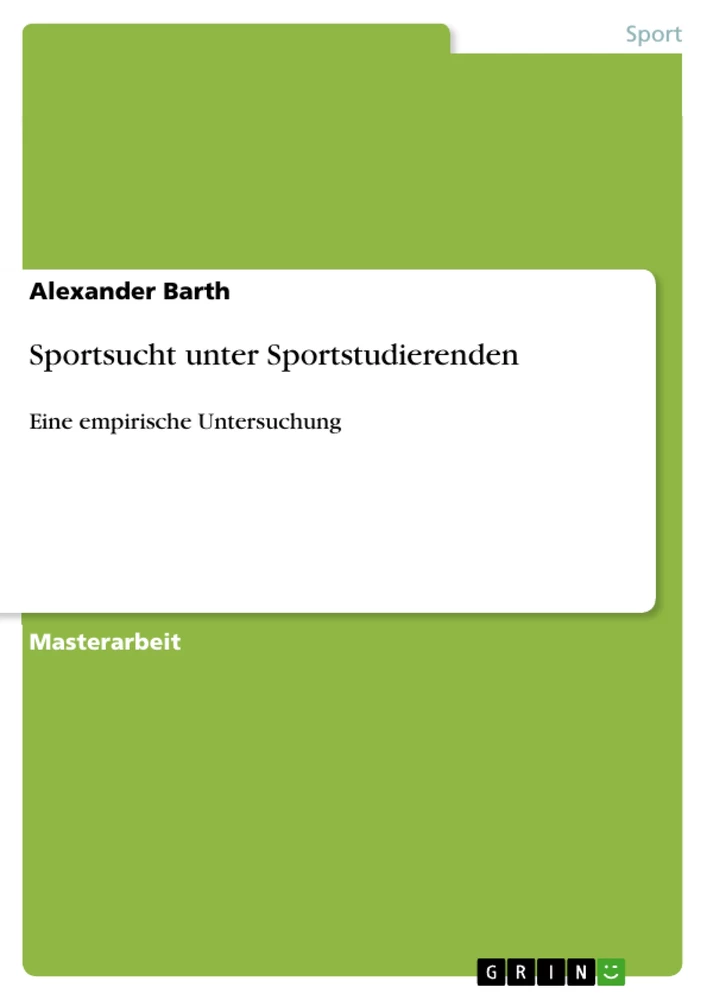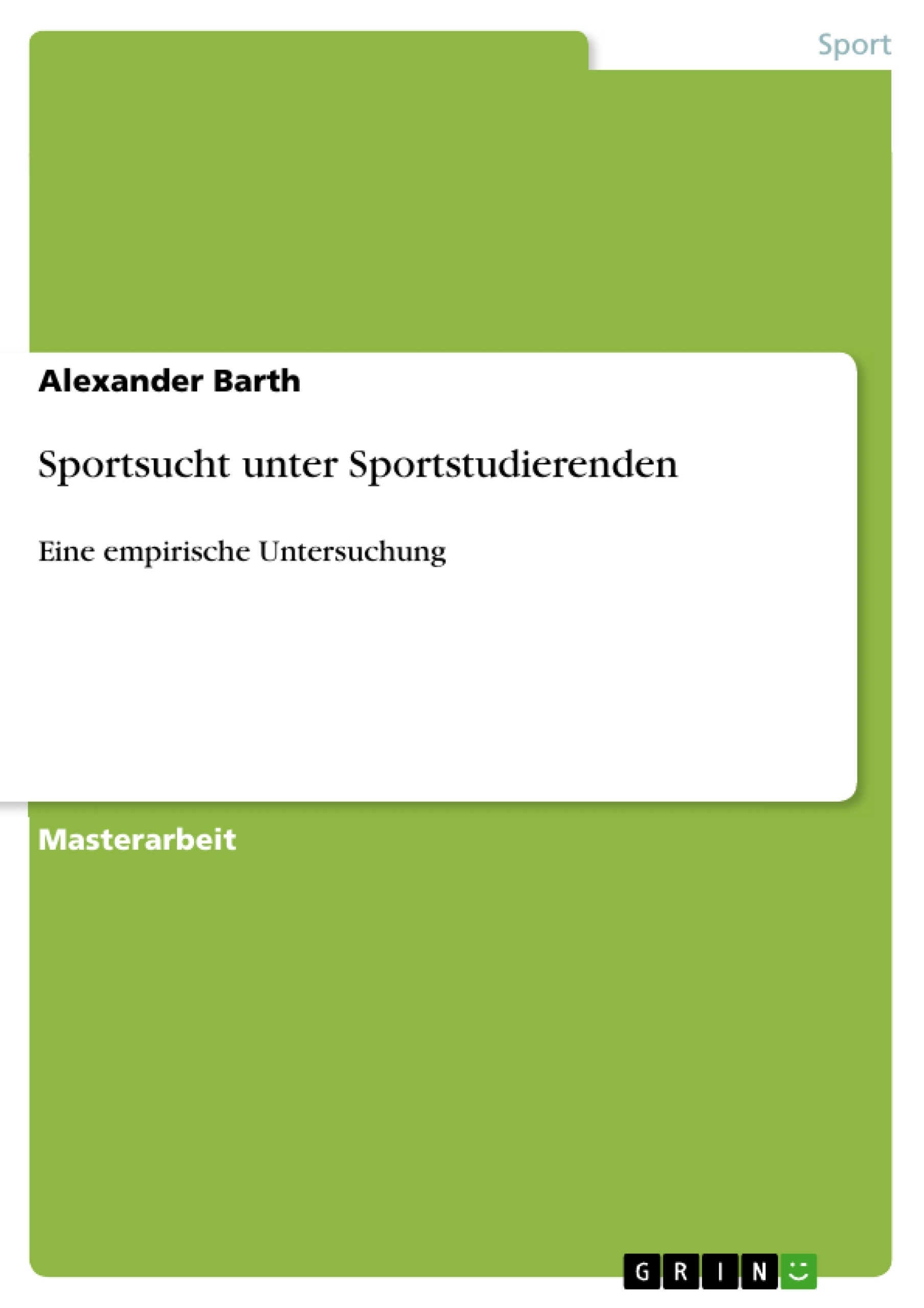Ziel dieser Examensarbeit ist es, das Phänomen der Sportsucht näher zu untersuchen. Da davon auszugehen ist, dass bei Sportstudierenden das Interesse am Sport und am Sportreiben besonders ausgeprägt ist, möchte ich mit einem Fragebogen herausfinden, ob es unter den Sportstudenten/ -innen der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz Sportsüchtige gibt und ob die Befragten überhaupt wissen, was Sportsucht eigentlich ist.
Beginnen werde ich mit einem theoretischen Teil, in dem ich die zentralen Begriffe und Konzepte, welche für eine Definition von Sportsucht notwendig sind, vorstellen und erläutern möchte. Anschließend werde ich, in Anlehnung an Hausenblas und Symons Downs eine Definition für Sportsucht herleiten und auf mögliche diagnostische Kriterien hinweisen.
Einen weiteren Untersuchungsgegenstand stellen die Komorbiditäten einer Sportsucht dar. Hierbei werde ich die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Sportsucht von Veale vorstellen und im Folgenden auf den Zusammenhang sowie das Ursache-Wirkungs-Problem von Essstörungen und Sportsucht einerseits und den möglichen Auswirkungen körperdysmorpher Störungen auf das Sporttreiben andererseits eingehen.
Weiter werde ich einige Ursachen und Erklärungsansätze zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Sportsucht behandeln und dabei sowohl psychologische, physiologische als auch soziologisch-gesellschaftliche Erklärungsversuche und Modelle miteinbeziehen. Den Abschluss meines theoretischen Teils bilden mögliche Präventions- und Therapieformen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Definitionen
- Definition Sport
- Definition Sucht
- Etymologie und Wandel des Suchtbegriffs
- Klassifikation von „Abhängigkeit“
- Begriffsdefinition „Sucht“
- Definition Sportsucht
- Mögliche Konzepte zur Einordnung stoffungebundener Süchte
- Kriterien zur Diagnose einer Sportsucht
- Toleranzentwicklung
- Entzugssymptome
- Intentionalität
- Kontrollverlust
- Zeitlicher Aufwand
- Konflikte
- Kontinuität
- Komorbiditäten
- Essstörungen
- Anorexia nervosa vs. Bulimia nervosa
- Anorexia athletica
- Körpersdysmorphe Störungen
- Muskeldysmorphie
- Essstörungen
- Ursachen und Erklärungsansätze zur Entstehung von Sportsucht
- Physiologische Erklärungsansätze
- Die Katecholaminhypothese/Dopaminhypothese
- Die Endorphinhypothese
- Psychologische Erklärungsansätze
- Komplexe Erklärungsmodelle
- Physiologische Erklärungsansätze
- Prävention und Therapie
- Befragung der Sportstudenten/-innen
- Hypothesen
- Auswahl und Anwendung der Forschungsmethode
- Fragebogen
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Überprüfung der Hypothesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht das Phänomen der Sportsucht, insbesondere bei Sportstudierenden. Ziel ist es, die Definition von Sportsucht zu klären, diagnostische Kriterien zu beleuchten und Komorbiditäten wie Essstörungen und körperdysmorphe Störungen zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für Sportsucht und skizziert Präventions- und Therapieoptionen. Abschließend werden die Ergebnisse einer Befragung von Sportstudierenden präsentiert und interpretiert.
- Definition und Diagnose von Sportsucht
- Komorbiditäten von Sportsucht (Essstörungen, Körpersdysmorphe Störungen)
- Physiologische und psychologische Erklärungsansätze zur Entstehung von Sportsucht
- Prävention und Therapie von Sportsucht
- Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Sportsucht bei Sportstudierenden
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die persönliche Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Sportsucht auseinanderzusetzen. Ausgehend von einer eigenen Erfahrung mit intensivem Sporttreiben, schildert sie eine Begegnung, die ihr Verständnis von Sportsucht veränderte und sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem Thema bewog. Die Autorin stellt zentrale Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen, wie die Definition von Sportsucht, die Messbarkeit und die Ursachen dieses Phänomens.
Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht den Gegensatz zwischen gesundem Sporttreiben als Ausgleich und dem problematischen Verhalten sportsüchtiger Personen. Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Phänomens Sportsucht bei Sportstudierenden mittels eines Fragebogens. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, wobei der theoretische Teil die Definitionen, diagnostische Kriterien, Komorbiditäten und Erklärungsansätze beleuchtet, während der praktische Teil die Durchführung und Auswertung der Befragung beschreibt.
Definitionen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Arbeit, indem es die Begriffe „Sport“ und „Sucht“ definiert. Es wird die Entwicklung des Begriffs „Sucht“ nachvollzogen und die verschiedenen Konzepte zur Einordnung von Sportsucht in gängige Diagnosemanualen diskutiert. Die Definition von „Sport“ wird historisch und begrifflich eingegrenzt und auf ihre heutige Verwendung hin untersucht.
Schlüsselwörter
Sportsucht, Sucht, Abhängigkeit, Sport, Diagnose, Komorbidität, Essstörungen, Körpersdysmorphe Störungen, Prävention, Therapie, Empirische Untersuchung, Sportstudenten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Examensarbeit: Sportsucht bei Sportstudierenden
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Diese Examensarbeit untersucht das Phänomen der Sportsucht, insbesondere bei Sportstudierenden. Sie beleuchtet die Definition von Sportsucht, diagnostische Kriterien, Komorbiditäten (wie Essstörungen und körperdysmorphe Störungen), Erklärungsansätze, Präventions- und Therapieoptionen und präsentiert Ergebnisse einer Befragung von Sportstudierenden.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: Definition und Diagnose von Sportsucht, Komorbiditäten (Essstörungen, Körpersdysmorphe Störungen), physiologische und psychologische Erklärungsansätze, Prävention und Therapie, sowie die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung bei Sportstudierenden. Die Arbeit enthält auch ein Vorwort, eine Einleitung, Kapitel zu Definitionen (Sport, Sucht, Sportsucht), diagnostische Kriterien, Ursachen und Erklärungsansätze, Prävention und Therapie, die Beschreibung der Befragung von Sportstudierenden (inkl. Hypothesen, Methodik, Ergebnisse und Interpretation), und ein Fazit.
Wie wird Sportsucht definiert?
Die Arbeit geht ausführlich auf die Definition von „Sport“ und „Sucht“ ein, verfolgt die Entwicklung des Suchtbegriffs und diskutiert verschiedene Konzepte zur Einordnung von Sportsucht in gängige Diagnosemanualen. Es wird eine begriffliche Abgrenzung von gesundem Sporttreiben und problematischem Sportverhalten vorgenommen.
Welche diagnostischen Kriterien für Sportsucht werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Kriterien zur Diagnose einer Sportsucht, einschließlich Toleranzentwicklung, Entzugssymptome, Intentionalität, Kontrollverlust, zeitlicher Aufwand, Konflikte und Kontinuität.
Welche Komorbiditäten werden im Zusammenhang mit Sportsucht diskutiert?
Die Arbeit untersucht Komorbiditäten wie Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Anorexia athletica) und körperdysmorphe Störungen, insbesondere Muskeldysmorphie.
Welche Erklärungsansätze für Sportsucht werden vorgestellt?
Die Arbeit beleuchtet physiologische Erklärungsansätze (Katecholaminhypothese/Dopaminhypothese, Endorphinhypothese), psychologische Erklärungsansätze und komplexe Erklärungsmodelle zur Entstehung von Sportsucht.
Wie wird die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die Arbeit beschreibt eine Befragung von Sportstudierenden. Sie umfasst die Formulierung von Hypothesen, die Auswahl und Anwendung der Forschungsmethode (Fragebogen), die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und die Überprüfung der Hypothesen.
Welche Präventions- und Therapieoptionen werden angesprochen?
Die Arbeit skizziert verschiedene Präventions- und Therapieoptionen für Sportsucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sportsucht, Sucht, Abhängigkeit, Sport, Diagnose, Komorbidität, Essstörungen, Körpersdysmorphe Störungen, Prävention, Therapie, Empirische Untersuchung, Sportstudenten.
Gibt es ein Vorwort und eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält ein Vorwort, das die persönliche Motivation der Autorin beschreibt, und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die deren Inhalt kurz und prägnant wiedergibt.
- Quote paper
- Alexander Barth (Author), 2011, Sportsucht unter Sportstudierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356118