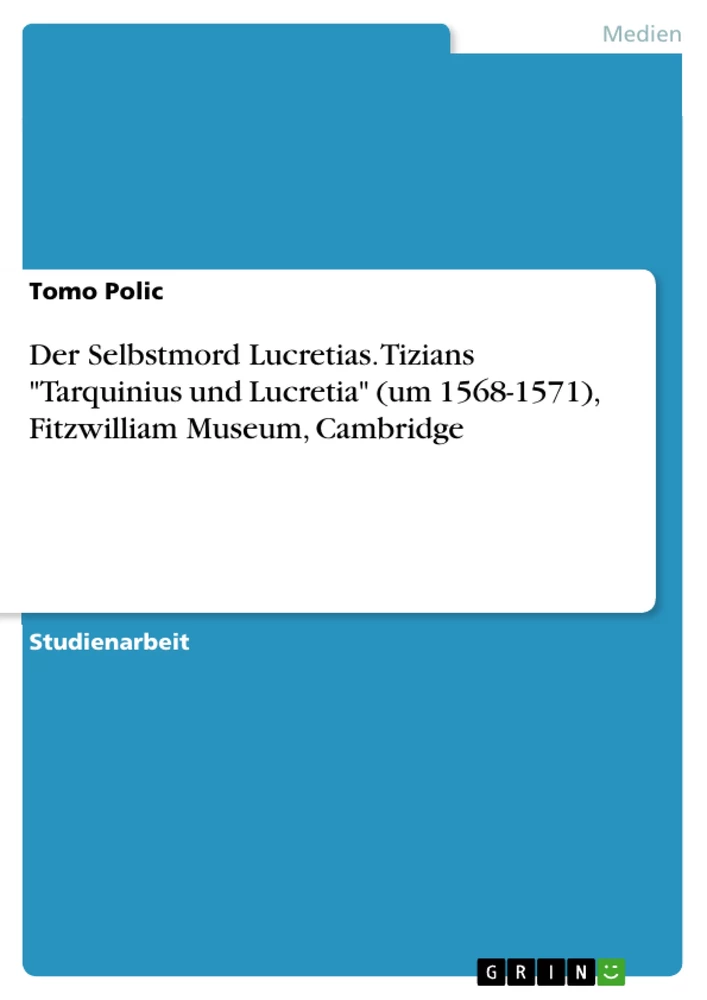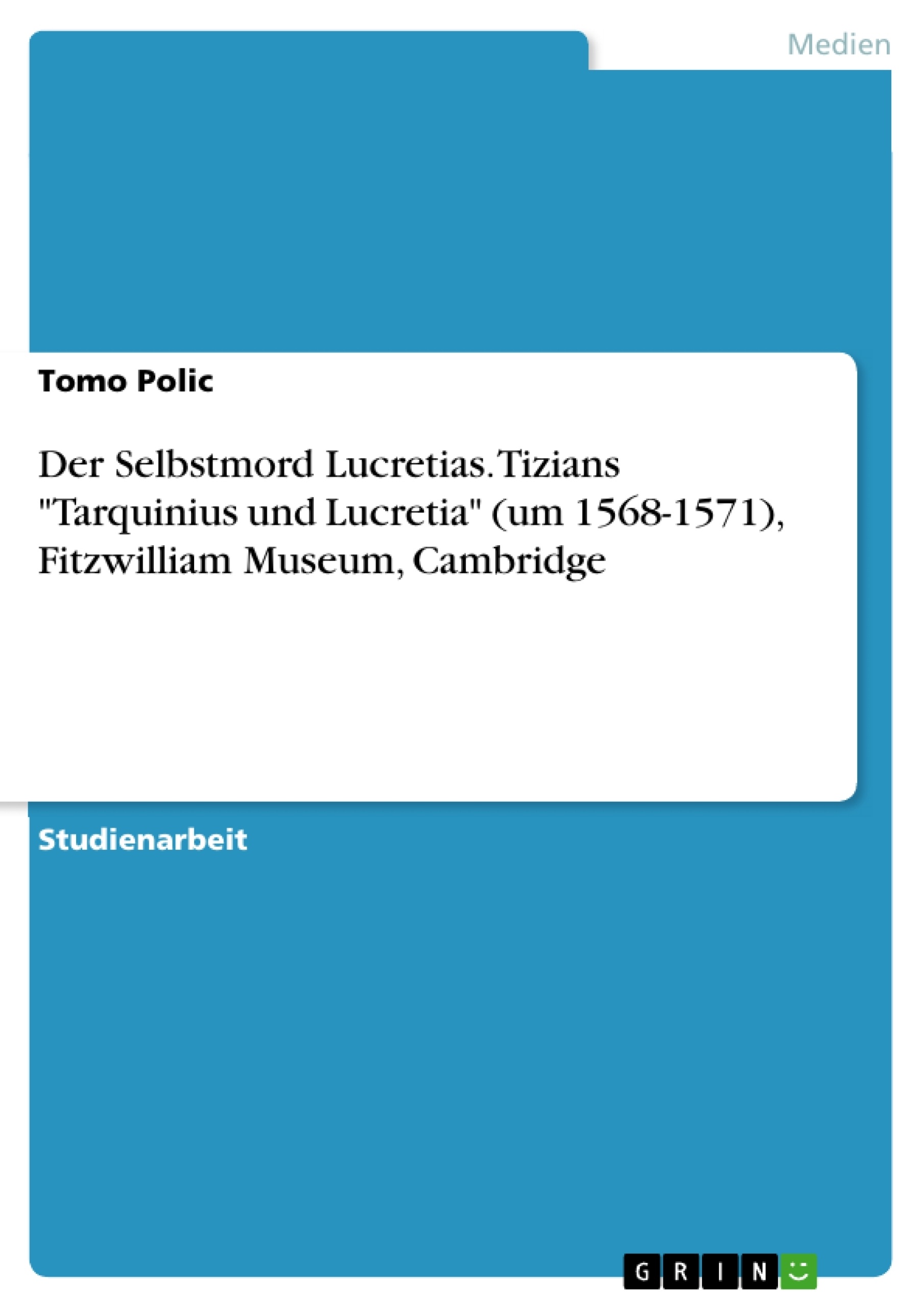Dieser Text handelt vom Selbstmord Lucretias als Thema in literarischen und philosophischen Schriften. Es werden Lucretias Selbstmord- und Vergewaltigungsdarstellungen von Tizian, Cranach und Dürer als Streitpunkt in der neueren Forschung betrachtet und Beispiele der entgegengesetzten Interpretationsversuche gegeben.
Vorlagen und Vorbilder für Tizians Darstellungen der Vergewaltigung Lucretias; Giulio Romanos pornografische „Modi“ und „Mars und Venus“- Darstellungen; zeitgenossische Druckgrafiken, sowie Tarquinius und Lucretia aus Cambridge werden betrachtet in Hinsicht auf die „non finito“, „Fleckenmalerei“, „Altersstil“ oder „offene Malweise“ Tizians; Hans Ost über Tizians „Alterstil“; Tintoretto als wahrer „Schnellmaler“.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Geschichte der Lucretia
- Selbstmord Lucretias als Thema in literarischen und philosophischen Schriften
- Lucretias Selbstmord- und Vergewaltigungsdarstellungen von Tizian, Cranach und Dürer als Streitpunkt in der neueren Forschung
- Tarquinius und Lucretia, Fitzwilliam Museum, Cambridge (1568-1571)
- Bildbeschreibung
- Tarquinius und Lucretia
- Figur des Dieners
- Einige Beispiele der entgegengesetzten Interpretationsversuche
- Vorlagen und Vorbilder für Tizians Darstellungen der Vergewaltigung Lucretias
- Giulio Romanos pornografische „Modi“ und „Mars und Venus“-Darstellungen
- Zeitgenossische Druckgrafiken
- Bildbeschreibung
- Tarquinius und Lucretia aus Cambridge, betrachtet in Hinsicht auf die „non finito“, „Fleckenmalerei“, „Altersstil“ oder „offene Malweise“ Tizians
- Hans Ost über Tizians „Alterstil“
- Tintoretto als wahrer „Schnellmaler“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Tizians Gemälde „Tarquinius und Lucretia“ (um 1568-1571) im Fitzwilliam Museum, Cambridge, im Kontext seines Spätwerks und der Rezeption des Lucretia-Motivs in der Kunstgeschichte. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen des Bildes analysiert und in Beziehung zu Tizians Maltechnik und seinem „Alterstil“ gesetzt.
- Analyse der verschiedenen Interpretationen von Tizians „Tarquinius und Lucretia“
- Untersuchung von Tizians Maltechnik im Spätwerk und des Konzepts des „non finito“
- Vergleich mit Lucretia-Darstellungen anderer Künstler (Cranach, Dürer)
- Rezeption des Lucretia-Motivs in Literatur und Philosophie
- Bedeutung der Darstellung von Gewalt und Sexualität im Werk Tizians
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit konzentriert sich auf die Cambridge-Version von Tizians „Tarquinius und Lucretia“, ein Schlüsselwerk seines Spätwerks, das sich durch eine scheinbar paradoxe Vollendung im Vergleich zu anderen Werken dieser Phase auszeichnet. Die Analyse fokussiert auf die Problematik des Fertigseins im Spätwerk Tizians sowie auf die Veränderung der Darstellung weiblicher Nacktheit in seinen späteren Gemälden. Die Arbeit wird sich auch mit verschiedenen, oft widersprüchlichen, Interpretationen des Motivs auseinandersetzen, wobei Texte von Puttfarken, Suthor, Bohde, Hults, Goffen und Fehl herangezogen werden.
Geschichte der Lucretia: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Lucretia, wie sie von Livius, Ovid und Boccaccio erzählt wird. Lucretias Selbstmord wird als Gründungsmythos der römischen Republik und als Symbol des Kampfes für eine freie Gesellschaft interpretiert. Die Problematik der möglichen Mitschuld oder Mittäterschaft des Opfers wird diskutiert, wobei der Einfluss des Ehemannes auf die Wahrnehmung Lucretias und die perfide Drohung Tarquinius’ im Mittelpunkt stehen.
Lucretias Selbstmord- und Vergewaltigungsdarstellungen von Tizian, Cranach und Dürer als Streitpunkt in der neueren Forschung: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung des Lucretia-Motivs bei Tizian, Cranach und Dürer. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen der Nacktheit Lucretias und der Frage nach der Vereinbarkeit von Erotik und Heldentum diskutiert. Die Arbeiten von Bohde, Suthor und Hults werden im Hinblick auf ihre widersprüchlichen Ansätze analysiert, wobei insbesondere die Rolle der Institution Ehe und die gesellschaftlichen Normen der Renaissance betont werden.
Tarquinius und Lucretia, Fitzwilliam Museum, Cambridge (1568-1571): Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Bildbeschreibung des Cambridger Gemäldes, inklusive Analyse der Figuren Tarquinius, Lucretia und des Dieners. Verschiedene Interpretationen des Bildes werden vorgestellt und kritisch hinterfragt, inklusive der Ansichten von Puttfarken, Goffen und Suthor. Der Einfluss von Vorlagen und Vorbildern, insbesondere Giulio Romanos Werke, wird ebenfalls beleuchtet.
Tarquinius und Lucretia aus Cambridge, betrachtet in Hinsicht auf die „non finito“, „Fleckenmalerei“, „Altersstil“ oder „offene Malweise“ Tizians: Dieses Kapitel behandelt die Frage nach dem „Alterstil“ Tizians und dem Konzept des „non finito“. Die These Puttfarkens, dass sich die frühen und späten Werke Tizians nicht im Grad des Fertigseins, sondern in der Technik unterscheiden, wird diskutiert. Die Analyse von Hans Ost über Tizians Spätwerk und dessen „Fleckenmalerei“ wird eingehend behandelt, mit einem Vergleich zu Tintoretto und einer Betrachtung des Werks im Kontext der Moderne.
Schlüsselwörter
Tizian, Tarquinius und Lucretia, Spätwerk, Non finito, Fleckenmalerei, Alterstil, Vergewaltigung, Darstellung weiblicher Nacktheit, Interpretation, Maltechnik, Renaissance, Kunstgeschichte, Giulio Romano, Cranach, Dürer, Gewalt, Sexualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Tizians "Tarquinius und Lucretia"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Tizians Gemälde "Tarquinius und Lucretia" (um 1568-1571) im Fitzwilliam Museum, Cambridge. Der Fokus liegt auf dem Gemälde im Kontext von Tizians Spätwerk, der Rezeption des Lucretia-Motivs in der Kunstgeschichte und den verschiedenen Interpretationen des Bildes im Hinblick auf Maltechnik und "Alterstil".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, darunter die Analyse unterschiedlicher Interpretationen von Tizians Werk, die Untersuchung seiner Maltechnik im Spätwerk (insbesondere "non finito"), Vergleiche mit Lucretia-Darstellungen anderer Künstler (Cranach, Dürer), die Rezeption des Motivs in Literatur und Philosophie sowie die Bedeutung der Darstellung von Gewalt und Sexualität in Tizians Werk. Die Geschichte der Lucretia, wie sie von Livius, Ovid und Boccaccio erzählt wird, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Künstler werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Tizians Darstellung des Lucretia-Motivs mit denen von Lucas Cranach dem Älteren und Albrecht Dürer. Die unterschiedlichen Interpretationen der Nacktheit Lucretias und die Frage nach der Vereinbarkeit von Erotik und Heldentum in den jeweiligen Werken werden diskutiert.
Welche Rolle spielt der "Alterstil" Tizians?
Die Arbeit befasst sich eingehend mit dem "Alterstil" Tizians und dem Konzept des "non finito". Die These Puttfarkens, dass sich die frühen und späten Werke Tizians nicht im Grad des Fertigseins, sondern in der Technik unterscheiden, wird diskutiert. Die Analyse von Hans Ost über Tizians Spätwerk und dessen "Fleckenmalerei" wird ebenfalls behandelt, mit einem Vergleich zu Tintoretto.
Welche Interpretationsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene, oft widersprüchliche Interpretationen des Gemäldes und bezieht sich dabei auf Texte von Puttfarken, Suthor, Bohde, Hults, Goffen und Fehl. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Darstellung der Vergewaltigung, die Rolle der Figuren (Lucretia, Tarquinius, der Diener) und die Bedeutung der Bildkomposition werden kritisch hinterfragt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf literarische und philosophische Schriften, die das Thema Lucretia behandeln, sowie auf die Werke von Tizian, Cranach und Dürer. Zusätzlich werden kunsthistorische Texte und Interpretationen der genannten Autoren herangezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tizian, Tarquinius und Lucretia, Spätwerk, Non finito, Fleckenmalerei, Alterstil, Vergewaltigung, Darstellung weiblicher Nacktheit, Interpretation, Maltechnik, Renaissance, Kunstgeschichte, Giulio Romano, Cranach, Dürer, Gewalt, Sexualität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einführung, ein Kapitel zur Geschichte der Lucretia, ein Kapitel zum Vergleich der Lucretia-Darstellungen verschiedener Künstler, ein Kapitel zur detaillierten Bildbeschreibung des Cambridger Gemäldes und ein Kapitel zur Analyse des "Alterstils" Tizians. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
- Quote paper
- Tomo Polic (Author), 2010, Der Selbstmord Lucretias. Tizians "Tarquinius und Lucretia" (um 1568-1571), Fitzwilliam Museum, Cambridge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356038