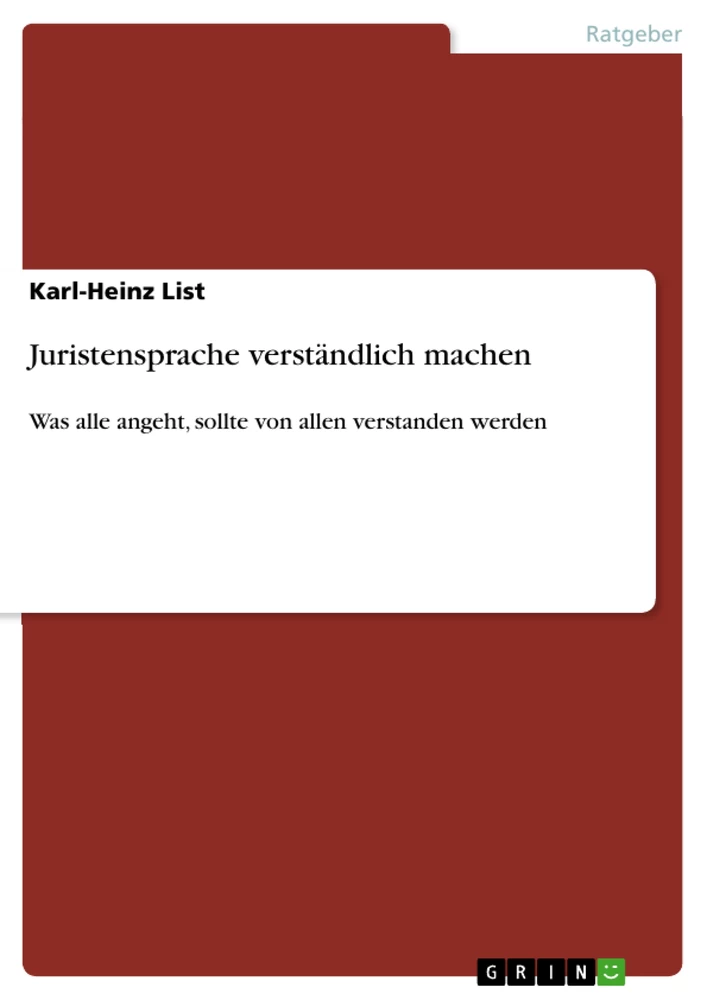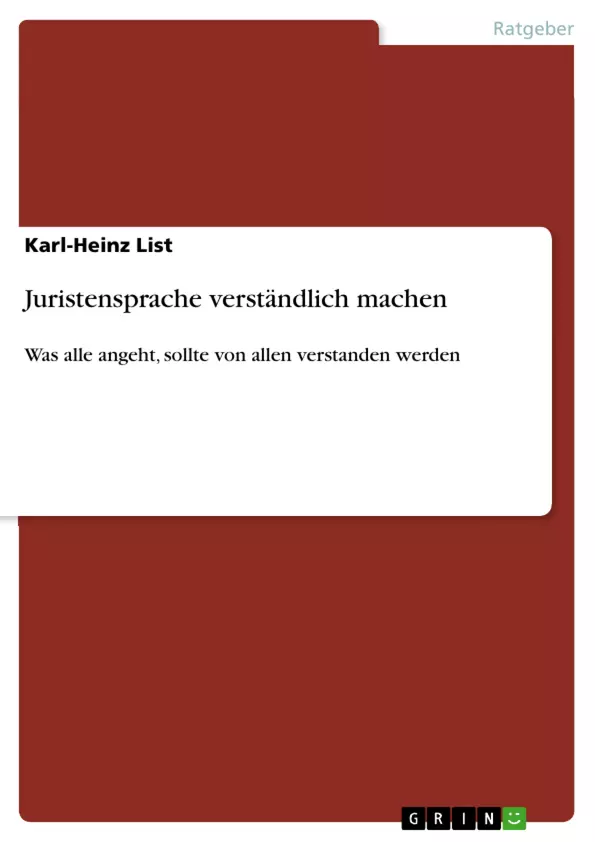Die Sprache der Juristen ist für juristische Laien oft unverständlich. Juristen meinen, dies sei eben eine Fachsprache wie es auch bei anderen Disziplinen üblich ist. Sie vergessen dabei, dass Gesetze, Entscheidungen und Verträge für alle Bürger wichtig sind. Das beste Beispiel liefert das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Die Sprache im BGB ist antiquiert und oft unverständlich, obwohl es um Kauf, Miete, Leihe, Erbe und vieles mehr geht, das alle Bürger angeht. Wer weiß schon, was „billiges Ermessen“ bedeutet? Selbst der Begriff „Beförderungserschleichung“ klingt fremd, obwohl man sich vorstellen kann, was gemeint ist: Schwarzfahren.
In diesem Buch werden unverständliche juristische Texte in Gesetzen, Urteilen und Verträgen aufgespürt und in klare Sätze verwandelt. Außerdem haben Leser die Möglichkeit, ihr Sprachgefühl zu testen und ihre Sprachfähigkeit mit Übungen zu verbessern. Zudem wird das Recht der Bürger auf verständliche Gesetze und Entscheidungen dargestellt und Wege aufgezeigt, wie dieses demokratische Bürgerrecht in die Praxis umgesetzt werden kann. Noch ist dies eine konkrete Utopie. Doch es gibt namhafte Juristen, die dieses Bürgerrecht postulieren, wie der Rechtsprofessor Uwe Wesel und der ehemalige Richter Rudolf Wassermann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sprache allgemein
- Sprache: Angeboren oder erlernt?
- Leichte Sprache - auch für Juristen?
- Leichte Sprache – für wen?
- Wer schreibt bereits in Leichter Sprache?
- Sprachgefühl und Sprachgebrauch
- Gespür für das richtige Wort
- Woher die Unverständlichkeit rührt
- Beispiel Formular-Arbeitsvertrag - Recht ist Sprache
- Bauhaus-Sprachstil
- Von der Wissenschaft lernen
- Das Bauchgefühl: Wie es funktioniert
- Intuitive Urteile
- Emotionen
- Hirnforschung: Spiegelneurone
- Sind Gefühle authentisch?
- Körpersprache
- Selbstdarstellung
- 2 Die Sprache der Juristen
- Die Sprache in Urteilen
- Sprache ist nicht logisch
- Rechtsbeugung (mit Sprachkritik)
- Beispiel: Bereitschaftsdienst - Zwei Urteile (mit Kommentar)
- Die Sprache in Gesetzen (mit Verbesserungsvorschlägen)
- Grundrechte, Asylrecht
- Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) - Beispiele
- Billiges Ermessen – Beispiel Bonusanspruch
- BGB § 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
- Straßenverkehrsordnung
- Beispiel: Aus dem Bundeserziehungsgeldgesetz
- Beispiel: Kündigungsschutzgesetz
- 3 An der Sprache scheitern – Beispiel Arbeitszeugnisse
- Wie es anfing
- Rechtsanspruch BGB
- Grundsätze: Wahrheit und Wohlwollen
- Wahrheit geht vor Wohlwollen - ein Widerspruch
- Widersprüchliche Rechtsprechung
- Zeugnissprache
- Reihefolgetechnik, Negationstechnik, Leerstellentechnik
- Leistungsbeurteilung nach Schulnoten – Beispiel
- Beurteilung des Arbeitsverhaltens (früher „Führung“)
- Zusammenfassende Beurteilung: Urteil Bundesarbeitsgericht
- Beurteilungssystem
- Bedeutung der Endnote
- Vorauswahl in der Praxis
- Sprachgebrauch in Arbeitszeugnissen
- Wenn Verben nicht passen
- Adjektive (stehende Beiwörter)
- Papierdeutsch
- Der aufgeblasene Stil
- Sprachlich missglückt
- Anschaulich formuliert (Aus Originalzeugnissen)
- 4 Korrekt und verständlich formulieren - wie geht das?
- Was heißt verständlich formulieren?
- Knappheit
- Mehr Verben, weniger Substantive
- Falsche Adjektive
- In Bildern sprechen
- Indikativ und Konjunktiv (mit Beispielen)
- Verständlichkeitskonzept – Von Wissenschaftlern entwickelt
- Was ist Verständlichkeit?
- 5 Vom Recht auf verständliche Gesetze und Entscheidungen
- Was man über die Juristenausbildung wissen sollte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Hauptziel des Werkes ist es, die Verständlichkeit juristischer Sprache zu verbessern und die damit verbundenen Probleme aufzuzeigen. Es wird untersucht, wie Unverständlichkeit entsteht und welche Möglichkeiten es gibt, juristische Texte klarer und zugänglicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf der Analyse von Sprache im rechtlichen Kontext und der Entwicklung von Strategien für eine bessere Kommunikation.
- Analyse der Unverständlichkeit juristischer Sprache
- Vergleich verschiedener Sprachstile im juristischen Bereich
- Methoden zur Verbesserung der Verständlichkeit juristischer Texte
- Die Rolle von Emotionen und Intuition in der Rechtsprechung
- Der Einfluss der Sprache auf die Rechtsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Sprache allgemein: Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen der Sprache, den Unterschied zwischen angeborener und erlernter Sprache und die Bedeutung von leichter Sprache, insbesondere im juristischen Kontext. Es beleuchtet verschiedene Initiativen, die sich mit der Vereinfachung von Sprache beschäftigen und analysiert die Faktoren, die zu Unverständlichkeit führen. Der Einfluss von Sprachgefühl und die Rolle von Intuition und Bauchentscheidungen in der Sprachverarbeitung werden ebenfalls behandelt. Beispiele aus der Praxis verdeutlichen die Herausforderungen einer klaren und verständlichen Kommunikation.
2 Die Sprache der Juristen: Dieses Kapitel analysiert die spezifische Sprache von Juristen in Urteilen und Gesetzen. Es werden Beispiele für unverständliche Formulierungen und deren Folgen aufgezeigt. Dabei wird auf die Möglichkeiten der Verbesserung hingewiesen, inklusive konkreter Vorschläge zur Vereinfachung. Die Kapitel behandelt die Probleme der Rechtsbeugung durch unklare Sprache. Es untersucht verschiedene Rechtsgebiete wie Grundrechte, Asylrecht und das Bürgerliche Gesetzbuch, um die sprachlichen Herausforderungen zu verdeutlichen.
3 An der Sprache scheitern – Beispiel Arbeitszeugnisse: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Problematik der Sprache in Arbeitszeugnissen. Er beschreibt die juristischen Grundlagen des Zeugnisrechts, die Prinzipien der Wahrheit und des Wohlwollens, und analysiert die Herausforderungen bei der Interpretation von oft verklausulierten Formulierungen. Es werden verschiedene Techniken wie die Reihefolgetechnik, Negationstechnik und Leerstellentechnik erläutert, die in Arbeitszeugnissen verwendet werden, um sowohl positive als auch negative Aspekte des Arbeitsverhaltens auszudrücken. Die Bedeutung der einzelnen Formulierungen und ihre Auswirkungen auf die zukünftigen Karrieremöglichkeiten des Bewerbers werden untersucht.
4 Korrekt und verständlich formulieren - wie geht das?: Dieses Kapitel bietet praktische Tipps und Strategien für das Verfassen klarer und verständlicher Texte. Es werden Empfehlungen zur Verwendung von Verben und Substantiven, zur Vermeidung falscher Adjektive und zur Verwendung von Bildern gegeben. Die Kapitel erörtert den Unterschied zwischen Indikativ und Konjunktiv und stellt ein Verständlichkeitskonzept vor, das von Wissenschaftlern entwickelt wurde. Der Fokus liegt darauf, die Leser an die Hand zu nehmen und ihnen konkrete Werkzeuge für die Verbesserung ihrer eigenen Schreibfähigkeiten an die Hand zu geben.
5 Vom Recht auf verständliche Gesetze und Entscheidungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung einer verständlichen Sprache in der Juristenausbildung und im Kontext von Gesetzen und Gerichtsentscheidungen. Es diskutiert die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung von Juristen in Bezug auf klare und verständliche Kommunikation und die Implikationen für das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit.
Schlüsselwörter
Juristische Sprache, Verständlichkeit, Leichte Sprache, Rechtsprechung, Gesetzestexte, Arbeitszeugnisse, Kommunikation, Intuition, Emotionen, Sprachstil, Formulierungstechniken, Rechtsbeugung, Juristenausbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Verständlichkeit juristischer Sprache"
Was ist der Hauptfokus dieses Buches?
Der Hauptfokus liegt auf der Verbesserung der Verständlichkeit juristischer Sprache. Das Buch untersucht die Ursachen von Unverständlichkeit in juristischen Texten und bietet Strategien für eine klarere und zugänglicher Gestaltung dieser Texte. Es analysiert die Sprache im rechtlichen Kontext und entwickelt Wege für eine bessere Kommunikation zwischen Juristen und Laien.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt eine breite Palette von Themen, darunter die allgemeine Sprachwissenschaft, die spezifische Sprache von Juristen in Urteilen und Gesetzen, die Problematik der Sprache in Arbeitszeugnissen und praktische Tipps zur Verbesserung der eigenen Schreibfähigkeiten. Es werden verschiedene Sprachstile verglichen, Methoden zur Verbesserung der Verständlichkeit juristischer Texte vorgestellt und die Rolle von Emotionen und Intuition in der Rechtsprechung diskutiert.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt allgemeine Aspekte der Sprache und die Bedeutung leichter Sprache. Kapitel 2 analysiert die Sprache der Juristen in Urteilen und Gesetzen. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Problematik der Sprache in Arbeitszeugnissen. Kapitel 4 bietet praktische Tipps zum verständlichen Formulieren. Kapitel 5 diskutiert das Recht auf verständliche Gesetze und Entscheidungen und die Bedeutung der Juristenausbildung.
Welche Beispiele werden im Buch verwendet?
Das Buch verwendet zahlreiche Beispiele aus der Praxis, um die behandelten Themen zu veranschaulichen. Es werden Beispiele aus Urteilen, Gesetzen (z.B. BGB, Kündigungsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), Arbeitszeugnissen und Formularen analysiert. Diese Beispiele dienen dazu, die Unverständlichkeit juristischer Sprache aufzuzeigen und die vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen zu illustrieren.
Welche Methoden zur Verbesserung der Verständlichkeit werden vorgestellt?
Das Buch präsentiert verschiedene Methoden zur Verbesserung der Verständlichkeit, einschließlich Tipps zur Verwendung von Verben und Substantiven, zur Vermeidung falscher Adjektive und zur Verwendung von Bildern. Es wird ein Verständlichkeitskonzept vorgestellt und der Unterschied zwischen Indikativ und Konjunktiv erläutert. Es werden auch konkrete Vorschläge zur Vereinfachung von Gesetzestexten und Urteilen gegeben.
Welche Rolle spielen Emotionen und Intuition in der Rechtsprechung?
Das Buch untersucht die Rolle von Emotionen und Intuition in der Rechtsprechung und deren Einfluss auf die Sprachwahl und die Entscheidungsfindung. Es wird beleuchtet, wie Sprachgefühl und intuitive Urteile die Interpretation von juristischen Texten beeinflussen können. Der Einfluss von Körpersprache und Selbstdarstellung wird ebenfalls thematisiert.
Was ist "Leichte Sprache" und welche Bedeutung hat sie im juristischen Kontext?
Das Buch diskutiert den Begriff "Leichte Sprache" und ihre Bedeutung im juristischen Kontext. Es wird erklärt, für wen Leichte Sprache gedacht ist und welche Initiativen sich mit der Vereinfachung von Sprache beschäftigen. Die Vorteile und Herausforderungen der Verwendung leichter Sprache in rechtlichen Dokumenten werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Buches beschreiben, sind: Juristische Sprache, Verständlichkeit, Leichte Sprache, Rechtsprechung, Gesetzestexte, Arbeitszeugnisse, Kommunikation, Intuition, Emotionen, Sprachstil, Formulierungstechniken, Rechtsbeugung, Juristenausbildung.
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Dieses Buch richtet sich an Juristen, die ihre Schreibfähigkeiten verbessern und die Verständlichkeit ihrer Texte optimieren möchten. Es ist aber auch für alle anderen geeignet, die sich für die Sprache des Rechts interessieren und ein besseres Verständnis juristischer Texte erlangen wollen. Das Buch ist besonders hilfreich für Studenten der Rechtswissenschaften und alle, die mit juristischen Texten arbeiten.
- Quote paper
- Karl-Heinz List (Author), 2017, Juristensprache verständlich machen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356016