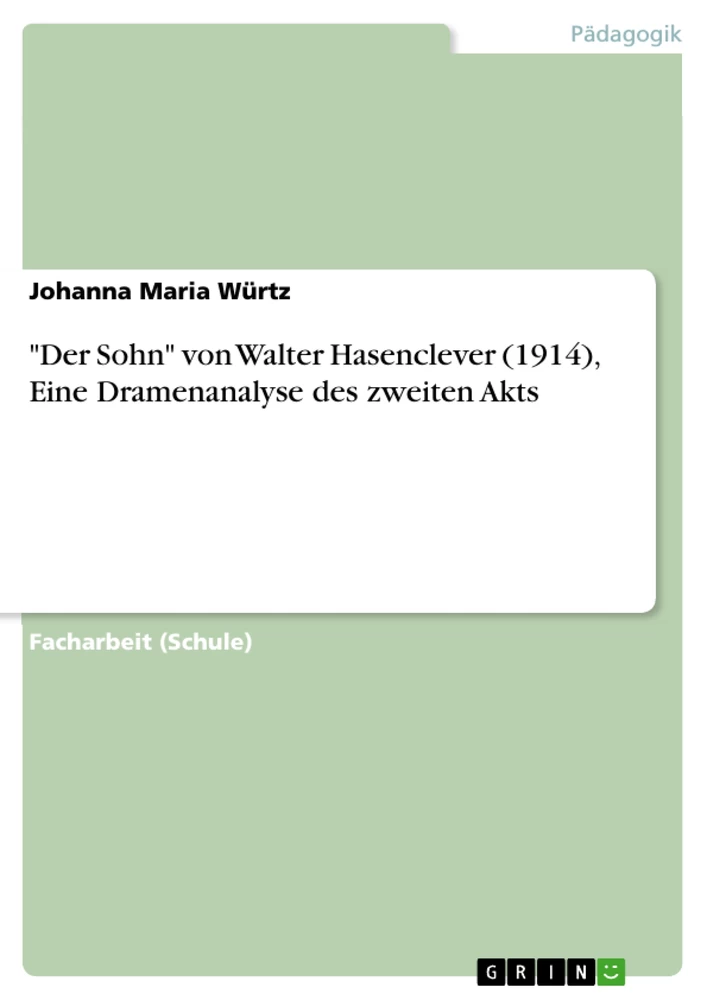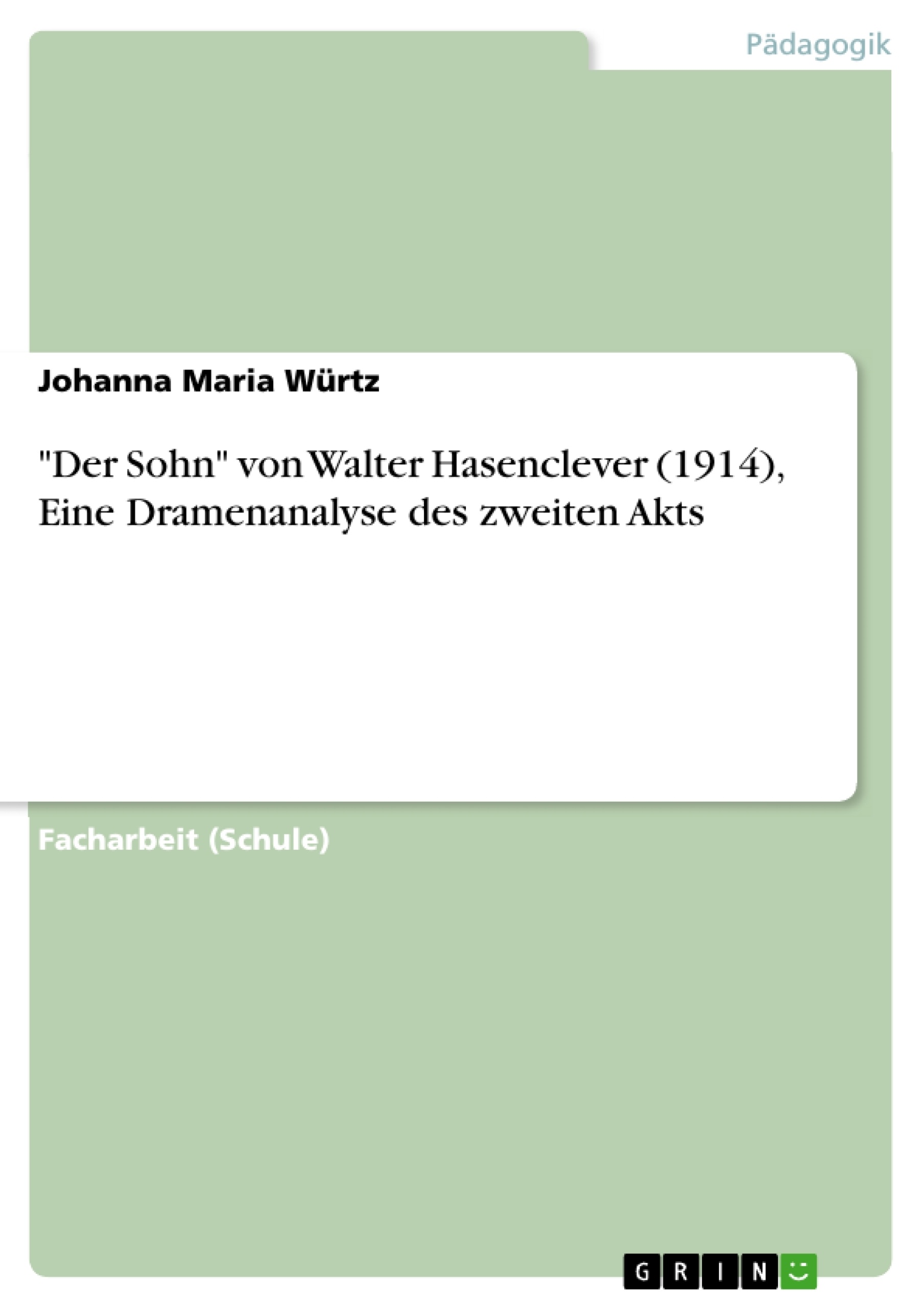Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die gesellschaftliche Situation einerseits geprägt von zunehmender Urbanisierung, Industrialisierung und allgemeiner Modernisierung, denen andererseits die starren bürgerlichen Lebens- und Sozialisationsformen der Kaiserzeit gegenüberstehen. Insbesondere die Schulbildung ist geprägt von militärischer Disziplinierung, wobei die Ausführung des Lehrauftrags im Befehlston und auch unter Gebrauch der Prügelstrafe als Erziehungsmethode die einzige Aufgabe der Lehrer ist. Aufgrund fehlender Individualisierung des Unterrichts bezeichnet der Pädagoge Theodor Wilhelm diese „alte Schule“ treffend als „pädagogische Massenfabrik“. Aus dieser Situation heraus formiert sich eine bürgerliche Jugendbewegung, die gekennzeichnet ist durch die Hinwendung zur Natur und die Auslebung kreativer Energien. In dieser Zeit wächst auch der 1890 in Aachen geborene Medizinersohn Walter Hasenclever auf, der sich während seines Jurastudiums mehr und mehr der Literatur und Philosophie zuwendet und ab seinem 20. Lebensjahr eigene Werke veröffentlicht. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Dramenanalyse
- Der Sohn (Walter Hasenclever, 1914)
- Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die gesellschaftliche Situation einerseits geprägt von zunehmendem Urbanisierung, Industrialisierung und allgemeiner Modernisierung, denen andererseits die starren bürgerlichen Lebens- und Sozialisationsformen der Kaiserzeit gegenüberstehen.
- Insbesondere die Schulbildung ist geprägt von militärischer Disziplinierung, wobei die Ausführung des Lehrauftrags im Befehlston und auch unter Gebrauch der Prügelstrafe als Erziehungsmethode die einzige Aufgabe der Lehrer ist.
- Aufgrund fehlender Individualisierung des Unterrichts bezeichnet der Pädagoge Theodor Wilhelm diese „alte Schule“ treffend als „pädagogische Massenfabrik“.
- Aus dieser Situation heraus formiert sich eine bürgerliche Jugendbewegung, die gekennzeichnet ist durch die Hinwendung zur Natur und die Auslebung kreativer Energien.
- In dieser Zeit wächst auch der 1890 in Aachen geborene Medizinersohn Walter Hasenclever auf, der sich während seines Jurastudiums mehr und mehr der Literatur und Philosophie zuwendet und ab seinem 20. Lebensjahr eigene Werke veröffentlicht.
- In seinem fünfaktigen Drama „Der Sohn“ von 1914 richtet sich Walter Hasenclever deutlich nach der 1863 von Freytag entwickelten Dramentheorie, die wiederum stark an den antiken Vorbildern orientiert ist.
- Die vorliegende Szene gehört zum zweiten Akt, welcher demnach einen Anstieg der Handlung beinhaltet, durch Problementwicklung und Konflikte wird ein Spannungsaufbau beim Publikum bewirkt.
- Die klassisch geschlossene Form wird in diesem Ausschnitt deutlich durch Linearität und Zeitdeckung, die Beschränkung auf die Personen des Vaters und Sohnes, die nicht näher benannt werden, wie auch auf das Zimmer des Sohnes als Handlungsort.
- Zeitlich lässt sich die Textpassage in die Nachtzeit einordnen, da der bereits erwachsene Sohn (in Zeile 86) zu Bett geschickt wird.
- Die zweite Szene beginnt mit dem Betreten des Zimmers durch den Vater gefolgt von der Begrüßung beider Akteure und einem recht oberflächlichen Wortaustausch zu einer durchgefallenen Prüfung des Sohnes und endet mit dessen Wunsch, sich trotz der Befürchtung eines Verständnisproblems anständig zu unterhalten.
- Die Redeanteile sind in diesem Abschnitt noch etwa gleichmäßig verteilt, allerdings äußert sich der Vater ausschließlich in Form von rhetorischen Fragen und einem kurzen Ausruf als Aufforderung.
- Schon allein durch ihre Gestik zu Beginn wird eine gewisse Distanz zwischen den Handlungsträgern deutlich, die aber auch einfach dem Geist der Kaiserzeit geschuldet sein kann: Der Sohn tritt auf seinen Vater zu, doch dieser reicht ihm nicht einmal die Hand zur Begrüßung, sondern blickt lediglich von oben auf ihn hinab (Z.3).
- Der Vater wirkt dadurch deutlich erhöht und dominant.
- Die Beteuerung des Sohnes, nicht faul gewesen zu sein, und die direkte Anrede als „Papa\" (Z.13) haben zu Folge, dass der Angesprochene spöttisch dessen Bücher umschmeißt und ihm vorwirft, anstelle des Vokabellernens nur „Unsinn zu lesen“ (Z.15).
- Der Feststellung zur momentanen Situation folgt die Anschuldigung, ein „Tagedieb“ zu sein (Z.19).
- Der Sohn reagiert – wiederum im Kontrast fast mit Zärtlichkeit seinen Büchern gegenüber und fordert mit dem Ausruf: „Welchen Maßstab legst du an!\" das Gewissen des Vaters heraus (Z.22).
- Dieser bezeichnet sein Kind daraufhin zu dessen Unverständnis aber nur als persönliche Schande.
- Deutlich treten schon hier die unterschiedlichen Interessenslagen der Hauptpersonen zum Vorschein: Der Vater fordert Gewissenhaftigkeit im Studium der Wissenschaft, während der Sohn viel lieber in der klassischen Literatur schmökert.
- Im weiteren Verlauf der Szene fragt der Junge zunächst nach den Gründen für die Anschuldigung, worauf der Vater befiehlt: „Lass diese Phrasen.“ (Z.29) und dann antithetisch eine Gewaltandrohung folgen lässt.
- Daraufhin legt endlich der Sohn seine Einstellung zu seinem Leben und der gemeinsamen Beziehung dar, was in die dringende Bitte mündet, gleichberechtigt und vor allem ernst genommen zu werden.
- Er gesteht seine bisherige Nachlässigkeit und Engstirnigkeit, beteuert aber gleichzeitig, ihm seien nun die Augen geöffnet, und entschuldigend setzt er nach, sogar „mehr als [der] Papa\" (Z.39) gesehen zu haben.
- Auf die umfangreichen hochsprachlichen Ausführungen des Jugendlichen antwortet der Vater nur mit einem sarkastischen Ausruf bezogen auf die sprachlichen Fähigkeiten des Jüngeren, was dieser wieder als Drohung auffasst.
- Der Sohn bittet deshalb dringend, seine Ausführungen beenden zu dürfen, und klagt den Vater seiner Erziehungstechniken wegen an, unter denen er sowohl körperlich als auch geistig gelitten und „alle Scham und Not ausgekostet“ habe (Z.48f.).
- Gleichzeitig schwingt die Angst mit, auch die letzten Freuden im Leben zu verlieren.
- Mit der gleichen Allgemeingültigkeit und Antithetik wie zuvor (in Z.29f.) trägt der Vater nun wieder seine Erziehungslehre vor und macht darauf aufmerksam, dass es immer schlimmer kommen könne.
- Doch auf die Drohung hin, ihn ganz aus dem Haus zu verbannen, meint der Sohn nur: „Hättest du es getan, ich wäre ein Stück mehr Mensch als ich bin.“ (Z.54)
- Der Vater beruft sich im Folgenden auf seine Verantwortung dem Sohn gegenüber, bis dieser sich selbst ernähren könne, gleichzeitig macht er aber auch deutlich, dass ihm alles egal sei, was danach in und mit dem Leben des Jungen passiere.
- Der Sohn wiederholt die Ausführungen seines Vaters mit seinen Worten, die er mit einer verständnisvollen Anrede an den „Papa“ (Z.58) beginnt und am Ende seines Redeabschnitts die Aussage insbesondere durch die Ausrufe der Beschuldigung, in denen er die „Verblendung\" mit der „Verantwortung“ vergleicht, verstärkt und eine große Eindringlichkeit durch die elliptische Nebeneinanderstellung von „Eigennutz“ und „Väterlichkeit“ (Z.61f.) erreicht.
- Vor allem diese Textpassagen über die Kindheit des Sohnes und die Erziehungsmethoden und Ansichten des Vaters erwecken deutlich die Sympathie des Publikums für den Sohn und erzeugen eine gewisse Nähe zum Geschehen.
- Im folgenden Abschnitt läuft das Gespräch endlich auf seinen zentralen Anlass zu, nachdem der Vater in Zeile 63 wiederum deutlich gemacht hat, dass er seinen Sohn nicht ernst nimmt, ihm sogar noch vorwirft, selbst nicht zu begreifen, was er erzählt und später ausdrücklich nach dem Grund der Unterredung fragt.
- Ausdrücklich und sehr emotional versucht der Sohn zu verdeutlichen, dass er ein menschliches Wesen mit Gefühlen gleich seinem Vater sei.
- Er stellt sich einem „ewig glatte[n] Kieselstein“ gegenüber und veranschaulicht seine Sterblichkeit und Sentimentalität, um gleich darauf den großen Wunsch auszurufen: „Könnt ich dich erreichen auf der Erde! Könnt ich näher zu dir!\" (Z.70f.)
- Er erfragt die Gründe für Feindseligkeit und Abneigung, scheint dann aufgrund fehlender Nähe die Strategie zu wechseln und statt weiterhin Gleichberechtigung zu erkämpfen, bittet er den Vater um Hilfe und Geborgenheit für seinen „Aufstieg zum Himmel“ (Z.72) und unterwirft sich schließlich, um den Vater in seiner Position in der Hierarchie abzusichern und durch das gleichzeitige Ergreifen seiner Hand trotzdem ein Gefühl größerer Nähe zu schaffen als zu Beginn des Gesprächs.
- Der Vater aber weist befehlend alles von sich, bezeichnet die Geste des Jungen gar als „Mätzchen“ (Z.74) und verstärkt durch seinen umgangssprachlichen Ausdruck die Differenz zu dem „, Menschen, vor dem [er] keine Achtung habe.“ (Z.75)
- Während sich der Sohn langsam aufrichtet, gibt er einerseits dem Vater Recht, stellt gleichzeitig aber auch eine Reihe rhetorischer Fragen zu der Grenze zwischen Vater und Sohn sowie zu seinen eigenen Rechten, kommt wieder auf die Gleichheit der Menschen zu sprechen und erkennt schließlich in dem „Verlassen im höchsten Schmerz“ (Z.81) das Fehlen väterlicher Liebe.
- Trotz der Unterwerfung zweifelt der Vater darauf an dem Respekt des Sohnes und fühlt sich persönlich beschuldigt.
- Mit der Bezeichnung „Landstreicher auf der Straße des Gefühls“ (Z.84) stellt er seinen Sohn als launisch, dessen Gefühle als bedeutungslos dar und zweifelt sogar an seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit, weshalb er ihm schlussendlich befiehlt, schweigend zu Bett zu gehen.
- Parallel zu dessen Formulierung ruft der Sohn seinem Vater zu, er solle ihn zu Ende anhören, und versucht im Folgenden, ihn mit verzweifelten Ausrufen von den Hintergründen seines Wunsches nach väterlicher Nähe zu überzeugen.
- Besonders betont der Junge dabei, wie „oft [er] schuldlos gestraft worden [sei]“ (Z.89f.) weil kein Mensch ihm Glaube und Mitgefühl geschenkt habe.
- Der Sohn vergleicht sich mit einem Affen in der Manege, wirft seinem Vater Gottlosigkeit vor (Z.94), fragt erneut nach seiner Sünde und bittet um Freiheit, um „endlich einen Strahl des allerbarmenden Lichtes sehn [zu können].“ (Z.98f.)
- Doch auch auf diese geballte, wortgewandte Rede, die den tiefen Glauben des Sohnes erkennen lässt, reagiert der Vater erneut mit purer Verständnislosigkeit.
- Daraufhin unternimmt der Junge einen weiteren Versuch, den Vater seinen großen Wunsch erfassen zu lassen, indem er seine eigene Situation mit der eines Erkrankten in der Klinik vergleicht und dem Publikum dadurch gleichzeitig erste Hinweise zum Berufsleben des Vaters gibt.
- In Erwartung einer endgültigen Zurückweisung scheint sich die Hoffnung des Sohnes geradezu zu steigern, als er betont: „mein Wunsch ist doch größer als du in dieser Sekunde.\" (Z.111f.), und später noch zuversichtlich nachlegt, er werde immer wiederkommen und ihn bitten, bis der Vater ihn erhöre. (Z.126f.)
- So steigert sich die Argumentationsweise des Sohnes bis er zum Schluss dieses Absatzes mit „feurig[er]“ Stimme „Das Höchste“ (Z.129) von seinem Vater verlangt, er strebt Gleichstellung und Freundschaft an und möchte vollstes Vertrauen und seinen Segen für die Zukunft.
- Der Vater dagegen macht deutlich, dass er seine Meinung nicht ändern wird, und bezeichnet seinen Sohn aufgrund dessen mangelnden Erfahrungen bei gleichzeitig so großen Reden und Wünschen widersprüchlicherweise als „greisenhaft traurige[n] Narr“ (Z.113f.).
- Er gibt dem Sohn die Schuld an allem, was ihm in seiner Kindheit und Jugendzeit widerfahren ist (Z.121f.) und führt sein Aufbegehren schließlich auf mangelnde Strenge in dereigenen Erziehung zurück.
- Diese Ziele und Ansichten der beiden Hauptakteure werden so durch verschiedene Argumentationsweisen bei steigender Spannung und wachsender Gegensätzlichkeit immer weiter verfestigt, sodass aus einem einfachen kleinen Familienkonflikt die allgemeinen Gesellschaftsprobleme deutlich zu Tage treten.
- Dabei stehen sich der strenge, konservative Vater als Mediziner und Naturwissenschaftler und der Freigeist des rebellischen Sohnes, der für Geisteswissenschaft, Theater und klassische Literatur einsteht, gegenüber.
- Die meisten Zuschauer werden in diesem Abschnitt der Szene eher mit dem Sohn sympathisieren und ihn um die Reife und das Selbstbewusstsein bewundern, durch die seine umfangreiche und besonders ehrliche Argumentation im Gegensatz steht zu der relativ kurz gefassten und unpersönlichen, oft sogar abwertenden Ausdrucksweise des Vaters.
- Der Wunsch nach elterlicher Liebe und dessen Erfüllung ist, oder sollte zumindest selbstverständlich sein, doch der Vater scheint nicht einmal versuchen zu wollen, sich in die Situation des Jungen hinein zu versetzen.
- Doch die Relationen zwischen den Akteuren und dem Betrachter, wie auch die konstanten Vorgehensweisen der Personen kommen im folgenden Teil der Szene etwa ab Zeile 134 ins Schwanken und kehren sich, nachdem der Vater schließlich die Kontrolle verliert und den Sohn ins Gesicht schlägt, am Wendepunkt des Gesprächs sogar um.
- Der Vater wirkt plötzlich sorgenvoll, pflichtbewusst, versucht seinen Sohn zu unterstützen, nimmt ihn in den Arm und bittet: „Stoß in dieser Stunde meine Hand nicht zurück, wer weiß, ob ich sie dir so warm wieder biete.“ (Z.260f.)
- Der Sohn aber weist jetzt seinerseits alle Näherungsversuche von sich und möchte lediglich seinen eigenen Weg gehen, in die Unabhängigkeit von seinem Vater.
- Dabei erscheint der junge Erwachsene allerdings eher wie ein Pubertierender, der die Grenzen testen möchte und die Person seines Vaters wie auch dessen Taten nicht zu achten weiß.
- Die Redeanteile in diesem zweiten Teil der Szene sind relativ ausgeglichen, nur ganz zum Ende hin in Folge des Verschließens der Tür (Z.275) spricht überwiegend der Vater und der Sohn reagiert nur mit kurzen, gefühlsleeren Fragen und Aussagen.
- Nach dem letzten emotionalen Ausruf: „Also Haß bis ins Grab!“ (Z.88) zwischen den Anordnungen des Vaters, die ihm einen festen Weg für die Zukunft vorgeben, scheint plötzlich die ganze Dramatik des Streites verflogen, als der Sohn seinem Papa eine gute Nacht wünscht, folgsam noch alles Geld aushändigt und dann regungslos stehen bleibt.
- Diese Reaktion wiederum erweckt bei dem Vater, der ihn aus Angst vor Neuerungen und Ungewissheit nicht gehen lassen kann, eine gewisse Ergriffenheit, und er verabschiedet sich mit den Worten: „, Ich komme morgen nach dir sehen. – Schlaf wohl!“ (Z.299f.).
- Die Infragestellung bestehender Ordnungen in Wirklichkeit und Alltag und des alten Gedankenguts, hier bezogen auf Eltern und Lehranstalten, erweckt den Wunsch nach etwas Neuem für sich selbst und stellt eine typische Bewegung in der Zeit des
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Dramenanalyse von Walter Hasenclevers „Der Sohn“ befasst sich mit der Darstellung des Konflikts zwischen Vater und Sohn im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Analyse zielt darauf ab, die komplexen Beziehungsmuster der beiden Protagonisten aufzudecken und die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in diesem Konflikt widerspiegeln, zu beleuchten.
- Generationenkonflikt
- Individuelle Freiheit vs. gesellschaftliche Normen
- Väterliche Autorität und Erziehungsmethoden
- Suche nach Selbstfindung und Identität
- Die Rolle der Kunst und Literatur in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der zweite Akt des Dramas „Der Sohn“ beginnt mit einer Konfrontation zwischen Vater und Sohn. Der Vater wirft dem Sohn vor, faul und verantwortungslos zu sein und kritisiert dessen Interesse an Literatur statt an wissenschaftlichen Studien. Der Sohn versucht, seine Sichtweise zu erklären und nach Verständnis für seine Bedürfnisse und Wünsche zu suchen. Der Konflikt zwischen den beiden spiegelt die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit wider: Während der Vater an traditionellen Werten und Autorität festhält, strebt der Sohn nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Dramenanalyse von „Der Sohn“ befasst sich mit zentralen Begriffen wie Generationenkonflikt, Individualismus, Väterlichkeit, Kunst und Literatur, sowie den gesellschaftlichen Veränderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
- Quote paper
- Johanna Maria Würtz (Author), 2017, "Der Sohn" von Walter Hasenclever (1914), Eine Dramenanalyse des zweiten Akts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355634